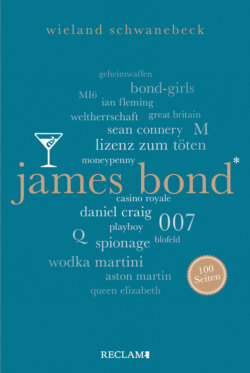Читать книгу James Bond. 100 Seiten - Wieland Schwanebeck - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление002 Sein Name sei Bond
Die Anfänge
Schuld ist natürlich eine Frau gewesen – jedenfalls Ian Fleming zufolge. Auf die Frage, was ihn dazu bewogen habe, es mit Mitte Vierzig plötzlich seinem älteren Bruder Peter gleichzutun und Romane zu schreiben, verwies der Autor auf seine nahende Heirat, die ihn so nervös gemacht habe, dass er sich ablenken musste. Fleming, der 1908 als Sohn eines konservativen, mit Churchill befreundeten Politikers in London zur Welt kam, konnte zu diesem Zeitpunkt bereits auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Nicht nur seine Steckenpferde qualifizierten ihn für die Erfindung von James Bond (er interessierte sich für Technik, sprach gern dem Alkohol zu und ging mit Jacques Cousteau auf Tauchgang), auch seine Erfahrungen als Börsenmakler, Auslandskorrespondent und Navy-Stratege im Zweiten Weltkrieg dürften ihm zugutegekommen sein. Berührungspunkte mit den Geheimdiensten gibt es bei vielen, die sich in der Spionageliteratur einen Namen gemacht haben: William Somerset Maugham, Graham Greene, John le Carré. (Was wohl die britische Regierung davon hält, dass so viele ihrer Ehemaligen ›auspacken‹? Stella Rimington, die in den 1990er Jahren den Inlandsgeheimdienst MI5 leitete, hat seit ihrer Pensionierung zehn Spionageromane veröffentlicht.)
Bekannt ist, dass sich Fleming den Namen seines Helden bei einem Ornithologen abguckte, der ein Standardwerk über die Vogelvielfalt der Karibik verfasst hatte (Birds of the West Indies, 1936) und mit dessen Frau er später ein paar Briefe wechselte – in einem bot er ihr scherzhaft an, ihr Mann könne ja aus Rache »eine besonders abscheuliche Vogelart« nach ihm benennen. Für den Erfolg von James Bond dürfte der auffallend unauffällige Name ebenso wichtig gewesen sein wie die Vorbilder, bei denen sich Fleming bediente. Dazu zählten reale Kriegshelden (u. a. sein Bruder) ebenso wie fiktive Spione, z. B. der in mehreren Büchern von John Buchan auftretende Richard Hannay. Alfred Hitchcocks Buchan-Verfilmung Die 39 Stufen (The 39 Steps, 1935), in der Robert Donat einen verschmitzten und sehr charmanten Hannay spielt, nimmt bereits viel Bond-Typisches vorweg.
Aber Fleming bediente sich nicht bloß gekonnt bei anderen, er setzte auch erfolgreich eigene Akzente innerhalb des Spionagegenres. Zu seinem literarischen Spleen wurden die zahllosen Marken und Konsumgüter, die er mit ethnographischer Detailtreue in seinen Büchern festhält. Wir sind als Leser immer darüber im Bilde, was Bond frühstückt und welche Zigarettenmarke er raucht. Nebenbei erfahren wir bei Fleming, dass ein ›richtiger‹ Mann keinem Laster abgeneigt ist, sich im abgebrühten Tonfall der US-amerikanischen Hard-boiled-Krimis unterhält und welchem Prominenten Bond ähnlich sieht (dem Liedermacher Hoagy Carmichael, der u. a. den Ohrwurm »Georgia on My Mind« geschrieben hat). Der erste Band, Casino Royale (1953), ist noch ein dicht gearbeitetes Kammerspiel ohne große Reiseroute, demonstriert aber bereits viele von Flemings Stärken. Die folgenden Romane, deren Plots extravaganter und deren Settings immer exotischer wurden, brachten dem Bond-Regisseur Terence Young zufolge Hollywoodglamour ins Nachkriegsengland, wo »das Essen und das Gas streng rationiert waren und das Leben keinen Spaß machte. Ians Bücher erinnerten uns an eine andere Welt, in der es vorzügliches Essen, schöne Autos und luxuriöse Hotels gab.«.
Die Exotik hatte sich Fleming übrigens nicht in einer englischen Mansarde zusammenfantasiert – er schrieb auf seinem jamaikanischen Anwesen Goldeneye, wo er Jahr um Jahr den englischen Winter aussaß, täglich einige tausend Wörter in die Tasten haute und binnen zwei Monaten seine Manuskripte abschloss. Zwischen 1953 und 1965 erschienen zwölf Bond-Romane und mehrere Kurzgeschichten. Flemings Produktivität ist ihm angelastet worden, aber den Autor, der auch Reiseberichte, Kinderbücher und zahllose Kolumnen für die Times schrieb, pauschal als geistlosen Vielschreiber abzutun, wäre nicht fair. Fleming ist ein versierter Stilist, dessen minutiöse Beschreibungen weit über dem Genredurchschnitt liegen und der mit sicherem Strich Schauplätze und Stimmungen skizziert. Sportliche Wettkämpfe wie Bonds Golfmatch gegen Auric Goldfinger und seine Bridgepartie mit Hugo Drax gestaltet Fleming auch über dreißig bis vierzig Seiten Erzählzeit kurzweilig, seine Plots sind effektiv durchkomponiert, die Spannungsbögen virtuos konstruiert – Bonds nächtliche Flucht aus der Alpenfestung Piz Gloria (Im Geheimdienst Ihrer Majestät, 1963) ist ein Glanzstück des literarischen Thrillers. Es ist – und das ist nicht abschätzig gemeint – Prosa nach dem Lego-Prinzip: üppig in den Details und ziemlich robust. Dass die Spielfiguren keine lebensechten Gesichter tragen, mindert den Unterhaltungswert nicht. Der US-amerikanische Krimigigant Raymond Chandler riet Fleming, mehr Zeit und Mühe zu investieren, um als seriöser Schriftsteller Anerkennung zu finden. Aber da ist der große Chandler etwas ungerecht. Fleming arbeitete durchaus mit Bedacht und erledigte auch seine Hausaufgaben gewissenhaft; legendär sind seine Briefwechsel mit Waffen- und Slang-Experten, bei denen er sich Expertise holte, und als Leser ihn darauf hinwiesen, dass er dem Orientexpress versehentlich hydraulische Bremsen angedichtet hatte, machte ihm das sehr zu schaffen.
Mehr zu kauen als an der sorgfältig gestalteten Oberfläche hat man heute ohnehin am ideologischen Ballast der Bücher, und das gilt sowohl für Flemings Darstellung unterschiedlicher Ethnien als auch für sein krudes Geschlechterbild. Frauen wollen in diesen Büchern genommen und dominiert werden (No means yes!), Männlichkeit heißt dagegen Zupacken, die Ärmel hochkrempeln und auf Risiko spielen. Sich selbst inszenierte Fleming gern als lässigen Naturburschen, der den intellektuellen Salonzirkel seiner Frau als einen Haufen weltfremder Weicheier verspottete. Engen Freunden enthüllte Fleming dagegen auch eine andere Seite: die eines bibliophilen Feingeists, der über immensen Kunstsachverstand verfügte und eine stolze Sammlung historischer Erstausgaben besaß, darunter ein Exemplar des Kommunistischen Manifests. Mit Introspektion konnte Fleming aber weder privat noch in seiner Arbeit etwas anfangen. Selbstreflexion hielt er für Zeitverschwendung, wie er in seinen Tipps für angehende Autoren anmerkt: Gründliche Recherche und hohe Produktivität sind das A und O, bloß nicht zu viel nachdenken. Flemings rasantes Schreibtempo schlägt sich im Erzähltempo nieder, sodass sein Verlag ihn wiederholt ermahnen musste, nicht so viele Sätze mit »Und« zu beginnen, sondern lieber mal durchzuatmen. Der Mangel an Verschnaufpausen forderte schließlich seinen gesundheitlichen Tribut, als Fleming auf dem Höhepunkt seines Ruhms war – er starb 1964 mit gerade einmal 56 Jahren, am 12. Geburtstag seines Sohns und wenige Wochen vor der Premiere von Goldfinger.
Seines Helden war Fleming da bereits überdrüssig geworden. Schon am Ende von Band 5, Liebesgrüße aus Moskau, lässt er Bond über die Klinge springen, so wie der genervte Arthur Conan Doyle einst Sherlock Holmes die Reichenbach-Fälle hinabschubste. Doch auch Fleming gab dem Druck des Publikums nach und machte ›lebenslänglich‹ Bond, bezeichnete sich selbst gar als dessen Biographen. Zugleich ließ er es sich nicht nehmen, die Fans zu quälen, indem er ihnen von Zeit zu Zeit Storys vorsetzte, die nur wenig mit der James-Bond-Formel zu tun hatten. Der Kompromiss zwischen Vertrautem und Innovativem sollte auch für die Produzenten der Filmreihe zum Dauerproblem werden.
Ian Fleming (l.) besucht den Dreh von Goldfinger (1964), neben ihm die Produzenten: Harry Saltzman (M.) und Albert R. Broccoli (r.)