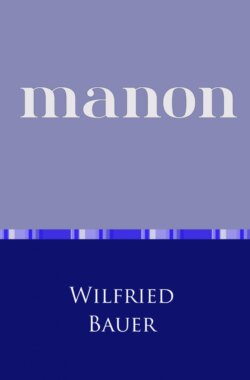Читать книгу Manon - Wilfried Bauer - Страница 9
Tom erzählt
ОглавлениеManon schaute herum: Tische mit weißen Decken, darauf kleine Blumenvasen mit roten Rosen, Bilder mit Landschaften an den Wänden, weiße Stores an den Fenstern.
„Jetzt sehe ich den Laden zum ersten Mal bewusst. Eine gemütliche Kneipe.“
„Danke. Bis auf die Tapeten und Dekoration auf den Tischen habe ich alles von meinen Vorgängern übernommen. Das Mobiliar hat schon dreißig Jahre auf dem Buckel.“
„Urig, wie eine alte Bauernstube.“
„Ich rufe Jo und Ricky.“
Die Zwei erschienen umgehend.
Manons entspannter Blick sagte: keine Gefahr Jungs, es ist alles gut. Vielleicht nahmen sie es nicht wahr, etwas scheu und übertrieben höflich grüßten sie.
„Tja“, begann Jo, „es ist viel Wasser die Fulda runter gelaufen und es tut uns immer noch sehr leid und wir möchten uns bei Ihnen entschuldigen.“
Manon schaute sie nacheinander an, machte es spannend, ließ sie zappeln, ehe sie sagte:
„Dumm gelaufen was? Ihr bekommt von mir mildernde Umstände.“ Die praktizierende Lehrerin musste noch mahnen, „so etwas darf nicht noch einmal passieren, dann kämt ihr nicht so glimpflich davon.“
„Frau Jenin und ich machen es uns an dem Tisch gemütlich und ihr bedient uns und auch die ersten Gäste, klar?“
„Alles klar Tom.“ Tom nahm einen tiefen Schluck aus dem Glas, bevor er erzählte.
„Ich hatte einen guten Job, Mechaniker in einer mittelgroßen Firma, hier in der Stadt. Die Konjunktur lief für uns blendend, wir machten jede Menge Überstunden. Meine Kollegen waren kumpelhaft, in den ersten Jahren hatten wir kompetente und angenehme Chefs. Über die späteren Jahre erzähle ich besser nichts. Ich verdiente gut und gab nicht viel aus. Kein Wunder ich bin ein genügsamer Typ, brauche keine Armbanduhr für fünftausend Euro, kein Auto für fünfzigtausend Euro. Solche Kollegen gab es, sie nannten es Lebensqualität.
An den Wochenenden ging ich zur Abwechslung aus, wollte nicht zu Hause versauern, war neugierig, was die Bräute so machten. Mit Anfang 30 hatte ich manchmal eine Freundin, meistens von kurzer Dauer.
Ich weiß nicht warum, ein Ekel war ich nicht, vielleicht zu langweilig. Die meiste Zeit meines Lebens verbrachte ich alleine. Ich war schon sechsunddreißig, als ich Vera traf. Ein heißer Feger, die Männer dackelten hinter ihr her. Merkwürdig: bei all den tollen Typen die um sie herumschwirrten, suchte sie meine Nähe. Wir verabredeten uns öfter und eines Tages landeten wir im Bett. Ich war Stolz sie zu haben. Ein Jahr später heirateten wir. Vielleicht geschah es überhastet. Sie arbeitete in einer Boutique, nach der Hochzeit gab sie diesen Job auf.“
Tom schaute nachdenklich durch das Fenster nach draußen.
„Sieben Jahre lebten wir zusammen. Dass es so lange lief, verdankte ich meiner Bequemlichkeit, nach ein paar Jahren lief nichts mehr zwischen uns. Keine Gemeinsamkeiten. Sie mit ihrem Interesse für Mode, Tratsch und andere Männer. Sie suchte ständig nach einem neuen Kick. Ich langweilte sie. Für Vera stellte das Leben eine Party dar. Nur Trallala.“
Tom schüttelte den Kopf.
„Nie ein vernünftiges Gespräch, keine gemeinsamen Interessen. Manchmal denke ich, ich habe sie nur aus Begierde geheiratet. Männer anmachen, darin war sie spitze. Ob sie mit all ihren kurzzeitigen Bekanntschaften schlief, weiß ich nicht und was erstaunlich war: Mich interessierte das nicht. Es lief einfach nicht zwischen uns, ich wendete mich innerlich ab. Ich, der eher scheue Typ im Hintergrund, und vorne auf der Bühne eine knallige Vera: Hallo Leute was kostet die Welt? Ich bin kein knauseriger oder geiziger Mann, doch ich arbeitete für ihr Vergnügen und das sah ich nicht ein. Sie suchte Arbeit, bekam auch eine Stelle. Ihre erotische Ausstrahlung gepaart mit einem heißen Flirt ließen die Personalchefs dahin schmelzen. Sie war nicht zuverlässig und bald zogen die Chefs die Reißleine. Vera wollte keine Kinder, das hätte uns vorübergehend aneinander geschweißt. Vor drei Jahren ließen wir uns scheiden.“
„Tja, was soll ich sagen, es gehen so viele Ehen in die Brüche, da schrecken viele Paare vor einer Hochzeit zurück. Wobei ich den Mann, den ich liebe auch heiraten möchte.“
„Na dann, viel Glück.“
Darauf stießen sie an, Manon Jenin mit ihrem Pfefferminztee und Tom Wächter mit einem Glas Bier. Manon nippte, Tom nahm einen kräftigen Schluck, stellte das halb leere Glas auf den Tisch und starrte es lange an, dann erzählte er weiter.
„In unserer Ehe stritten wir uns nie heftig, verschiedene Meinungen wie sie unter Eheleuten vorkommen gab es natürlich, es ging gesittet zu. Wir schmissen keine Teller durch die Gegend. Unseren Zorn äußerten wir durch Missachtung des Partners.
Manchmal redeten wir tagelang nicht miteinander. In diesen spannungsreichen Tagen fühlten wir uns innerlich näher, als in friedlichen Zeiten. Jeder dachte an den anderen. Jeder überlegte wie er es gut machen, den Anderen besänftigen könnte. Das ist mir nach der Scheidung bewusst geworden und nach ein paar Monaten vermisste ich sie.
Ich fiel in ein seelisches Loch, gab mir die Schuld an dem Scheitern unserer Ehe. Vielleicht arbeitete ich zu viel, kümmerte mich zu wenig um sie.“
Eine Pause trat ein und Tom fragte überraschend: „Hatten Sie denn schon mal eine längere Beziehung, drei Jahre oder noch mehr?“
„Zwei Partnerschaften über mehrere Jahre die traurig endeten. Irgendwann sagte ich zu mir: Verliebe dich nicht mehr. Ganz einfach. Es muss mich schon heftig treffen. Ich will es aber nicht grundsätzlich ausschließen. Freundschaften ja. Ich gehe in meinen Beruf auf, freue mich täglich auf meine Schüler, habe meine Leidenschaften: die Musik und der Sport. Ich bin ausgelastet, es fehlt mir an nichts.“
„Cool“, meinte Tom. „Darauf trinken wir einen. Mögen Sie zur Abwechslung ein Bier?“
„Nein, ein Glas Wasser. Hey, Sie trinken viel Alkohol, oder?“
„Das bleibt in meinem Job nicht aus. Ich trinke keine Schnäpse, höchstens ein paar Bierchen. Ich passe auf, betrunken hinter dem Tresen stehen, kann ich mir nicht erlauben. Überhaupt, wann betrank ich mich das letzte Mal? Es müsste in der Zeit der Trennung gewesen sein.“ Tom setzte seine Biografie fort.
„Dann kam die Arbeitslosigkeit. Ich war nicht verzweifelt, aber der Frust setzt einem zu, wenn es wieder und wieder eine Absage gab, ja, genau, in der Zeit trank ich viel. Es lief so prima in der Firma, doch von einem Tag auf dem anderen machten sie den Betrieb dicht. Das verstand keiner von uns, da lief im Hintergrund etwas Kriminelles ab, von dem wir kleinen Idioten nichts mitbekamen. Auch der Betriebsrat stand dumm da. Sie verzögerten die Insolvenz noch ein halbes Jahr. Während dieser Zeit setzten sie Sozialpläne um, danach schlossen sie den Laden endgültig. Zweihundert Leute verloren ihren Job, wir könnten ja nach Rumänien gehen, dahin verlagerten sie den Betrieb. Ein Jahr nach meiner Scheidung. Hier in der Gegend gab es keine große Industrie oder metallverarbeitende Betriebe, ein kleiner Krauter hätte mir gereicht.
In dieser reizenden Gegend wollte ich bleiben und überraschend bekam ich die Stelle bei der Post, dort verdiente ich nur die Hälfte wie vorher, aber es ging, ich bezog eine kleine Wohnung, meine materiellen Bedürfnisse schraubte ich runter.
In den letzten zwanzig Jahren legte ich mir einiges bei Seite, trotz der Jahre mit Vera. Ich zehrte davon und liebäugelte mit einem Objekt, dieses hier mit den Stühlen, auf denen wir gerade sitzen, die „Waldschänke.“ Von meinen Ersparnissen hätte ich mir dieses Anwesen nicht kaufen können, dann geschah das Schreckliche – meine Schwester Andrea starb. Unfassbar.
Die Gute vermachte mir in ihrem Testament hunderttausend Euro. Erst lehnte ich es ab, dann las mir der Notar ein Schreiben von Andrea vor. Diese Sätze vergesse ich mein ganzes Leben nicht mehr: mein lieber Bruder, du wunderbarer Mensch. Wie oft hast du mich gestützt, wie oft hast du mich getröstet, wie oft hast du mir neuen Lebensmut eingehaucht. Obwohl es dir selber nicht gut ging, unter deiner gescheiterten Ehe gelitten hast, dann die Arbeitslosigkeit, das haute dich um. Immer bist du aufgestanden, hast dich neu motiviert. Falls ich vor dir sterbe, vermache ich dir ein Teil meines gesparten Geldes. Ich weiß, kommt der Tag, dann wirst du dich weigern das Geschenk anzunehmen. Nimm es bitte, du wirst es gebrauchen. Für Jo und Ricky ist gesorgt. Ich liebe dich. Andrea.“
Tom und Manon verharrten einen Augenblick.
„Sie liebten sie sehr“, beendete Manon das Schweigen und wollte Einzelheiten zu Andreas Tod wissen.
„Das ist eine traurige Geschichte“, antwortete Tom.
„Ich schildere sie ein anderes Mal. Falls es ein anderes Mal gibt.“
„Gerne“, sagte Manon: „Ich bin neugierig auf die Fortsetzung.“
„Das freut mich, ich möchte Sie wiedersehen. Ich kann Sie zum Bahnhof fahren.“
„Nein, Sie haben was getrunken und ich gehe gerne zu Fuß, ich entspanne dabei. Es ist ja nicht so weit.“
„Wann sehe ich Sie wieder?“
„Morgen.“
„Morgen? Heute zweihundert Kilometer hin und zurück und am nächsten Tag noch mal?“
„Ich habe für ein paar Tage ein Hotel gebucht. Mir gefällt die Stadt.“
„Großartig.“
Gäste betraten die Schänke.
Manon genoss den sonnigen Tag und erschien erst am späten Abend in der Waldschänke. Tom saß alleine am kleinen Tisch neben der Theke.
„Guten Abend.“
„Guten Abend, ich dachte Sie kommen nicht mehr. Nichts los und das an einem Samstagabend. Die Jungs sind auf ihren Zimmern. Ich schließe die Schänke, dann setzen wir uns in den Garten.“
„Sie haben noch einen Biergarten hinter dem Haus?“
„Das ist ein kleiner Privatgarten.“
Sie gingen durch die Küche, an deren Ende eine Tür zum Garten lag. Eine überdachte Terrasse, ein großer Tisch stand in der Mitte, daran acht Stühle. Die Terrasse wurde von ein paar Sträuchern begrenzt, dahinter, in der Dunkelheit verschwindend, ein Nutzgarten.
„Haben Sie öfter Besuch?“
„Ab und an kommen ehemalige Kollegen oder Freunde von Jo und Ricky. Wir sitzen oft draußen, wenn es die Zeit erlaubt. Jo und Ricky machen hier gerne ihre Hausaufgaben.“ Tom zündete mehrere Windlichter an. „Darf ich ihnen ein Glas Wein anbieten?“
„Gerne. Einen trockenen Rotwein, bitte.“ Tom holte eine Flasche Wein, Gläser und Salzgebäck zum Knabbern.
Sie ließen die Gläser klingen.
„Cheers. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind.“
„Ihre Geschichte hat mich so fasziniert, dass ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Was geschah mit ihrer Schwester Andrea?“
Tom blickte in die Nacht, schloss die Augenlider, öffnete sie wieder und erzählte die folgende Geschichte:
„Wir standen füreinander ein, als Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Kamen wir in Schwierigkeiten, half der eine dem anderen aus der Klemme, wir sprachen über unsere Ängste und Nöte. Bestraften uns die Eltern für unser Verhalten, spendeten wir einander Trost. In der Regel gehorchten wir, erbosten wir Vater oder Mutter gab es Stubenarrest, das wenige Taschengeld kürzten sie. Andrea half mir mit ein paar Groschen aus oder spendierte ein Kaugummi. Wir unterliefen die elterlichen Sanktionen. Schläge gab es nicht, unsere Eltern waren in dieser Beziehung fortschrittlich. Mit Stubenarrest kriegten sie uns klein, für uns die schlimmste Strafe.
Wir liefen ständig draußen rum, in den herrlichen Sommerferien den ganzen Tag. Wir genossen die Freiheit auf dem Land.
In Urlaub fahren konnten unsere Eltern nicht, zwei Wochen, drei Wochen unvorstellbar. In der Schule wussten wir nicht viel zu erzählen über fremde Länder. Andrea berichtete staunend nach dem ersten Schultag, wo die Schulfreundinnen mit ihren Eltern hinreisten: Frankreich, Schweiz, Schwarzwald.
Andere fuhren mit ihren Eltern nach Italien, ein Land unendlich fern.
Wir wollten wissen, wo das lag, und suchten im Atlas nach den Ländern, ahmten die Sprache nach, rieten, was der andere gesagt hatte und welche Landessprache es war. Wir fantasierten rege, da kam ein Kauderwelsch zusammen.
Wörtlich krieg ich das nicht mehr zusammen, gesponnene komische Sätze: „Memeti Pivetti sotto. Was heißt das?“, fragte Andrea. „Dieses Jahr gibt es dicke Kirschen“, narrte ich.
Andrea rief zu meinem Erstaunen: „Richtig! Und wer sagte das?“
„Ein Italiener“, antwortete ich siegesgewiss.
Sie hüpfte in die Luft und rief: „Stimmt nicht!“
Entsetzt fragte ich: „Warum? Das war italienisch.“
„Es sagte kein Italiener, ha, ha.“
Sie sprang vor Freude, klatschte in die Hände. Urplötzlich machte sie eine ernste Miene.
„Es war, es war, es war —.“
„Sag! Sag!“
„Es war eine Italienerin!“ Kissenschlacht.
Wir alberten herum und gackerten so laut, dass die Hühner antworteten.
„Lustig“, sagte Manon, „da denke ich an meine Schüler, unter ihnen gibt es einige alberne Exemplare.“
Tom erzählte weiter.
„Im Fernsehen zeigten sie einen Bericht über das italienische Essen: Ein Herr saß vor einem Teller mit dünnen, riesenlangen Nudeln und kämpfte damit sie zu verzehren. Ein Kellner brachte dem Gast eine Schere. Der Mann mit vollgestopftem Nudelmund, die bis zurück in den Teller ragten, nahm die Schere und schnitt die Nudeln unterhalb des Kinnes ab und der Sprecher sagte: andere Länder, andere Sitten.
Da wollten wir später mal hin, allein schon wegen der Nudeln. Trotz Schulferien ging es zu Hause lebhaft zu, ein paar Kinder liefen immer herum. Wir streunten durch die Wälder, badeten im See, machten eine Grasschlacht und anschließend lagen wir faul rum. Die Regentage verbrachten wir in einer selbst gezimmerten Baumbude mit Nachbarskindern und lasen uns schaurige Geschichten vor, die wir ausmalten, bis wir Gänsehaut bekamen. Das spielte Anfang der Siebziger, ich war zehn und Andrea acht Jahre.
Johannes, der gleichaltrige Nachbar und Klassenkamerad küsste eines Tages Andrea auf den Mund. Andrea gestand mir eines Abends ihre Verfehlung und ich begriff nicht, dass ein Kuss süß schmecken kann. Ausgerechnet von Johannes mit den schlechten Zähnen und dem Pickel auf der Nase. Sie war zum ersten Mal richtig sauer auf mich, ich verstünde ihr verliebt sein nicht. Ja, dieses Empfinden konnte ich nicht verstehen.
„Ach, du hast keine Ahnung“, kreischte sie mich an. „Du hast ja noch nie ein Mädchen geküsst“, ließ ihren Kopf in das Kissen fallen und schaltete das Licht aus. Wir teilten uns ein Zimmer. Hoffentlich bekommt sie kein Kind, dachte ich. Stimmt, ein Mädchen hatte ich bisher nicht geküsst, warum sollte ich? Es ging mir doch gut.
Jeden Tag galt es etliche Abenteuer zu bestehen. Eine Geliebte wäre in allen Belangen hinderlich. Mit einer Ausnahme: eine Piratin wie meine Schwester. Eine die schneller lief als die Jungen, die auf jeden Baum kletterte bis in die höchsten Spitzen, die sich besser versteckte als alle und wütend war wie ein Junge, wenn die versuchten sie zu täuschen.
Dass aus ihr eine elegante, schicke Frau werden sollte, lag jenseits meiner Vorstellungskraft. Die Jahre vergingen. Nach der Schule begann ich eine Lehre zum Mechaniker. Andrea bekam ein eigenes Zimmer auf dem Dachboden. Dort verbarg sie sich tagelang, las gerne Bücher, verschlang alles, was ihr in die Quere kam, sogar den Klassiker Goethe.
Sie war auf einmal ganz anders drauf, nicht mehr die streunende Katze, die es ständig nach draußen zog.
Sie entdeckte andere Welten. Welten, die ihre Vorstellungskraft anregten, geheimnisvolle Welten, die nur in Büchern lebten.
Nach dem Abitur studierte sie Literatur in Frankfurt, zog in eine Studentenbude mit mehreren Frauen. Andrea nicht mehr bei mir zu haben, tat weh, ich war traurig. Stell dir vor: Ihr Bruder, einundzwanzig Jahre jung und betrübt, als seine zwei Jahre jüngere Schwester auszog. In diesem Alter streiten viele Geschwister, sind froh, wenn sie nicht mehr aufeinander hocken. Die Zeit aus dem Nest zu fliegen war gekommen. Meine Piratin setzte mit Elan die Segel und stürzte hinein in das Abenteuer Großstadtleben.“
Manon bemerkte Toms melancholische Miene. Müdigkeit überfiel ihn. „Ich könnte stundenlang zuhören“, sagte sie. „Aber wir beide brauchen etwas Schlaf. Rufen Sie mir bitte ein Taxi.“
„Mache ich. Nur, wann komme ich dazu, alles zu erzählen? Der neue Tag ist angebrochen und ich bin aufgewühlt.“
„Gut“, schlug Manon vor „dann trinken wir einen Espresso.“
„Es ist recht frisch geworden“, sagte Tom, „wir nehmen unsere Gläser mit und setzen uns in die Küche.“
Tom stellte die Espressomaschine an.
„Machen Sie es sich auf einem der Sofas bequem.“
Tom kam mit den kleinen Tassen rüber. „Zucker?“
„Bei Espresso immer.“
Tom rührte mit dem kleinen Löffel den Zucker um, dann erzählte er die Geschichte weiter.
„Andrea arbeitete nach dem Studium in einem großen Verlag in Frankfurt als Lektorin. In Frankfurt lernte sie ihren späteren Mann Daniel kennen und sie heirateten 1989. Zu dieser Zeit waren unsere Eltern tot. Erst starb unsere Mutter, ein Jahr später unser Vater. Daniel, dem Offizier ging es finanziell gut, Andrea ebenso und bald kauften sie ein Eigenheim in Frankfurt. Es lag in einer abgeschiedenen, malerischen Siedlung, mitten in der hektischen Großstadt.
Ich sah meine Schwester selten, erst bei der Hochzeit lernte ich meinen Schwager kennen. Davor pflegte ich meine Vorurteile: Warum heiratet Andrea einen eigensinnigen Typ, einer, der es gewohnt ist Befehle auszuteilen, dessen Leben Disziplin und Gehorsamkeit ist. Sie, die unorthodoxe, spontane Frau. Das passte nicht zusammen. Ich staunte, er war alles andere als ein Stinkefinger, sondern locker, hilfsbereit und unterhaltsam, ein gern gesehener Gast, bei offiziellen Empfängen, auf privaten Partys.
Andrea strahlte vor lauter Glück. Bald kam Jonas zur Welt. Andrea gab ihren Beruf auf. Zwei Jahre später gebar sie Richard. Ihre Ehe, das war eine Bilderbuchehe, zum neidisch werden.
Die Idylle platzte erst, als der Befehl zur Einberufung nach Afghanistan kam.
In diesem Frühjahr zählten Jo und Ricky fünfzehn und dreizehn Jahre, beide gingen aufs Gymnasium. Die Zwei wussten, was es bedeutete in einem Kriegsgebiet den Dienst zu verrichten: Die Möglichkeit bestände, Vater käme in einem Sarg zurück. Ich war viel zu beschäftigt, um mir darüber Gedanken zu machen. Ab und an telefonierte ich mit meiner Schwester, tröstete sie, spielte die Trennung herunter: Nur zwei Jahre und ihr geliebter Mann käme zurück.
Die tapfere Frau managte den Haushalt, unterstützte Jo und Ricky bei den Hausaufgaben, was nicht einfach war und beruhigte die Zwei, es würde alles gut gehen.“
Tom hielt kurz inne, erzählte über die Ereignisse nach Daniels Rückkehr, sein Verhalten gegenüber der Familie.
„Rief ich Andrea an, sagte sie: Endlich ist Daniel wieder da, ich bin so froh. Was sie und die Söhne damals erleiden mussten, erfuhr ich später von den Jungs. Sie belog mich, weil sie wusste, wie ich reagieren würde. Ich hätte mich ins Auto gesetzt und hätte ihn mit einem Knüppel empfangen. Gut, es ist nicht so gekommen, der kranke Mann war selber ein Opfer.
Die Jungs fielen mit ihren Leistungen rapide ab. Unfassbar bei solchen Musterschülern. Der Klassenlehrer verstand das nicht. Er spürte: Etwas stimmte nicht. Daniel gab jede Menge Ausflüchte zum Besten: Keine Zeit, Stress, zurzeit die Jungs vernachlässigt. Ist bald vorbei. Keine ergiebigen Antworten für den Herrn Wolter, der blieb hartnäckig. Er ging tags darauf mit Jo und Ricky zusammen nach Hause. Die Jungs wehrten ab, die Mutter sei nicht da, der Vater auf der Arbeit. Diese Ausreden, die impulsiv rüber kamen, machten Wolter misstrauisch. Sie fanden Andrea reglos auf dem Bett mit einer Fessel an ihrem Fuß. Daniel musste panische Angst gehabt haben, dass seine Frau ihn verlassen könnte. Andrea starb an einem Kardiogenen Schock, ausgelöst durch stressige Erlebnisse. Daniel war schuld an ihrem Tod.“
Tom musste innehalten. Manon standen die Tränen in den Augen.
„Daniel Lohse kam in Verdacht seine Frau umgebracht zu haben, zumal er an diesem Tag nicht in der Kaserne erschien. Die Fahnder der Militärpolizei fanden ihn in einer Kneipe, im Bahnhofsviertel. Er hockte betrunken am Tresen. Die Feldjäger machten kurzen Prozess, führten ihn ab, in die Ausnüchterungszelle der Kaserne, alles Weitere folgte am nächsten Tag.“
Tom verschränkte die Arme hinter seinem Kopf, schaute mit leerem Blick, er brauchte einen Moment um weiter zu sprechen.
„Jo und Ricky heulten mehrere Tage und innerlich weinen sie noch heute. Bei der Obduktion der Leiche fand man keine Merkmale äußerer Gewaltanwendung. Der Staatsanwalt klagte ihn wegen Freiheitsberaubung an. Nach einer ärztlichen Untersuchung sperrten sie ihn in eine Nervenheilanstalt.
Dort ist er auf unbestimmte Zeit eingesperrt — ein Drama. Um die Söhne kümmerte ich mich. Ich war die einzige Person denen die Kinder vertrauten und das Jugendamt bot keine bessere Alternative.
Die nächsten Monate waren mit Mühsal beladen. Jahrelang ging es mir nicht gut, bis — bis ich eines Tages eine mir unbekannte Frau in den Armen hielt, die mich fest umklammerte, als wolle sie mir sagen: Lass mich nicht mehr los. Und ich dachte in diesem Augenblick: Dich lasse ich nie mehr los.“
Manon, die, im Umgang mit Männern, so reservierte, unterkühlte, fast ängstliche Frau, zog Tom an sich heran und küsste ihn.
„Tom.“
„Manon.“