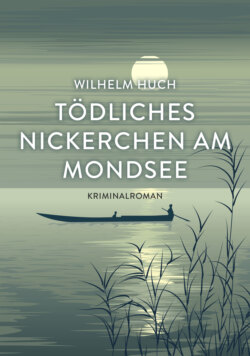Читать книгу Tödliches Nickerchen am Mondsee - Wilhelm Huch - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Nackte Tatsachen
ОглавлениеIch nannte mich Wolfgang W., oder es wäre korrekter zu sagen, meine Eltern hatten mich so genannt, hatten mir diesen Namen aufoktroyiert, auf dass ich fortan mit diesem Namen durch das Leben gehen musste. Wolfgang W., W. wie Oscar Wilde oder Winston Churchill. Es lag aber nicht an meinem Namen, dass mein Leben in der Folge nicht immer so verlief, wie ich mir dies vielleicht erträumt hätte. Denn anfangs hatte ich mir gar nichts erträumt. Ich lebte vielmehr so vor mich hin, verbrachte eine an besonderen Ereignissen sehr karge Kindheit, eine Jugend, deren Höhepunkt ein dritter Platz bei einem Oberklassenfußballturnier gewesen war, und schlitterte über den Umweg eines mir sicher nicht auf den Leib geschneiderten Studiums in meinen jetzigen Beruf eines Autoverkäufers. Eigentlich verkaufe ich eher Träume, denn wenn sich ein Österreicher mit all seinen Ersparnissen einen japanischen Sportwagen kauft, ist damit meist der Traum verbunden, dass sein neues Automobil in Wahrheit ein Porsche sei. Deshalb passieren auch immer so viele Unfälle mit japanischen Sportwagen: Deren Fahrer schließen beim Anblick des Fahrzeugemblems auf dem Lenkrad die Augen und bilden sich ein, sie lenkten das deutsche, für sie leider unerschwingliche Luxusfahrzeug.
Mein Job im Verkaufen von Autoträumen mag zwar helfen, die Träume vieler finanziell nicht so gut situierter Menschen zu verwirklichen – bis eben zu jenem Moment, wo sie auf der Autobahn die Augen schließen und in eine Leitplanke fahren –, mir hilft er lediglich, ein sorgenfreies, aber deshalb nicht unbedingt zufriedenes Leben zu führen. Warum ich vom Stadium der Zufriedenheit trotz einer reizenden Frau und zwei braven Kindern so weit entfernt bin, dürfte auch daran liegen, dass ich Autos im Grunde hasse. Am liebsten gehe ich zu Fuß, manchmal fahre ich auch mit dem Fahrrad. Um ein Auto mache ich außerhalb meines Jobs aber beständig einen großen Bogen. Es ist mir bewusst, dass es absurd klingt, dass ausgerechnet ich Autoverkäufer wurde. Aber man weiß ja, wie das läuft. Man ist zur falschen Zeit am falschen Ort, trifft dort die falschen Leute und schon hat man einen gut bezahlten, aber äußerst widerwärtigen Job. Es kommt immer wieder vor, dass ich auf dem Weg von der Teeküche, wo ich mir ein Glas Wasser hole, in mein Büro denke, ich müsste jetzt das Wasserglas an die Wand schleudern, um meine Frustration und Aggression gegenüber meinen Kollegen und potentiellen Kunden abzubauen. Dass ein Wechsel meines Arbeitsplatzes nur sehr selten in Erwägung gezogen wird, hängt mit meiner schon sprichwörtlichen Beharrlichkeit und jeglichen Änderungen abgeneigten Persönlichkeit zusammen. Wäre ich im antiken Griechenland geboren und hätte dort die Gelegenheit gehabt, mit Heraklit zu sprechen, ich hätte ihn gewiss davon abgehalten, das Leben als einen ständigen Fluss – von Überdrüssigkeiten? – zu brandmarken. Ich hätte alles dafür gegeben, dass es statt „Panta rhei“ „Vita est institio“ hieße oder wie es Heraklit eben auf Altgriechisch ausgedrückt haben würde.
Interessant und für mich im Nachhinein doch verwunderlich an jenem Ereignis, das ich kurz schildern möchte, war, dass es zu keinerlei Ängsten oder Unsicherheiten über die Zukunft führte. Obwohl es immerhin der Paradefall des Panta rhei war und mein stillstandgeprägtes Leben hätte erschüttern müssen, war es mir sehr willkommen, dass man bei einer Routineuntersuchung als sogenannten Zufallsbefund einige nicht sehr hoheitsvoll aussehende Veränderungen in meinem Gehirn und daran anschließend eine kleine Öffnung in meinem Herzen feststellte, die an einem Ort war, an dem sie nichts zu suchen hatte. Die damit verbundenen Krankenhausaufenthalte empfand ich sonderbarerweise als etwas überaus Glückhaftes. Im Besonderen die Möglichkeit, Thomas Manns Zauberberg in eben jener waagrechten Lage zu lesen, die für Castorps Leben offenbar auch die bevorzugtere Daseinsform zu sein schien, erfüllte mich mit einer gewissen Dankbarkeit. Dass ich dem Zustand der Zufriedenheit näher gekommen wäre, möchte ich in diesem Zusammenhang aber nicht behaupten.
Nach der Konfrontation mit dem Befund des ungehörig seit meiner Geburt nicht zugewachsenen Loches schien für mich klar zu sein, dass dieses Loch zu verschließen sei, so dies medizinisch durchführbar war. Da mir dies von vielen Seiten bestätigt wurde, die Folgen eines solchen Eingriffes darüber hinaus als überaus minimal vor Augen geführt wurden, galt mein weiteres Bestreben nur mehr dem Ziel, den Lochverschluss so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. Über Freunde von Bekannten meiner Eltern stellte ich den virtuellen Kontakt zu dem den Eingriff vornehmenden Arzt her, ein persönlicher Termin ging sich vor der Operation nicht mehr aus. So lernte ich Dr. Fabregas nur telefonisch kennen, seine Stimme schien nichts Böses zu verheißen und auch der von ihm vorgeschlagene Termin „11. September“ – oder, wie er zu sagen pflegte, Nine Eleven – hatte für mich nichts Unbehagliches oder gar Abschreckendes an sich. Mir war nur wichtig, dass ich bald unter das Messer kam. Dabei zerstörte Dr. Fabregas aber gleich meine Vorstellungen von einer ernsthaft famosen Herzoperation, indem er erklärte, dass das Messer nur dazu diente, einen kleinen Schnitt zu setzen, um danach ein dünnes Schläuchchen in eine meiner Venen einzuführen, durch das man ein winziges Schirmchen in mein Herz einführen wollte, das dort für die Herstellung des von der Natur grundsätzlich vorgesehenen lochfreien Zustandes meines Herzens sorgen sollte. Wie der Eingriff im Einzelnen vonstattengehen würde, interessierte mich im Grunde nicht. Dennoch konnte ich die Details den seitenlangen Erklärungen, die ich später im Spital zu lesen bekam, entnehmen, um an deren Ende mit meiner Unterschrift auch noch zu bestätigen, dass ich letztlich damit einverstanden wäre, zu sterben, wenn die Operation oder der Eingriff nicht den geplanten und allgemein voraussehbaren Verlauf nehmen sollte.
Als ich einen Tag vor dem 11. September ins Krankenhaus einrückte, traf ich dort Olga Flor, die einen Freund besuchen wollte. Obwohl wir seit den gemeinsamen Schultagen, die auch ein paar gemeinsame Stunden auf einem Skilager und in einem schon seit Jahren der Vergangenheit angehörenden „Lion’s Pub“ einschlossen und gut zwanzig Jahre zurücklagen, kein Wort mehr miteinander gewechselt hatten, entwickelte sich ein angeregtes Gespräch. Gespräch mag vielleicht nicht der treffendste Ausdruck sein, denn tatsächlich erzählte sie mir eine Geschichte nach der anderen, ohne dass ich auch nur einmal zu Wort kam. Ich wusste daher auch nicht, ob sie mir Begebenheiten aus ihrem Leben oder aus einem ihrer bereits geschriebenen oder noch der Niederschrift harrenden Bücher erzählte. Natürlich war ich geschmeichelt, dass sie mich nach all den Jahren überhaupt noch erkannt und eines Wortwechsels für würdig befunden hatte. Schließlich hatte sie es zu etwas gebracht, nicht nur zu einem abgeschlossenen Physikstudium, sondern auch zu drei vollendeten Romanen, einem Platz auf der Longlist für den deutschen Buchpreis 2008 und zu regelmäßiger Erwähnung in den österreichischen Tageszeitungen. Wenn gelegentlich ein japanischer Sportwagen in einen Unfall verwickelt war, dessen Fahrer ein Opfer meiner „Traumverkäufe“ gewesen war, so hielten es die Zeitungen zum Glück nie der Rede wert zu erwähnen, von wem das Unfallauto verkauft worden war.
Ich war unleugbar beglückt, den Erzählungen einer echten Schriftstellerin lauschen zu dürfen, auch wenn der Redeschwall nach einer Weile im gesteigerten Ausmaß ermüdend wurde und ich darob außerdem meinen Termin für die Voruntersuchung versäumte. Sollte meine Operation nicht so erfolgreich verlaufen, wie mir dies Dr. Fabregas in Aussicht gestellt hatte, sondern eher eine solche Wendung nehmen, wie es die von mir unterschriebene Einverständniserklärung für durchaus möglich erscheinen ließ, so würde ich jedenfalls die Erzählungen einer jungen, aufstrebenden Dichterin mit ins Jenseits genommen haben.
Als es schließlich ernst wurde und ich nur mit einem Spitalsnachthemd bekleidet im Vorzimmer zum Operationssaal auf meinem Bett lag, wurde mein Denken von einem einzigen Gedanken geprägt: Was würde geschehen, wenn ich während der Operation plötzlich den Drang verspüren sollte, auf die Toilette zu müssen? Da ich sehr lange warten musste, bis ich endlich in den OP geschoben wurde, schien es nicht so abwegig zu sein, dass das von mir Befürchtete auch tatsächlich eintrat. Dass die Gabe einer hinreichend großen Dosis eines Narkotikums das Entstehen des mir so bedrohlich erscheinenden Dranges allenfalls verhindern würde, kam mir nicht in den Sinn. Auch jetzt würde ich nicht ausschließen, dass die mir damals noch bevorstehende, jetzt schon lange zurückliegende Narkose mein Problem doch nicht gelöst haben würde. Was verwunderlich war: Ich dachte nicht an den Erfolg oder Misserfolg der anstehenden Reparatur meines Herzens, sondern nur an das zuvor Erwähnte. Wahrscheinlich machte dies aber die langsam verrinnenden Minuten im Vorzimmer genauso schwer erträglich wie die in dieser Situation viel näher liegende Angst vor dem als möglich dargestellten Ergebnis der Operation.
Nach einer allenfalls durch technische Gebrechen verursachten und mir als Unendlichkeit erscheinenden Wartezeit schob man mich in den OP, wodurch meine Gedanken naturgemäß etwas abgelenkt waren, die Situation insgesamt sich jedoch leider nicht entspannte. Nun trat das unvermeidliche Ereignis immer näher an mich heran, man beraubte mich meines ohnehin schon sehr dürftigen Nachthemdes und begann, die der Tunnelöffnung für mein Schirmchen entgegenstehenden Schamhaare abzurasieren. Meinem Ersuchen nach ein wenig wärmenden Textilien – den Schwestern und dem später herantretenden Ärzteteam mochte es angesichts der anstehenden Arbeit warm gewesen sein, ich hingegen fror, nicht zuletzt wegen der mir verordneten Bewegungslosigkeit – kam man zwar nach, dennoch fühlte ich mich sehr nackt auf dem OP-Tisch. Und ich war es ja wohl. Dabei verließ mein Bewusstsein im Laufe der nächsten Vorbereitungshandlungen allmählich den Ort des Geschehens, man ließ die Wohltat der Narkose durch eine Leitung in mich fließen, bevor man das berühmte Schirmchen durch das fachgerecht verlegte Kanalrohr in mein Herz einführte. Dr. Fabregas dürfte den OP erst betreten haben, als ich mich schon teilweise in meine Traumwelt verabschiedet hatte. Dunkel tauchte in späteren Jahren sein von einem riesigen Mundschutz verhängtes Gesicht vor meinen Augen auf. Da ich ihn weder davor noch später je persönlich in wachem Zustande getroffen hatte, beruhten meine diesbezüglichen Erinnerungen wohl nur auf der Annahme, dass es Dr. Fabregas gewesen sein musste. Denn anders als bei traditionellen Fahrzeugkontrollen durch die Polizei wies sich Dr. Fabregas mir gegenüber nicht durch einen Lichtbildausweis aus. Selbst wenn er dies getan hätte, wäre ein Vergleich des Ausweisbildes mit der Wirklichkeit durch die Operationsverkleidung des Arztes nur schwer möglich gewesen. Damals hatte ich aber keinen Grund, an seiner Identität zu zweifeln. Auch an seinen Fähigkeiten, die man zuvor schon vielfach gelobt hatte, hatte ich keinen Zweifel. Ich ergab mich ohne erlebnisstarke Gefühle dem da Kommenden und war bloß dadurch peinlich berührt, dass der Gedanke an den plötzlich notwendigen Toilettenbesuch die schönen Geschichten Olga Flors zu überlagern drohte.
Als mein Geist den OP verlassen hatte, wurde ich dadurch entschädigt, dass ich davon träumte, in einem der Spitalsgänge lustzuwandeln. Es war ein beinahe schwereloses Hinweggleiten über den kalten Boden. Mein Blick streifte die Patienten, die in ihren Betten auf den Gängen ihrer weiteren Bearbeitung harrten, und die zwischen ihnen emsig umherschwirrenden Krankenschwestern und Ärzte. Da ich meinen Spaziergang dazu nutzen wollte, ein mir verschriebenes Medikament zu nehmen, vertiefte ich mich in die Lektüre des Beipackzettels. Dieser legte mir nahe, das Medikament, das ein einer Zahnpaste nicht unähnliches Gel war, auf dem Beipackzettel selbst, und zwar entlang des aus zwei Worten bestehenden Namens des Medikamentes aufzutragen. Ich bestrich den Beipackzettel daher mit dem Gel, konnte danach aber die weiteren Anwendungsvorschriften nicht mehr lesen. Ich fragte eine mir entgegenkommende, wohl nicht unattraktive Patientin oder Krankenschwester, wie ich das Medikament nun zu mir nehmen solle. Sie fuhr mit ihren Fingern über den Beipackzettel und wischte das Gel davon ab, sodass es sich auf ihren Fingern befand. Diese steckte sie mir in den Mund. Ich schleckte sie – genussvoll? – ab. Dies wiederholte sich mehrmals, bis das ganze auf dem Beipackzettel befindliche Medikament in meinen Körper eingedrungen war. Ob zu diesem Zeitpunkt das Schirmchen mein Loch im Herzen in der Realität bereits verschlossen hatte, konnte ich nachträglich nicht mehr eruieren.