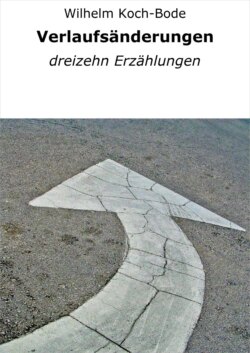Читать книгу Verlaufsänderungen - Wilhelm Koch-Bode - Страница 4
Hinterbliebene
ОглавлениеSchlaff zwischen zwei stämmigen Gestalten hängend, die ihn grob an den Armen gepackt hielten und mit sich schleppten, kämpfte er gegen das ständige Abknicken seines Kopfes an und mühte sich, den Blick auf den Sarg zu fixieren, der unmittelbar vor ihm von sechs kräftigen Frauen in grellroten Trainingsanzügen getragen wurde. Sein ausgezehrter Körper war in einen zu großen schwarzen Anzug gehüllt; aus dem zu weiten weißen Hemdkragen schob sich der dünne, braune Hals, auf dem der knochige, von fahlgelber Haut überspannte und von klebrigen Strähnen bedeckte Schädel pendelte. Angestrengt versuchte er, seine Augen offen zu halten, die tief in blauschwarzen Höhlen lagen und aus denen es gelblich schimmerte, wenn die Augäpfel nach oben wegrollten.
Die beiden Männer an seiner Seite, Brüder seiner Frau, wirkten gereizt und ungeduldig in dem Bemühen, ihn, während sie ihn vorwärts schleiften, so zu halten, dass er nicht aus eigener Kraft gehen musste. Seine Füße schwebten in der Luft, berührten nur alle paar Meter den Boden und hinterließen Spuren im trockenen Sand des Gehweges, denen alle nachfolgenden Gäste des Trauerzuges sorgfältig auswichen. Es schien, als hätte sich spontan eine stille Übereinkunft darüber gebildet, diese flüchtigen Zeichen seines Daseins zu erhalten, - wohl ein verlegenes Zeichen kollektiver Achtung der Trauernden vor dem sterbenskranken Hinterbliebenen, der sich durch niemanden davon abhalten lassen hatte, an der Beerdigung seiner Frau teilzunehmen und sie aufrecht bis ans offene Grab zu begleiten. Er hatte eine lebensbedrohlich entzündete Leber, war völlig geschwächt und lag eigentlich auf der Intensivstation des Zentralhospitals. Mit Schrecken hatten Freunde und Klinikpersonal dem Stöhnen, das aus eingesunkener Hülle kam, entnommen, dass er aufstehen und zum Trauerakt gebracht werden wolle. Zunächst widerstrebend, schließlich aber doch in resignativer Anerkennung eines Bedürfnisses, das für den jungen Mann unzweifelhaft von so grundlegender existenzieller Bedeutung war, dass alle Bedenken dahinter verblassten, hatte der Chefarzt dem gewagten Unterfangen zwar nicht zugestimmt, die Krankenbeförderung zum Friedhof aber letztlich stillschweigend geschehen lassen.
Hilal stammt aus Marokko. Karoline hatte am Strand von Agadir, wo sie - mit üppiger Oberweite, prallem Gesäß, strammen Beinen, sehr weißer Haut und blondiertem, strohigem Kurzhaarschnitt - zweifellos Aufsehen erregt hatte, in ihm den Mann ihres Lebens erkannt, ihn zur Übersiedelung in ihre norddeutsche Heimatstadt bewegt und geheiratet. Die beiden waren ein ungleiches Paar. Hilal: hochgewachsen, schlank, muskulös, scharf konturierte ebenmäßige Gesichtszüge, freundliche dunkle Augen, volles lockiges Haar, hellbraune samtene Haut, tiefe klangvolle Stimme. Zwar ist unklar, was er in Marokko gelernt und gearbeitet hat - es heißt, er habe an der Universität von Rabat irgendetwas Technisches studiert -, aber Hilal scheint gebildet zu sein, ist wissbegierig und kommunikativ, in Gesprächen einfühlsam und im Umgang sehr höflich. Eifrig hat er in kurzer Zeit Deutsch gelernt. Karoline: mittelgroß, trotz gedrungener Figur nicht dickleibig, sondern kraftvoll und wendig - wohl ein Ergebnis ihrer langen Karriere als Leistungssportlerin, später Vereinstrainerin im Handball. Sie hatte ein kantiges Gesicht, blassblaue Augen, eine - nach einem Bruch im Turnier - leicht eingedrückte und schief stehende Nase, einen breiten Mund mit aufgeworfenen Lippen über einer langgezogenen, nach unten in einer vorgewölbten Spitze auslaufenden Kinnpartie. Die in neununddreißig Jahren eingespurten Züge in Karolines Antlitz und die in ihr Körperbild eingeschliffenen Bewegungsmuster ließen bei ihr leicht auf unangenehme Wesenszüge - hart, dominant, aggressiv, unsensibel, geltungsbedürftig zum Beispiel - schließen. Das mochte zwar in dem einen oder anderen Punkt zutreffen, aber sie konnte auch andere Seiten zeigen, für die sie weithin Anerkennung fand: kumpelhafte Freundin, kämpferische Sportlerin, energische Trainerin, durchsetzungsstarke Lehrerin, unternehmungslustiger Typ, großzügige Gastgeberin, einfallsreiche Gespielin, gewerkschaftlich engagierte Kollegin - die Reihe ließe sich unendlich fortsetzen.
Hilal hatte in Deutschland noch keine feste Arbeit. Handwerklich war er recht geschickt, kannte sich mit Autos und Motorrädern aus, reparierte Gebrauchtfahrzeuge, verkaufte diese wieder und machte dabei wohl den einen oder anderen Gewinn. Die beiden lebten hauptsächlich von Karolines Gehalt als Oberstudienrätin an einer Berufsschule, wo sie Sport und Dinge, die irgendwie mit Ernährung und Hauswirtschaft zu tun hatten, unterrichtete. Ihre Familie - der verwitwete Vater und die Brüder mit ihren Ehefrauen - war über diese Partnerwahl verstimmt und lehnte Hilal schroff ab. In Karolines großem Bekanntenkreis wurde er dagegen mit offenen Armen aufgenommen. Mit seinem trockenen Humor, seiner ansteckenden Begeisterungsfähigkeit, seiner warmherzigen, mitfühlenden Aufgeschlossenheit für die Belange anderer, seiner verlässlichen Hilfsbereitschaft bei organisatorischen und technischen Problemen, die zunehmend an ihn herangetragen wurden, hatte er sich bald sehr beliebt gemacht. In der Beziehung zu Karoline legte er - entgegen den Befürchtungen einiger Bekannter - keinerlei herrisches, selbstverliebtes oder ichbezogenes Gebaren an den Tag, sondern zeigte sich voller Fürsorge und füllte die Rolle des emsigen Hausgeistes mit lockerer Hand aus. Die einhellige Meinung war, dass Hilal eine glänzende Perle sei, die Karoline am Saum des Atlantiks aufgelesen habe. In ihrer Welt erhob sich zwar die eine oder andere Stimme, teils hinterrücks lästernd, teils offen und wohlwollend hinterfragend, ob sie diesen Traummann möglicherweise etwas zu heftig herumkommandiere, aber er selbst schien dies nicht so zu empfinden. Um es Karoline recht zu machen, war Hilal kein Handschlag zu viel, kein Weg zu weit, keine Mühe zu schwer, kein Dienst zu gering. Die Hingabe, mit der er diese Frau anhimmelte, war schrankenlos.
Als Karolines Vater, ein wohlhabender Handwerksmeister mit eigenem Betrieb - Heizung und Bäder -, starb, waren die Brüder, die das Familienunternehmen fortführen wollten, gezwungen, ihr aus der Erbmasse 300.000 Euro auszuzahlen. Die Hälfte davon war gleich in den Kauf eines alten Bauernhauses am Stadtrand geflossen, das Karoline und Hilal kurz vor dem Ausbruch seiner Erkrankung bezogen hatten und in dem die beiden begonnen hatten, für sich ein uriges, dabei komfortables und stilvolles Nest zu gestalten. Sie hatten ein paar Antiquitäten, rustikale Eichenschränke und einen Refektoriumstisch, erworben und diese Stücke mit modernen Objekten, zum Beispiel lässigen, mit weißem Nappaleder bezogenen Sitzgruppierungen, zwei, drei innovativen Hightech-Multimedia-Installationen und großformatigen abstrakten Acrylgemälden, auf denen Farbe und Bewegung geradezu explodierten, spannungsreich in Kontrast gebracht.
Nach der Zeremonie am ausgehobenen Grab, bei der Hilal - immer noch in den von seinen Schwagern gebildeten Schraubstock eingezwängt - wohl nur noch körperlich anwesend war, wurde er von zwei Sanitätern übernommen, die ihn auf einer Bahre davontrugen. Hilals Eskortierung hatten Karolines Brüder nur äußerst widerwillig wahrgenommen; da ihm die Position am Kopf der Trauerprozession allerdings nicht streitig gemacht werden konnte, sie ihrerseits aber den nahen Grad ihrer Verwandtschaft mit der Toten betonen und ebenfalls in vorderster Linie mitgehen wollten, konnten sie diese Aufgabe nicht anderen, ihm freundlicher zugetanen Begleitpersonen überlassen - Lehrerkollegen Karolines etwa oder Spielerinnen ihres Vereins, die dies, wenn es denn schon gegen jede Vernunft so sein sollte, gern und hingebungsvoll übernommen hätten.
Wieder im Krankenhaus, in den Tagen nach Karolines Grablegung, waren die engsten Freunde bei ihren Besuchen zwar bemüht, ihn vor der Wahrheit über die näheren Umstände ihres Todes abzuschirmen, aber Hilal hatte doch ein Gespür dafür, dass ihm wesentliche Details vorenthalten wurden. Der aufzehrende Überlebenskampf, die körperliche Hinfälligkeit, die verebbenden Seelenregungen und die medikamentöse Benommenheit vermochten den Schock vielleicht etwas zu dämpfen; er sprach nicht viel, murmelte nur leise immer wieder vor sich hin: warum, warum, wieso. Irgendwann aber, nach Wochen, wurde seine Stimme fester und er begann in die Besucher zu dringen, nun endlich mit Einzelheiten über Karolines Tod aufzuwarten. Marion schließlich, ihre anhänglichste Vertraute, fand, dass die Geheimnistuerei nicht länger aufrechterhalten werden könne. Sie klärte Hilal restlos auf.
Der plötzliche Herztod hatte Karoline in der Duschkabine des Lofts eines Unbekannten in Berlin-Charlottenburg getroffen, eines - wie Marion angedeutet hatte - mutmaßlichen neuen Intimpartners. Diese Person, die einer virtuellen Kontaktbörse entstamme und die Fleischwerdung des Nicknamens Berliner-Bär-XXL darstelle, sei von Karoline übers Wochenende, die unerlässliche Teilnahme an einem Handballturnier vorspiegelnd, besucht worden. Der Typ hatte sogar die Frechheit besessen, zu Karolines Beisetzung anzureisen und einen großen Kranz mit anhängendem Band - Ciao, Linella. In ewiger Liebe und Trauer! Dein Fred - in Auftrag zu geben, der inmitten des prächtigen floralen Arrangements vorgeherrscht und in der Kirche für Aufsehen gesorgt hatte. Noch vor Beginn der Trauerzeremonie war der Störenfried identifiziert und feindselig gemustert worden. Er hatte wohl gehofft, sich in einer der hinteren Reihen bedeckt halten zu können, war aber beobachtet worden war, als er einen Mercedes-Benz der S-Klasse mit dem Kennzeichen der Hauptstadt einparkte: ein Mittfünfziger, dessen dunkelgrauer, seidig glänzender Anzug - zugegebenermaßen - vorteilhaft geschnitten war, denn er lenkte etwas von der Feistigkeit seines Leibes und der Ausdehnung seines Bauches ab. Der Mann hatte ein gerötetes und schweißglänzendes Gesicht, hängende Tränensäcke, ein weiches Doppelkinn, einen gelbgrauen Kinnbart und eine glänzende Halbglatze mit lackschwarzem Resthaar, das pomadisiert zurückgekämmt war und in dünnen Strähnen auf dem von einem allzu engen Hemdkragen eingeschnürten fleischigen Nacken auflag. Auffallend war die Brille in aktueller Nerd-Optik mit extra breiten, dunklen Bügeln. Wellen aufgebrachten, dabei zwanghaft unterdrückten Geraunes waren durch die Reihen gerollt, bis Lothar, der hünenhafte Co-Trainer von Karolines Handballmannschaft, zu einer befreienden Tat ausholte: steht von der Kirchenbank auf, schreitet zum Sarg, senkt den Kopf grüßend in Richtung der Eingebetteten, wendet sich dem Auditorium zu, lässt seinen Blick durch die Reihen schweifen, hebt lässig die linke Hand, spitzt Daumen und Zeigefinger, leckt die Kuppen an, bückt sich, ergreift die Kranzschleife, lüpft sie ganz langsam bis in Kniehöhe an, zieht eine angewiderte Miene, lässt das Band zu Boden gleiten, schüttelt wegwerfend die Hand, wischt sie in Höhe der Gesäßregion seiner grellroten Trainingshose ab, setzt den Handballschuh auf die Schleife, kickt sie unter den Kranz, verbeugt sich vor der Eingesargten, verneigt sich tief vor Hilal, nickt dem Publikum zu, begibt sich zurück auf seinen Platz, reiht sich wieder ein in die Kette der Vereinsmitglieder, die zu Karolines Ehren alle in Sportkleidung erschienen sind. Ein Aufatmen durchfegt das Kircheninnere wie ein heftiger, kurzer Windstoß. Die störende Botschaft: versteckt; die anstößigen Worte: gelöscht; die wahren Hinterbliebenen: unter sich.
Jetzt, nach der Beerdigung, standen Querelen mit Karolines aufgebrachten Brüdern ins Haus, denen die Vorstellung unerträglich war, dass der arbeitslose, dreist in die rechtschaffene und angesehene Familie eingedrungene Fremde am Ende noch erbberechtigt sein und frech vom väterlichen Lebenswerk profitieren könnte. In den rituellen Einklang, der die Trauernden lose zur Schar zusammengefügt hatte und an den sich nach erfolgter Beisetzung noch deren Bewirtung in einer nahen Gaststätte als würdiger Ausklang anschloss, bei der Hilals Abwesenheit allgemein bedauert und die des Charlottenburgers mit Genugtuung bemerkt wurde, hatten sie sich schicklich als Hauptleidtragende eingefügt, vom Wirtshaus aber, zwecks Beratschlagung, wie denn schnellstens der Zugriff auf die Hinterlassenschaft ihrer Schwester zu bewerkstelligen sei, sogleich eine Rechtsanwaltskanzlei aufgesucht. Inzwischen klagten sie auf Herausgabe des väterlichen Erbteils und Karolines sonstigen Nachlass. Zudem standen noch Auseinandersetzungen um das Bauernhaus bevor, bei dem verborgene Schäden, tiefe Risse im Mauerwerk, Absenkungen des Fundamentes und Hausschwamm, sichtbar geworden waren, über die der Verkäufer - offenbar arglistig - hinweggetäuscht hatte. Die geschickt getarnten Baumängel waren Fred, der als Bauunternehmer einen sensiblen Blick dafür hatte, bei seinem ersten Besuch bei Karoline sofort aufgefallen; noch kurz vor ihrem Tod hatte sie daraufhin gegen den Vorbesitzer Klage auf Rücktritt vom Kaufvertrag und Zahlung der entstandenen Kosten angestrengt.
Sterbenskrank, betrogen, getäuscht, verwitwet, verklagt - in dieser Situation erwies sich Marion für Hilal als selbstlose, umsichtige und unermüdlich kämpfende Helferin. Die ledige Frau, von kleiner und hagerer Statur, galt als klug und besonnen. Im Umgang mit anderen wirkte sie eher scheu und spröde und in dieser Befangenheit war die Freundschaft mit Karoline für sie wohl so etwas wie ein Tor zu geselligem Tun, zu Fitness- und Beauty-Themen und zum Mithalten in einem Leben auch außerhalb von Arbeit. Seit vielen Jahren war sie in einer großen Sozietät von Rechtsanwälten, Notaren, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern als Steuerfachwirtin tätig und stand kurz vor der Prüfung zur Steuerberaterin. Ihre Abende und Wochenenden verbrachte sie nun an Hilals Krankenbett, umsorgte ihn, unterhielt ihn, regelte lästige Formalitäten und kümmerte sich um seine finanziellen Angelegenheiten. Freunde und Bekannte fühlten sich bei ihren Krankenbesuchen allerdings bald von Marion ausgebremst, zumal sie stets eilfertig bekundete, dass Hilal dringend der Ruhe und Schonung bedürfe. Einige machten sich daraufhin rar, andere gaben die Kontaktversuche ganz auf; lästernde Bemerkungen machten die Runde, - Marion spiele sich als Hilals Wachhund auf, lasse ihm die Luft zum Atmen nicht, fühle sich als seine Amme, sei zur Glucke mutiert, und so ähnlich ging es weiter.
Nach seiner Entlassung aus der Klinik nahm sie Hilal bei sich auf, war bei Anwalts- und Gerichtsterminen fest an seiner Seite, erlebte mit ihm seine allmähliche Genesung und Wiedererstarkung, erfreute sich mit ihm der triumphalen Siege nach Abschluss der Prozesse - Hilals Bestätigung als Erbe von Dreivierteln dessen, was Karoline hinterlassen hatte, Rückgewähr des Kaufpreises für die marode Immobilie und Schadensersatz - und kam schließlich in den Genuss der Wiederentfaltung des Charmes, der Hilal eigen ist und der ihn so anziehend macht.
Nach einem Jahr heirateten Hilal und Marion. Um die Verbindung zu Karoline für immer aufrechtzuerhalten, legten sie die Trauung bewusst auf ihren Todestag. Abgesehen von Leuten wie dem Berliner mit dem unschicklichen Gebaren und Karolines hyänenartigen Brüdern (die - nebenbei bemerkt - den väterlichen Betrieb binnen weniger Monate völlig heruntergewirtschaftet haben, sodass die Rede vom bevorstehenden Bankrott geht) samt natternhaften Ehefrauen, waren die Gäste der Hochzeitsfeier dieselben wie bei der Trauerfeier. Neu anwesend waren nur Marions Eltern, redliche Rentner vom Lande, die von Hilal sehr angetan sind und ihn herzlich in die kleine Familie aufgenommen haben. Kaufmännisch nüchtern denkend, über ein ausgeprägtes Gespür für Marktchancen verfügend, die unternehmerischen Risiken kühl abwägend, unterstützt Marion Hilal beim Aufbau seines eigenen Betriebes - eines kleinen, nobel eingerichteten Motorrad-Centers mit acht Mitarbeitern, das in Kreisen anspruchsvoller Biker inzwischen als Top-Adresse gilt. Es handelt sich um eine kompetent geführte, leistungsfähige Firma, die sich offenbar auf Erfolgskurs befindet. Marion, gerade einundvierzig, erwartet in Kürze ihr erstes Kind.