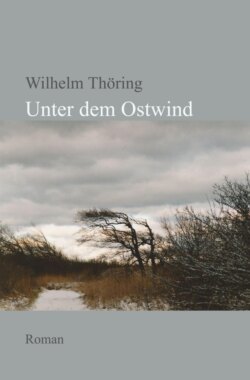Читать книгу Unter dem Ostwind - Wilhelm Thöring - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
ОглавлениеDie letzten Abende standen Jendrik Erdmann und seine Frau Amalie am Sterbebett des Vaters und sangen: „Wenn ich in Todesnöten bin und weiß kein Rat zu finden ...“
Jetzt war es soweit; für den alten Erdmann war die Zeit gekommen. Er starb seit Wochen, und in dieser Zeit war alles, was getan werden musste, erledigt worden. Der Pfarrer war gekommen, und zusammen mit seinen beiden Söhnen, die ihm geblieben sind, und deren Frauen, umringt von der Schar neugieriger, aber auch ängstlicher Enkel, hat der alte Erdmann laut alle seine Sünden bekannt und darauf das Abendmahl empfangen, seine ersehnte, große Erleichterung, wie er sagte.
Am anderen Tag hat er sich mit seinem Sohn besprochen, der mit ihm unter diesem Dach lebte, und mit einer immer schwächer werdenden Stimme hat er seine Anweisungen gegeben und hat versucht zu ordnen, was er nicht mehr ordnen durfte. Danach, als er meinte, es sei nun alles ins Reine gebracht, war er in seinem Bett zusammengesunken, so als hätte ihn jemand mit unerbittlicher Hand in die Kissen gedrückt. Er hat erlöst geseufzt und seinem Sohn ein letztes Mal zugelächelt. Dann hat er die Augen geschlossen und sie nicht wieder geöffnet. Von diesem Tag an konnte es jeder sehen, wie das Leben stetig, unaufhaltsam aus ihm herausfloss. Mit weit nach hinten gebogenem Kopf lag er in seinen Kissen, Kinn und Nase scharf gegen die Deckenbalken gestreckt.
Sein Sterbezimmer haben der Sohn und seine Frau ausgeräumt. Nur das hohe Bett des alten Erdmann stand mitten im Raum wie der Thron eines Herrschers; rings an den Wänden waren Stühle für Besucher aufgestellt worden.
Manchmal kam jemand herein, trat behutsam und leise an sein Bett und war bemüht, die Dielen nicht knarren zu lassen. Man betrachtete still den Sterbenden, beugte sich seufzend über ihn und ging ebenso behutsam zu einem der Stühle, um eine Weile da zu sitzen oder wortlos zu beten.
Wenn die Schwiegertochter zu ihm kam, dann saß sie auf seiner Bettkante und streichelte seine dürren Hände mit den weißen Nägeln und den blauen knotigen Adern.
„Herr Schwiegervater“, flüsterte sie, „mögen Sie einen Schluck trinken? Mögen sie vielleicht ein wenig Brühe? Wir haben extra eine Henne geschlachtet ...“
Aber der alte Erdmann antwortete ihr nicht mehr. Er atmete gleichmäßig und schwach und entfernte sich mit jedem Atemzug immer weiter von ihnen.
Die Schwiegertochter sah ihn jedes Mal gespannt und aufmerksam an. Es sollte ja schon vorgekommen sein, dass ein Sterbender für kurze Zeit in diese Welt zurückgekommen war. Aber der alte Erdmann schien seinen Weg beharrlich zu Ende gehen zu wollen.
Wenn die Schwiegertochter glaubte, lange genug bei ihm gesessen zu haben, dann stand sie still auf und ließ ihn allein. Aber hinter der Tür blieb sie meistens wartend stehen und lauschte, das Ohr am Spalt und eine Hand auf den Mund gedrückt.
Nein, von ihrem Schwiegervater konnte sie nichts mehr erwarten als nur das eine.
In diesem Jahr ist der Frost schon Anfang Oktober gekommen. Schlagartig waren die Temperaturen so stark gefallen, so dass der ganze Holzvorrat, der noch bis Ende November reichen sollte, früher als sonst aufgebraucht worden ist.
Jendrik Erdmann hat sein Fuhrwerk am Rand des Birkenwäldchens stehen. Von hier aus kann er die Straße nach Lodz übersehen, und sein Haus hat er auch im Auge. Manchmal kommt ein Fuhrwerk aus der Richtung von Lodz, aber es ist keine Kutsche, wie sie sein Bruder fährt. Heute wollte er eintreffen, hat er seine Verwandten in Zdunska Wola wissen lassen, denn es läge ihm daran, den Vater noch zu sehen und zu sprechen.
Nein, sein Bruder kommt nicht, und aus seinem Haus kommt auch niemand gelaufen, um ihn zu holen. Bedächtig, wie es seine Art ist, stapelt er die Holzstämme auf seinen Wagen, und jedes Mal, wenn es lauter wird als sonst, will das Pferd anziehen.
Die Unruhe des Pferdes, die auch zu seiner Unruhe geworden ist, lässt ihn ungeduldig mit dem Tier werden. Einmal versetzt er ihm einen solchen Schlag gegen den Bauch, dass es erschreckt in die Höhe geht und nur noch aufgeregter mit den Hufen stampft und an seinem Geschirr zerrt.
Amalie, seine Frau, kann er hinter dem hohen Weidenzaun sehen. Sie hängt Wäsche zum Trocknen darüber, die der Wind bläht und flattern lässt, solange sie noch nicht gefroren ist. Nein, Amalie winkt nicht und gibt ihm auch kein anderes Zeichen. Die Kälte treibt sie gleich wieder ins Haus zurück.
Eine Weile sieht Jendrik Erdmann, die Birkenstämme fest an seine Brust gedrückt, zu dem weißen Lehmhäuschen mit dem tiefen schweren Dach hinüber. Sogar die dichte Reihe gekreuzter Dachlatten kann er von hier erkennen, die wie aufgestellte Borsten auf einem Hunderücken aus dem Stroh herausragen. Flatternd steigt eine dünne Rauchsäule aus dem Schornstein in den frostigen blauen Himmel.
Jendrik liebt dieses Haus. Er liebt es mit allem, was es unter seinem wuchtigen Dach verbirgt. Und jetzt schickt sein Vater sich an, für immer hinauszugehen und es ihm und seiner Frau Amalie zu überlassen, die er vor fünfzehn Jahren, im Jahr achtzehnhunderteinundachtzig geheiratet hat und mit der er sofort nach der Hochzeit unter dieses Dach gezogen ist. Hier sind seine Kinder geboren, wie er selbst in diesem Haus geboren wurde: der dreizehnjährige Berthold, ein Jahr später die Adelheid und zwei Jahre danach die schwächliche Rosa. Auf die Rosa folgte nach gut zehn Monaten der Edmund, zwei Jahre nach ihm die Martha. Vor vier Jahren wurde Natalie geboren und im letzten Frühjahr die Zwillinge Johann und Gotthard. Ja, in seinem Haus ist Leben. Dieses Haus hat es nie anders gekannt, als dass in rascher Folge die Nachkommen es mit Geschrei und Unruhe und auch mit Sorgen füllten und dass sie, wenn ihre Zeit gekommen war, sich unter dem tiefen Strohdach ausstreckten um zu sterben.
Breit und behäbig steht es da, von einem dichten Kranz von Kastanien umstellt, die ihre kahl gewordenen Äste in die Höhe strecken. Es ist nicht immer so breit gewesen, nein. Er hat es nicht nur wachsen sehen, er selbst hat es wachsen lassen, er und Amalie, die seiner Mutter nach und nach die Zügel aus den Händen zu nehmen verstand und schließlich das Regiment in Haus und Garten führte.
Als Siegismund Erdmann, sein Vater, der sich jetzt anschickt Haus und Familie für immer zu verlassen, im Sommer achtzehnhunderteinundfünfzig seine Frau in dieses Haus holte, da soll es noch eine klägliche zugige Hütte gewesen sein, in die sie in manchem Winter die Kuh in die Stube holen mussten, um des Nachts ein wenig Wärme zu haben. Unter diesem Dach waren alle Erdmanns geboren, und unter diesem Dach starben sie auch. Und er selbst wird auch einmal so daliegen wie sein Vater und auf die letzte Stunde warten. Und seine Kinder und Enkel werden sich an seinem Bett versammeln, und sie werden ihn und sich selbst trösten, wie sie es alle vor ihm getan haben. Dieser Gedanke gibt ihm Kraft. Selbst in der Trauer behält man Boden unter den Füßen und wird nicht umgeworfen, wie er es bei den Polenfrauen oft gesehen hat. Die schreien und lamentieren und zerreißen ihre Kleider und wissen sich vor Schmerz und Trauer nicht zu lassen und laufen wie Irre durch die Straßen. Nein, hier vollzieht sich, was sich immer vollzogen hat und vollziehen muss, weil es einen gibt, der diese Ordnung weise beschlossen hat. Und das gibt Kraft und ist Trost.
Als Jendrik den Stapel Holz auf den Wagen lädt, sieht er den Hausierer Jan über das Feld stapfen. Jan geht ganz krumm unter seiner großen Kiepe, die wie etwas Missgestaltetes über seinen Körper hinausragt. Seine unförmige, abgeschabte Ledertasche, in der er seine wenigen privaten Habseligkeiten aufbewahrt, zieht ihn seitwärts gegen die Erde. So lange Jendrik sich erinnern kann, kommt der Hausierer Jan von Zeit zu Zeit durch den Ort, und immer trägt er diese Kiepe und diese Reisetasche, die sie hier Valise nennen, und unter deren Gewicht der Jan mit den Jahren schief und verbogen geworden ist.
In Jendriks Kinderjahren war der Hausierer Jan von einem Geheimnis umgeben gewesen. Später dann bröckelte das auseinander, als er erfuhr, dass der Jan nur ganz alltägliche Dinge wie Wäscheknöpfe, bestimmte Garne und Nadeln, Haarspangen oder Manschetten und Chemisetten in seiner Kiepe hatte. Darüber war Jendrik, wie mancher andere Junge in seinem Alter, enttäuscht, denn es war schön jemanden zu kennen, auf dem ein Geheimnis lag. Enttäuscht rotteten sich Jungen und Mädchen zusammen, sie lachten über den schiefen Jan, sie hänselten ihn oder warfen ihm auch schon einmal faules Obst oder einen Kohlstrunk hinterher. Denn sie hörten, was manche Mutter dem Jan zurief: Mach, dass du weiterkommst, Jan! Was du uns verkaufen willst, das bekommen wir im Kolonialwarenladen billiger. Außerdem können wir wählen und müssen uns nicht mit dem wenigen zufriedengeben, was du uns vorlegst!
Daraufhin war der Jan seltener gekommen. Aber wenn das Wetter für längere Zeit schlecht war, wenn hoher Schnee lag und man nicht in die Stadt fahren konnte, dann war auch der Jan wieder da.
Aber jetzt kommt er über das Feld geradewegs auf Jendrik Erdmann zu, der sich seine Arme und gefrorenen Hände um den Leib schlägt.
Jan ruft etwas, aber Jendrik kann es nicht verstehen. Er sieht es nur an den kondensierenden Stößen seines Atems, und dass sein Kopf ihm die gerufenen Worte mit ruckartigen Bewegungen entgegenschleudert.
„Bist du es, Jendrik? Das Wetter fängt an, verrückt zu spielen!“ ruft der Jan. „Wann haben wir so früh schon einmal solchen Frost gehabt?“
Lachend ruft Jendrik: „Für einen wie dich, Jan, der auf der Straße lebt, könnte es immer Frühjahr oder Sommer sein.“
„Nein“, sagt Jan und streckt ihm seine blaugefrorene Hand hin. „Die Kälte ist gut, sie ist gesund und härtet ab. Leute, die bei Wind und Wetter auf der Straße leben, die bekommen keinen Schnupfen ... Ich bin in Radom gewesen, und da hatten sie schon Schnee. Und das vor vier Wochen!“
„So, so, in Radom warst du. Mit all dem Zeugs da auf dem Buckel?“
„Wo soll ich’s lassen? Du weißt, ich lebe davon! – Man trifft doch immer wieder einmal einen guten Menschen, der einen auf seinem Fuhrwerk mitnimmt.“
Jan hat seine Lasten abgestellt, er haucht in die Hände und klemmt sie unter die Achseln. Auch ohne sein Gepäck steht er krumm und schief, und mit seinem ledernen Gesicht blickt er Jendrik Erdmann von unten herauf aus wässerigen und triefenden Augen an. Von weitem könnte man den Jan für einen jungen Menschen halten, aber wenn er so vor einem steht, dann sieht er alt, dann sieht der Jan uralt aus, beinahe wie ein Fossil oder wie ein urweltlicher Vogel mit seinem schmalen Gesicht und der langen Nase.
Tonlos spricht der Jan gegen die Erde: „Jetzt jagen sie auch da die Juden. Zuerst im Osten, und hier und da auch um Warschau herum ... Es ist wie bei einem schwelenden Feuer, Jendrik. Keiner merkt, wie es sich ausbreitet und das Unheil in jede Ecke trägt. Alle Welt läuft zu den Juden hin und kauft bei ihnen, kauft und kauft und steht hoch in der Kreide, und andere borgen sich Geld bei ihnen ... Ja, und wenn die Schulden zu einem Berg angewachsen sind, dass sie nicht mehr aus noch ein wissen, dann wird gejammert und geschrieen, man nimmt ihnen alles weg und jagt sie davon und schlägt sie am Ende tot ...“
„Man schlägt sie tot? Hast du das gesehen, Jan?“
Der Jan nickt mit seinem schiefen Kopf zu ihm auf, und seine roten, triefenden Augen blinzeln etwas. Jendrik weiß nicht, ob die Kälte Jans Augen glasig werden lässt oder das Mitleid, der Kummer über diese schrecklichen Zeiten. Etwas verlegen fragt der Jan: „Was meinst du, kann deine Frau etwas brauchen? Soll ich zu ihr gehen? Ich habe neue ...“
„Jan, mein Vater stirbt ...“
„Oh“, Jan wischt mit dem Ärmel seine tropfende Nase. Und dann: „So, so, dein Vater stirbt. Jetzt ist er an der Reihe.“
Diese Nachricht macht den Hausierer unsicher, er weiß nicht, wo er hinsehen soll. Er dreht seinen Hals im Kragen, als bekäme er keine Luft, und dann zieht er die Pelzmütze vom Kopf und kratzt seinen kurzhaarigen Schädel, dass es klingt, als schmirgele jemand splitteriges Holz.
Jan sieht wie auch Jendrik nach dem Haus hinüber, das sich unter den Kranz der nackten Kastanien hinduckt, das aus seinem Schornstein zaghafte Zeichen in die Luft schickt: Seht her, hier ist noch Leben.
Der Hausierer Jan lehnt sich gegen das Fuhrwerk. „Weißt du, Jendrik, dass wir beide, dein Vater und ich, einmal in Czestochowa gewesen sind?“ Jan spricht immer wie ein Deutscher, wenn er mit Deutschen spricht, aber jetzt spricht er den Namen dieser Stadt wie ein Pole aus.
„In Tschenstochau? Du und mein Vater? Ist das wahr?“
„Jendrik, da war er noch jung, und ich auch!“ Der Jan lacht und hustet zugleich. „Ich glaube, dich hat es damals noch gar nicht gegeben. Eine Laune von ihm. Er wollte es kennen lernen, mein Leben, meine ich ..., er wollte auch einmal auf der Straße sein, heimlich in Scheunen schlafen oder unter Bäumen, wollte ...“
Jan bricht ab und macht mit der Hand die Bewegung: lassen wir das. Nach einer kurzen Pause sagt er: „Er ist mit mir in Jasna Gora gewesen. Er hat sogar vor der schwarzen, vor unserer wundertätigen Madonna gebetet, ja, ja ... Später hat er mir einmal gestanden, dass es sein größtes Erlebnis gewesen wäre. Ja, er meinte, wir Katholiken hätten es mit unserem Glauben leichter als ihr. Wir haben vieles greifbar, meinte er, haben es fast in den Händen. Ihr braucht bei allem mehr den Kopf, sagte er, den Verstand ... Weißt du, Jendrik, damals hat er als Lutherischer gespürt: Bei ihr, bei der schwarzen Mutter Gottes, ist das Herz Polens, weil die Wundertätige im Herzen eines jeden Polen lebt. Es könnte sein, dass er sie auch gerne im Herzen getragen hätte. Denn der Pole verehrt, er liebt sie, Jendrik, und dein Vater ist durch und durch Pole gewesen. Wir verehren sie, weil sie viele Wunder getan hat, und, Jendrik, sie wird auch das allergrößte Wunder tun, nämlich: dass alle Polen freie Menschen werden, die sich nicht dem Zaren beugen müssen; auch keiner anderen Macht, nicht den Preußen, nicht den Österreichern ...“
Während Jan das erzählte, ist er im Sprechen eifriger geworden, doch ist er wieder leise und unsicher. Er sagt:
„Siehst du, Jendrik, so ist das ... Und jetzt stirbt er ... Barmherzige Mutter Gottes, hilf ihm in seiner schweren Stunde.“ Jan schlägt mit seinen verfrorenen Fingern das Kreuzzeichen.
„Ach, sie geben Zeichen, Jan. Sie rufen mich!“
„Ja, dann musst du gehen“, sagt Jan traurig. „Der Allmächtige sei mit dir ..., mit deiner Familie ... ja, und auch mit ihm! – Warte einen Augenblick.“
Jan kramt unter dem Tuch in seiner Kiepe. „Hier, nimm das für ihn mit. Sag ihm, dass es von mir ist.“
Er drückt Jendrik einen Rosenkranz in die Hand, und eilig behängt er sich wieder mit seinem Gepäck und geht durch das Birkenwäldchen davon.
Jendrik sieht seine Frau über das Feld gelaufen kommen. Manchmal stolpert sie und droht hinzufallen. Sie wirft die Arme in die Luft und ruft immerzu, und endlich kann er sie verstehen. „Jendrik! Jendrik! Er ist tot! Er hat einfach aufgehört zu atmen! Großer Gott!“
Jendrik bindet das Pferd los, und langsam, als hätte er viel Zeit, geht er seiner Frau entgegen.
Die Kutsche seines Bruders, der aus Lodz kommen wollte, die hat er nicht gesehen.
Jetzt haben sie den alten Erdmann begraben.
In der Nacht seines Sterbetages hatte es zu schneien angefangen, und ein unablässiger Ostwind hat den Schnee an den Hauswänden zusammengeblasen und ihn an manchen Stellen bis an die Dachkante zusammengeweht und die Stuben verdunkelt.
Auch das Fenster zu Erdmanns Sterbezimmer ist zugeweht. Seinen Sarg haben sie an den Platz gestellt, an dem zuvor sein Bett gestanden hat. Im Sarg sah der tote Erdmann noch erhabener und abweisender aus, fast drohend mit den zu Fäusten geballten Händen auf der Brust; ihm ist sein guter schwarzer Anzug angezogen worden, und rings um ihn lagen als Schmuck Tannengrün und ein paar bleiche Wachsblumen im Sarg. Am Kopfende ragte ein leeres Kreuz gegen die Zimmerdecke, und an den Seiten brennen Kerzen; ihr Licht spiegelte sich auf seinem Gesicht. Der Tote erweckte den Eindruck, als grinse er hämisch vor sich hin oder als errege etwas seinen Unwillen. Die Nachbarn, die an seinen Sarg traten, schien der Tote weit zurückzuweisen. Niemand verweilte über die geziemende Zeit. Sie blieben verschreckt und ängstlich an den Wänden stehen und drängten nach kurzer Zeit zur Tür hinaus.
Selbst dem Pfarrer schien nicht wohl zu sein, den erhabenen toten Erdmann bei der Trauerfeier im Rücken zu haben. Den Leuten kam es vor, als habe der Tote seinen Kopf gleichsam lauschend erhoben und das Kinn auf die Brust gepresst, und er ertrug es, dass die Trauergemeinde in der Stube und draußen im Flur laut und falsch und viel schneller sang, als es bei einer solchen Feier schicklich war.
Erleichtert sahen die Menschen nach der Trauerfeier zu, wie der Sarg zugenagelt wurde und der Tote unter dem Sargdeckel verschwand. Die Hammerschläge dröhnten bis in den Hof, verkündeten es bis in den abgelegensten Winkel von Erdmanns Haus: jetzt ist dieses Letzte auch getan, niemand muss sich mehr vor dem Anblick des Toten fürchten!
Schweigend wurde Siegismund Erdmann aus seinem Haus getragen, und schweigend geleiteten sie ihn, der nicht erst als Toter, sondern schon zu Lebzeiten einen wunderlichen Respekt genossen hatte, auf den Friedhof, wo neben dem Grab seiner Frau sein eigenes auf ihn wartete.
Nachdem der Pfarrer das seine getan hatte, umstand seine große Familie in einem weiten Kreis das Grab und sah zu, wie die Männer hastig, unter den Pelzmützen mit roten und verschwitzten Gesichtern, Erdmanns Grab zuschaufelten. Und als sich nach kurzer Zeit der Hügel über die Stelle wölbte, wo man ihn eben in die Erde gesenkt hatte, fühlten sich alle wie von einer drückenden Last befreit. Die Erwachsenen wurden auf dem Heimweg gesprächig, und neben ihnen stapften immer noch niedergeschlagen und nichts begreifend die Kinder. Alle hatten es eilig, ins Warme zu kommen.
Amalie hat mit zwei Nachbarinnen die große Stube für die Leichenfeier ausgeräumt. Jendrik meinte, man könne sich auch in der Stube versammeln, in der der Vater gestorben sei, denn sie wäre schon lange leergeräumt.
„Wo sein Sarg gestanden hat?“ hat sie ungläubig gefragt. „Da sollen wir essen? Ja, glaubst du denn, dass einer da hineingehen wird? Nein, wir räumen die große Stube aus!“
Jetzt sitzen sie in der großen Stube und können es vor Hitze kaum aushalten.
„Können wir nicht ein Fenster aufmachen?“ fragt Jendrik.
„Ich habe sie doch schon alle abgedichtet!“ ruft Amalie. „Siehst du das nicht?“
„Dann die Tür“, schlägt jemand vor.
„Soll uns der Schnee ins Haus wehen?“ gibt Amalie zu bedenken.
Gleich nach dem Leichenschmaus sind die entfernten Verwandten aufgebrochen, die mit dem Fuhrwerk gekommen sind. „Bei dem Wetter ... Man weiß ja nicht ...“ entschuldigen sie sich.
Später meint Jendrik: „Es ist die Hitze, die sie vertrieben hat. Hier drinnen ist es heiß wie in der Schmiede.“
„Einmal ist es zu kalt, ein andermal zu heiß“, mault Amalie, die mit unordentlichem Haar und roten Flecken im Gesicht das Geschirr einsammelte.
Es ist später Nachmittag geworden; an dem langen Tisch sitzen nur noch die beiden Erdmannsöhne, Jendrik und Stanislaus, mit ihren Frauen und Kindern, und auf der Ofenbank hocken zwei Nachbarinnen, dick und unbeweglich; sie sehen in ihren schwarzen Tüchern wie aufgeplusterte Krähen aus und warten darauf, Amalie beim Einräumen der großen Stube behilflich sein zu können.
„Ihr könnt gehen, wartet nicht“, sagt die Hausfrau. „Das, was zu tun ist, machen mein Mann und ich, wenn die Verwandtschaft aufgebrochen ist. Ihr habt zu Hause sicherlich noch genug zu tun.“
Die beiden Krähen tuscheln, dann stehen sie schwerfällig, beinahe widerwillig, auf und verlassen die große Stube.
Jendrik und Stanislaus sitzen weit weg vom Ofen, einander gegenüber. Wer die Brüder so sieht, könnte glauben, es seien zwei ungleichartige Parteien, die durch Reichtum und Armut, die durch Abneigung getrennt werden. Sie haben etwas getrunken, der Wodka hat sie rot gemacht und manchmal auch laut dazu. Es scheint, als liege etwas in der Luft; hin und wieder sehen die Brüder Jendrik und Stanislaus Erdmann sich kurz an, als müsse etwas gesagt werden, das unangenehm ist und die Lage verschärfen kann. Ihnen fehlt der Mut, über das Eigentliche, über die Aufteilung des väterlichen Erbes zu sprechen. So erzählt jeder von seiner Arbeit. Jendrik, der Jüngere, von seinen Feldern und seiner Webware und wie er bemüht ist, seinen Teil der väterliche Hinterlassenschaft zu einem ansehnlichen Anwesen zu machen. Stanislaus, der Ältere, spricht von seinen Geschäften und von seinem Ärger mit den Arbeitern in seiner Lodzer Tuchfabrik. Und dass die Leute sich zu Bünden zusammenschließen und ihm das Leben mit unerhörten Forderungen versauern. Von expansiven Plänen erzählt er, von Transaktionen und auch von den vielfältigen Sorgen, die einen Mann seines Standes täglich heimsuchen. Da brauche man schon hin und wieder ein wenig Ablenkung, ein kleines, ein harmloses Vergnügen, das einen die Lebensschwere vergessen lässt. Er denke zum Beispiel an die Jagd. Ein paar Enten, Karnickel, vielleicht einmal ein Rehbock oder ein Wildschwein ... Das reiche ihm durchaus. Aufregender sei es aber, wenn es heißt: in einem Wald ganz in der Nähe ist ein Bär gesehen worden, „ ...und wenn du dich aufmachst, um ihn zu erlegen, dann hörst du: der Bär? Ja, ja, den hat’s gegeben, aber der ist schon im vergangenen Jahr hier durchgezogen!“
Kopfzerbrechen bereite ihm auch die Reitbahn, die er bei dem Gut seiner Schwiegereltern anlegen lassen möchte. Und dann dränge seine Frau darauf, dieses oder jenes zu bekommen. „ ...Du kennst sie nicht, Bruder ... den Kopf voller Kapricen ...“ raunt er über den Tisch, wobei er heimlich zu ihr hinüberfeixt. „Das gehört wohl zum Adel dazu.“
Seine Frau Antonya Erdmann, eine geborene Gräfin von Zlotczinska, die aus der Gegend von Zambrow stammt, sitzt für sich allein, als wollte sie in der engen Stube von niemandem berührt werden. Ob diese Abgrenzung von ihr gewollt ist oder nicht, das weiß keiner, nicht einmal sie selbst weiß es. Da sie aber von nicht geringer Herkunft ist, meint die Verwandtschaft, und die Nachbarn meinen das auch, sie sei hochnäsig und auf Besonderheiten bedacht.
Steif und unnatürlich gerade, schweigsam, sitzt Antonya die ganze Zeit auf ihrem Stuhl. Ihr kommt es nicht in den Sinn, der Schwägerin zu helfen, die daran gegangen ist, wieder die alte Ordnung in der Stube herzustellen.
„Amalie, setz dich zu uns“, bittet Jendrik. „Das alles können wir später machen ...“
Amalie hat nichts gehört; in einem fort schleppt sie Bänke und Stühle, Böcke und Bohlen, die als Tische dienten, aus der Stube.
Antonya fragt: „Habt ihr kein Mädchen, die das machen kann? Schwägerin, warum rackerst du dich mit dem schweren Zeug ab?“
„Für so etwas haben wir kein Mädchen!“ antwortet Amalie.
Antonyas Blick geht zu den beiden Brüdern, irgendetwas an den beiden lässt sie ungeduldig werden.
„Ist es nicht Zeit, dass ihr endlich zur Sache kommt?“ fragt sie gereizt.
Ihr Mann winkt ab. „Später, später ...“
Seitdem der Vater sich zum Sterben hingelegt hatte, haben auch die beiden Brüder wieder zueinander gefunden. Zaghafte, vorsichtige Gespräche haben eine Barriere abgebaut, die beide mit den Jahren für immer unüberwindlicher hielten.
Seit der Zeit, als sie sich verheiratet haben, lebten sie wie Fremde. Der ältere mit Erfolg, mit Ansehen und Wohlstand in der Stadt, der jüngere als Bauer und Weber auf dem Lande in einem Haus, das sich zwar zusehends vergrößerte, das aber bis heute ein aus Lehm gebautes Bauernhaus geblieben ist.
Plötzlich zieht Antonya ihre Uhr hervor, die sie an einer langen Kette unter ihrem Kleid trägt. Das Deckelchen klappt auf und sie tippt mit spitzem Finger gegen das Glas; sie hält ihrem Mann das Ührchen hin und mahnt: „Stani!“
Wieder winkt ihr Mann ab: „Einen Augenblick noch.“
Antonya versteckt das Ührchen wieder in ihrem Ausschnitt. Sie sitzt noch steifer auf ihrem Stuhl, wie auf dem Sprung.
Amalie Erdmann hat alles, was nicht in diese Stube gehört, hinausgeschafft; sie taucht mit Melkeimern in der Tür auf. Ihr Gesicht, das Schultertuch, das sie sich über den Kopf gezogen hatte, glänzt von Nässe.
„Nein, was da an Schnee herunter kommt!“ ruft sie. „Und mir ist, als würde der Frost auch zunehmen ...“
Was die Schwägerin über das Wetter sagt, kommt der Antonya gelegen. Sie erhebt sich mit den Worten: „Dann müssen wir aber fahren!“ Sie winkt den Kindern, hüllt sie in ihre Pelze.
„Ja, wenn es so ist ...“, meint ihr Mann und bricht nun endlich auf.
„Stani, und ihr habt nicht über das väterliche Erbe gesprochen!“ sagt sie mit leisem Vorwurf über die Schulter. „So etwas verträgt keinen Aufschub, es drängt nach Klarheit! Vor allem für ihn.“ Sie nickt zu Jendrik hin.
Amalie verschwindet wieder nach nebenan an ihre Arbeit, und ihr Mann sagt kleinlaut gegen den Tischplatte: „Gesprochen werden muss ... das ist wahr ...“
Stanislaus stellt sich hinter seinen Bruder, er legt ihm beide Hände auf die Schultern und flüstert mit ihm, worauf Jendrik wie erleichtert nickt.
Endlich zieht Stanislaus Mantel und Handschuh an und stellt hier in der Wohnung schon den Pelzkragen hoch. „Wir werden das in Lodz besprechen. Bald, bald…“
„In Lodz?“ fragt Amalie aus dem Nebenraum. „Jendrik, willst du bei diesem Wetter nach Lodz fahren?“
„Nicht nur er – ihr alle!“ ruft der Schwager vergnügt. „Mit Kind und Kegel!“
Antonya ist irritiert, macht den Mund auf, als wollte sie etwas sagen. Von Amalie ist ein erstaunter Ausruf zu hören.
Wenig später sitzen Stanislaus und Antonya mit den Kindern in der Kutsche, alle in dicke Pelze gepackt, unter den Stiefeln die heißen Steine, die die ganze Zeit auf dem Herd gelegen haben, und durch dichtes Schneegestöber fahren sie ostwärts nach Lodz.
Für die Erdmanns hat es nie einen anderen Ort gegeben, zudem sie sich gehörig fühlten, als dieses aufstrebende Städtchen in Polen, in dem sie mit vielen anderen Deutschen seit Menschengedenken leben, und die sie ihre Heimat nannten, weil hier ihre Nachkommen geboren und weil sie hier starben und begraben wurden.
Seit jeher spricht man Polnisch und man spricht Deutsch. Das Russische, das als offizielle Sprache vom Zaren für diesen Bereich verfügt worden ist, das vermeiden und missachten sie ebenso wie die Polen. Russisch spricht man nur, wenn es nicht zu umgehen ist und wenn es klugerweise geboten scheint. Doch gibt es bei fast allen Deutschen hier eine auffällige Besonderheit in der Sprache: hier sprechen sie eine Mundart, wie man sie im Schlesischen hören kann, anderswo klingen andere Dialekte durch. Viele Bräuche, die ihnen teuer sind und die sie pflegen, trifft man auch bei den Polen an. Niemand kann sagen, wo sie ihre Wurzeln haben, ob im Polnischen oder im Deutschen. Es sind ihre Bräuche, die sie von der Generation vor ihnen und diese wiederum von der vorigen Generation übernommen haben. Und das ist richtig so und gut. Darin sind sich nicht nur die Erdmanns, darin sind sich alle Deutschen einig: so, wie wir es übernommen haben, so soll es weitergehen und bleiben, weil es sich bewährt hat und weil es Heimat schafft.
Allen seinen Kindern hat der tote Siegismund polnische Namen gegeben, sehr zum Ärger seiner Frau, die darauf bestand, eine deutsche Familie bleiben zu wollen. Alles Polnische lehnte sie ab, die Sprache ebenso wie polnische Namen bei Deutschstämmigen; und jedes Mal, wenn eins ihrer Kinder starb, dann hielt sie das für eine Strafe des Himmels, weil sie ihre Herkunft verleugneten. Nachdem sie die fünf älteren Kinder begraben hatte, wartete sie darauf, dass ihr auch die beiden letzten, Stanislaw und Jendrik, genommen werden als Strafe dafür, dass sie das Deutsche verraten habe.
Nicht nur im Brauchtum hat es Vermischungen gegeben, zu Vermischungen ist es gekommen, weil sich die Menschen vermischt haben. Das wissen sie und darauf verweisen sie, wenn die Kinder dieses oder jenes erklärt haben wollen.
Erdmanns kleiner, aber wachsender Wohlstand hat Neider im Ort, doch niemand kann ihnen etwas nachsagen. Sie waren immer rechtschaffen, waren ehrlich und verlässlich, sie waren fromm – und dennoch waren sie manchem ein Dorn im Auge.
Es wurde über sie Folgendes erzählt, und Erdmanns wussten davon, sie sagten aber nichts mehr dazu, und sie widersprachen nicht: Man erzählte sich die Geschichte von einem Arnulf, der im Sommer des Jahres achtzehnhundertvierundvierzig, als die Hungerrevolution aus friedlichen und wortkargen schlesischen Webern Rebellen werden ließ, sich zu ihrem Anführer aufgeschwungen hat. Sengend und mordend fegten sie durch die Dörfer des Eulengebirges und schrieen nach Gerechtigkeit. Keiner sei fürchterlicher und gnadenloser gewesen, als jener Arnulf, so dass auf seine Ergreifung ein Kopfpreis ausgesetzt wurde. Preußische Truppen kamen und suchten nach ihm, um ihn für seine und die Verbrechen der anderen zur Rechenschaft zu ziehen.
Wie konnte dieser Arnulf seinen Kopf aus der Schlinge ziehen? Indem er floh. Durch Polen war er bis an den Bug gezogen und hielt sich in einem unbekannten Nest versteckt. Nach einigen Jahren, als Gras über seine Sache gewachsen war, ist er nach Zdunska Wola gezogen; hier hat er ein Fleckchen Land erworben, hat eine Hütte gebaut, in die ein Webstuhl passte, hat geheiratet, ist wohl auch anständig geworden und hat unter den hier ansässigen Deutschen das Geschlecht der Erdmanns begründet.
Dem verstorbenen Siegismund ist es vor vielen Jahren in den Kopf gekommen, die Sache auf einer Gemeindeversammlung richtig zu stellen: nicht auf den Rebellen Arnulf gehe ihr polnisches Geschlecht zurück – nein, ihr Geschlecht sei viel älter! Ihre Wurzeln liegen wahrscheinlich noch vor der Zeit des Großen Peter und der Katharina. Den Arnulf hätten die Alten noch kennen und von ihm erzählen können. Das mit dem Arnulf, so argumentierte er, liege erst einmal gut fünfzig Jahre zurück. Ist nicht er, der Weber Siegismund Erdmann, schon im Jahre achtzehnhundertachtundzwanzig in dieser Stadt geboren worden?
Wie kann der Rebell Arnulf dann Ahnherr der Erdmanns in dieser Stadt sein, frage er jene, die mit solchem Blödsinn eine anständige Familie zu beschädigen suchen?
Zudem sei alles in den Kirchenbüchern nachzulesen. Man brauche nur den Pfarrer zu bitten, der werde jeden, der der Sache auf den Grund gehen möchte, aufklären können.
Im Jahr nach dem Tod von Siegismund Erdmann dachte Jendrik daran, die Geschichte seiner Familie zu ergründen, um die Wahrheit seinen Kindern einmal erzählen zu können. Vielleicht wird sogar eins von ihnen sie aufschreiben! Wer kann das sagen?
Davon könnte, wenn es interessiert, später erzählt werden.
Es ging auf Weihnachten zu. Bei den Leuten, die Vieh im Stall stehen haben, wurde geschlachtet. An den Hauswänden lehnten die Leitern mit den kopfüber hängenden, aufgeschlitzten Schweinen, die von Kindern während des Auskühlens bewacht wurden. Blutleer und weiß wie ein Bettlaken hingen sie, und mancher Nachbar, der sie hängen sah, beschloss bei sich, diesem Haus gegen Abend einen Besuch abzustatten.
Auch Jendrik hat den Schlächter kommen lassen. Er wollte es nicht so machen wie die Nachbarn, die mit einem Beil auf das Schwein losgingen und dessen durch Mark und Bein dringendes Quieken oft lange und meilenweit zu hören war. Bei ihm ging die Tötung leise und rasch vonstatten. Und dass die Kinder dabei zusahen, das duldeten er und sein Frau nicht. „Bei so etwas gehören Kinder ins Haus“, hat Amalie gesagt. „Besser noch, sie gehen weg!“ Und darin gab er ihr Recht.
„Wenn die blutige Arbeit getan ist, wenn das Fleisch nicht mehr als Schwein zu erkennen ist, ja, dann mögen sie kommen und helfen“, sagte sie. „Ich leide es auch nicht, wenn sie das aufgeschlagene Schwein bewachen.“
Beim Wursten, beim Zerlegen und Einpökeln haben sie zusehen und auch helfen dürfen, wenn sie helfen konnten.
Oder sie haben das Feuer gehütet und Wasser gekocht und in den riesigen Töpfen gerührt. Den leergedrückten Darm ließ Amalie sie reinigen, auch beim Abbinden der Würste durften sie helfen.
Am Abend wurde jedes mit einer kleinen Wurst belohnt, die es ohne Brot essen durfte. Wie freuten sie sich erst auf Weihnachten! Denn dann kamen alle diese Herrlichkeiten auf den Tisch.
„Solange müsst ihr warten“, sagte die Mutter. „Vorher gibt’s nichts!“
Die Wolken hängen den ganzen Tag über tief und voller Schnee; in der zurückliegenden Woche mussten sie jeden Morgen Tür und Fenster freischaufeln und in die Kamine sehen, weil es vorgekommen war, dass sie vollgestopft waren und nicht zogen.
Amalie Erdmann erneuert die Tannenzweige in den Stuben, sie liebt es, auch zwischen den Doppelfenstern Tannengrün zu haben. Die größeren Kinder helfen ihr, und die kleinen stehen da und staunen und quälen sie mit ihren unzähligen Fragen.
„Nein“, sagt sie schon müde geworden. „Den Baum holt der Vater aus dem Wald. Aber die Äpfel und silbernen Nüsse, die hängt das Christkind daran. Aber nur, wenn ihr bis dahin brav seid und eure Mutter nicht immerzu mit tausend Fragen drangsaliert!“
Jendrik Erdmann kommt in die Stube. Er geht auf Strümpfen, seine Stiefel hat er vor der Haustür ausgezogen; schweigend wärmt er seine Hände an der Ofenwand. Schließlich sagt er, und es klingt, als spräche er mit sich selbst: „Ich sollte in Vaters Stube noch drei Webstühle stellen. Wenn ich die Ostwand zum Stall hin abbreche und sie um ein paar Fuß versetze ...“
Die Frau sieht auf. „Vaters Stube?“ Sie erhebt sich schwerfällig und stöhnt leise, und als sie vor ihm steht, stemmte sie beide Arme in ihren Rücken; der Mann beachtet das nicht; ihm war es nie aufgefallen, wenn diese Art von Schwerfälligkeit ihr zu schaffen machte.
„Er liegt noch nicht lange unter der Erde, und da willst du aus seiner Stube so etwas machen? Sie mit Webstühlen vollstellen?“
Er lacht sie listig an: „Mein Bruder vergrößert, hast du es nicht gehört? Und wir, Malchen, vergrößern auch! Natürlich in einem anderen Maßstab und in einer anderen Weise als er es macht.“
„Wo willst du das Geld für die Webstühle hernehmen?“
Er gibt ihr keine Antwort darauf. In Gedanken ist er weiter, und er sagt zu ihr: „Dann nehme ich noch zwei oder drei Leute in den Dienst.“
„Auch das noch! Weißt du, was das kostet?“ Was soll sie weiter dazu sagen? Ja, das kennt sie. Was Jendrik sich einmal in den Kopf gesetzt hat, das führt er auch aus. Anfangs hat sie ihm widersprochen, wenn sie nicht überzeugt war, hat sich gegen solche Pläne gewehrt. Nach ihrem Dafürhalten war manches zum Scheitern verurteilt. Und doch gelang ihm, was er plante.
Weil er am Ende recht behielt, darum schweigt sie jetzt und wendet sich wieder ihrer Arbeit und den Kindern zu.
Abwartend steht der Mann eine Weile in der Tür, dann geht er nach draußen an seine Arbeit.
Alle Unebenheiten und Vertiefungen im Feld hat der Wind mit Schnee zugeblasen. Es ist bitterkalt geworden, und die Fensterscheiben bleiben auch am Tage zugefroren. Obwohl die Pumpen und Brunnen rechtzeitig mit Stroh und Säcken umwickelt und abgedeckt wurden, geben sie kein Wasser mehr; vor einem solchen Frost sind sie nicht zu schützen. Die Menschen gehen so dick eingepackt, dass sie sich auf der Straße kaum erkennen. In entlegenen Dörfern, so erzählte man sich, seien Wölfe gesehen worden, und es habe schon die ersten Erfrierungstoten gegeben, alte Menschen vor allem, die sich beim Holzsammeln einen Moment ausruhen mussten und die auf ihrem Platz eingeschlafen und erfroren seien.
Der Himmel ist hoch und unnatürlich blau. Nur an wenigen Stellen zeigen sich ein paar hingewehte Wolken, die wie gefegter Schnee auf einer Eisfläche aussehen. Die Sonne steht kalt und bedrohlich hinter dem Wald, der jetzt schon lange Schatten über die verschneiten Felder wirft.
Heute geht Jendrik Erdmann seinen Weihnachtsbaum schlagen, und der dreizehnjährige Berthold, die ein Jahre jüngere Adelheid und der zehnjährige Edmund dürfen den Vater begleiten. Die Kinder schweigen, weil der Vater sie geheißen hat, still zu sein. Der scharfe Frost, hat er gedroht, schneide ihnen weit hinten im Hals die Adern durch, so dass Blut aus Mund und Nase fließt. Und außerdem würde der Luchs sie hören, und der Luchs, so ist dieses Tier, springt von seinem Baum herunter und wird versuchen, sie wegzuschleppen. Das wirkt. Wenn sie nicht schon so weit im Feld wären, dann würden die Kinder sofort kehrtmachen. Jetzt müssen sie weitergehen, und darum halten sie sich so dicht hinter dem Vater, dass sie ihm hin und wieder in die Hacken treten. Manchmal bleibt der Vater stehen, um ihnen Spuren im Schnee zu zeigen, Spuren von Kaninchen, von Fasanen und einmal sogar eine vom Fuchs und von einer Wildkatze. Zielstrebig drängt sich der Vater in eine Schonung zu seinem Baum, wie er sagt. Es ist ein Baum, der merkwürdigerweise keinen Schnee mehr trägt und der wie ein Fremdling, dunkel und auffällig, unter den anderen steht. Auf den hat es der Vater abgesehen, den schlägt er.
Als sie später den Ort erreichen, ist die Sonne schon lange untergegangen und der Abendstern steht einsam an seinem Platz.
Am Heiligabend schneit es ohne Ende.
Vom frühen Morgen an ist Amalie Erdmann damit beschäftigt, das Haus zu putzen und alle die Dinge vorzubereiten, die zum Weihnachtsfest gehören und die getan werden müssen. Und diesmal fällt es ihr besonders schwer; in ihrem Leib ist seit langem ein kleiner Schmerz, ein völlig unbedeutender Schmerz zuerst, der aber von Woche zu Woche gewachsen ist und der sich nach und nach bis in die äußersten Glieder ausgebreitet hat.
Die kleinen Kinder sind ihr lästig heute, und gegen ihren Willen herrscht sie sie an und scheucht sie von einem Winkel in den anderen; heute wird sie sie zeitig ins Bett schicken. Das Gequengel ist ihr unerträglich, sie mag es nicht hören, warum sollen die Quälgeister bis zur Mitternachtsmette aufbleiben dürfen?
Die Mitternachtsmette – wie gerne ist sie alle Jahre zuvor in diesen Gottesdienst gegangen. Heute würde sie viel lieber zu Hause bleiben. Bestimmt wird sie in der Kirche einschlafen, denn sie ist so müde, dass sie sich kaum auf den Beinen halten kann.
Später Abend ist es geworden, als sie die Arbeiten endlich beendet hat. Amalie streut zuletzt noch weißen Sand in die Stube und verbrennt ein paar Tannenzweige im Herd. Das ganze Haus soll von weihnachtlichem Duft durchzogen werden. Das muss sein, sagt sie sich, das gehört dazu. Auch wenn Jendrik meint, es rieche wie in katholischen Kirchen, sie geht sogar mit glimmenden Zweigen von einer Stube in die andere.
Als das getan ist, wäscht sie sich über der Schüssel und setzt sich auf die Ofenbank, um sich vor dem Kirchgang ein wenig auszuruhen.
Von weither strömen die Menschen zum mitternächtlichen Gottesdienst in die Stadt. Die Vornehmen und Reichen kommen mit ihren Kutschen oder Schlitten und füllen den Platz vor der Kirche. Sogar in den angrenzenden Straßen stehen ihre Gefährte, und die dampfenden Leiber der Pferde täuschen Wärme und Behaglichkeit vor.
An einigen Stellen des Platzes brennen Feuer in eisernen Behältern, die von Kutschern und Knechten umlagert sind, wo sie ihre Füße warm stampfen und die Wodkaflasche kreisen lassen und wo sie über ihre Herrschaft herziehen und sich auch schon einmal streiten. Manchmal kommt jemand aus der Kirche, und wenn die Tür sich öffnet, flutet ein Schwall von Licht in die Nacht, der für einen Augenblick alle Straßengeräusche verstummen lässt.
Sie singen: „Lobt Gott, ihr Christen allzugleich in seinem höchsten Thron.“
Über den Kutschern und Knechten an ihren Feuern, über den ergeben wartenden Pferden, brausen die Glocken und wetteifern mit der singenden Gemeinde. Alle sollen es wissen, sie sollen den Jubel draußen auf den Straßen und hinter ihren Wänden hören: dass der Dienst vor dem Herrn getan ist und das Fest hat begonnen.
Diesem rauschenden Jubel aus Hunderten von Kehlen, dem unrhythmischen Takt der vier Glocken können sich auch die Fuhrknechte nicht entziehen. Trotz der grimmigen Kälte ziehen sie ihre Pelzmützen vom Schädel und singen mit, so gut sie es können. Es sind solche darunter, die durch das Singen und das Glockengetöse, und vor allem durch Erinnerungen, angerührt werden und feuchte Augen bekommen.
Die Kirche leert sich nur langsam. Jeder will die für das Fest erforderlichen Oblaten haben, die in der Sakristei oder an der Kirchentür gekauft werden können und die zu Hause vor dem Weihnachtsessen untereinander geteilt werden. Darauf umarmen und küssen sich die Menschen, und unter Lachen und mit Tränen in den Augen wünschen sie einander ein gesegnetes Christfest.
Bei den Erdmanns wird in diesem Jahr das Brechen und Teilen der Oblaten fast widerwillig getan; beide Eltern reichen sie einander ohne die Ergriffenheit und Bewegung, wie es früher gewesen ist. Amalie wirkt abwesend, und manchmal trommelt sie nervös mit den Fingern auf die Tischplatte, wenn die Kinder laut werden; sie hat es eilig an diesem Abend, die Kinder ins Bett zu bringen. Sonst sitzt man nach dem Festessen lange in der mit frischem weißem Sand ausgestreuten Stube zusammen, in der es nach Gans, nach Bratäpfeln und Tanne riecht. Sogar für die heilige Familie sind Gedecke aufgetragen worden, und diese drei Teller zwingen alle um den Tisch zu einer solchen Feierlichkeit, als säße das heilige Paar mit seinem Kind leibhaftig unter ihnen. Heute Abend stehen nur drei überflüssige Gedecke da, auf die Amalie in Gedanken versunken blickt: ja, zu Hause, bei ihren Eltern, da waren schon einmal Fremde am Tisch gewesen und haben von diesen Gedecken gegessen. In diesem Haus ist das all die Jahre, die sie hier wohnt, noch nie vorgekommen, weil ihre Schwiegermutter bei dieser Feier keine Fremden am Tisch haben wollte. Und das ist auch so geblieben, als die alte Frau gestorben war.
Nachdem sie das Weihnachtslied ’Lulajze Jezuniu‘ gesungen haben, dürfen die Kinder endlich vom Tisch aufstehen und sich über das hermachen, was ihnen beschert worden ist. Amalie hat, als sie die Führung des Haushalts übernommen hatte darauf bestanden, dass das Weihnachtsmahl und damit der Tag mit diesem schlichten polnischen Lied beendet werde. Die Schwiegermutter hatte sich, so lange sie lebte, durchgesetzt und das deutsche Lied singen lassen: ‚Freuet euch, ihr Christen alle’; seit sie aber begraben ist, singen sie in Erdmanns Haus, obwohl auch Amalie das Polnische ablehnt, ’Lulajze Jezuniu‘.
Jendrik fällt auf, dass seine Frau nach dem Kirchgang noch stiller geworden ist als vorher, und dass sie ungeduldig mit den Kindern ist und keine Freude zeigt. Ihr scheint der Schwiegervater zu fehlen, sagt er sich. Ja, manchmal sieht sie aus, als hätte sie sogar geweint.
„Hast du geweint?“ fragt er sie.
„Nein, weshalb sollte ich weinen? Ich bin nur müde. Nein, es ist nichts.“ Sie schüttelt den Kopf, das genügt ihm, und er lässt sie in Ruhe.
Nach den Feiertagen werden sie mit allen Kindern nach Lodz fahren, um mit Jendriks Bruder das väterliche Erbe zu besprechen. Wenn Amalie daran denkt, dann legt sich etwas um ihren Hals und würgt sie. Sein Bruder und die Schwägerin verursachen ihr Unbehagen. Bei der Beerdigung des Schwiegervaters hat sie alles daran gesetzt, ihnen nicht zu nahe zu kommen; so ist Amalie entschlossen, nicht zu fahren, sondern mit den kleinen Kindern hier zu bleiben.
„Hoffentlich ist besseres Wetter, wenn du mit den Großen nach Lodz fährst.“
„Mit den großen Kindern? Wir sind alle eingeladen“, hat ihr Mann geantwortet.
„Aber es muss sich jemand um das Vieh kümmern!“
„Ja. Um Vieh und um Haus wird sich Witold kümmern!“
„Der Witold? Du willst das alles dem Witold überlassen? Diesem ... Er ist doch noch fast ein Kind!“
„Mit siebzehn Jahren? Ich weiß, was ich ihm zumuten darf.“
„Jendrik, außerdem fühle ich mich in letzter Zeit nicht wohl“, wendet die Frau später ein.
Sie liegt abgewandt und weit weg von ihm im Bett. Obwohl sie den ganzen Tag gearbeitet hat und so vieles bedenken musste – sie kann nicht einschlafen. Der Gedanke an den Besuch bei der Lodzer Verwandtschaft hat alle Müdigkeit verscheucht. Es ist, als hätte sich die Klammer, die sie um den Hals spürte, auch noch um die Brust gelegt.
Der Mann lässt sich Zeit, ehe er sagt: „Ja, das habe ich bemerkt. Aber die Pflege meines Vaters war für dich auch viel zu ...“
„Nein, nein, das ist es nicht, Jendrik, nicht das ...“
„Was ist es dann?“
In dem Bettchen nebenan werden die Zwillinge unruhig, die sie im Frühjahr geboren hat, und eins von ihnen beginnt zu wimmern. Amalie hat ihm heute den Grund ihres Unwohlseins sagen wollen, aber sie sagte es nicht.
Sie steht auf und tappt auf bloßen Füßen zu den Kleinen, um sie zu beruhigen. Als sie sich wieder zu Jendrik legt, da ist er schon eingeschlafen.
Durch den Riss in der Fensterlade scheint der Mond. Oder leuchtet der Schnee in dieser Nacht so hell? Nach und nach bekommen einige Dinge in der dunklen Stube durch das spärliche Licht Konturen oder sie verzerren sich zu Spukgestalten.
Wenn sie mit der Schwägerin, dieser Antonya, zusammen ist, dann wird der Boden unter ihren Füßen unsicher. Ihr ist, als klaffe ein tiefer, ein unüberbrückbarer Riss zwischen ihr und der Schwägerin. Antonyas Art zu sitzen, plötzlich aufzustehen und etwas in der Stube unter die Lupe zu nehmen, ihre Art zu sprechen – das verunsichert sie. Wenn jene Fragen stellt oder Antwort gibt – deutlicher kann man das Gegenüber nicht klein machen, findet Amalie. Und wie sie mit dem Besteck umgeht! Wenn wir beide zusammen kommen, dann wechseln wir in fremde, in gegensätzliche und beklemmende Welten. Nein, in Antonyas Nähe packt mich nichts als Unbehagen. Warum soll ich tagelang mit dieser Frau zusammen sein, wenn es sich so verhält?
Mag Jendrik seine Verwandten besuchen! Mag er auch die größeren Kinder mitnehmen. Ich werde nicht fahren!
„Wie soll ich mit den größeren Kindern fahren können? Wenn sie schreien, dann werden sie nach dir schreien! Ich kenne sie doch: schon während der Fahrt wird das Gequengel losgehen“, hatte er gebettelt. Und als sie schwieg, hatte er weiter eingewandt: „Und außerdem muss ich mich mit dir besprechen können, Malchen. Du weißt, dass ich nur ungern Entscheidungen treffe, die nicht mit dir besprochen wurden ...“
„Und wenn ich sie nicht gutheiße – du tust dennoch, was du für richtig hältst!“, hatte sie ihn heftig unterbrochen. „Du hörst ja überhaupt nicht auf das, was ich sage, Jendrik!“
„Das ist nicht wahr! Ich höre schon auf dich, aber du bist oft sehr zögerlich, dir fehlt oft die Entschlusskraft, die für so manche Entscheidung nötig ist. Bedenken, ja, das ist gut. Aber man kann nicht alles so lange bedenken, wie du es machst. – Du wirst mitfahren. Und wenn du es bei ihnen nicht mehr aushalten kannst, nun, dann fahren wir eben wieder heim“, bettelte er weiter.
Nein, dazu wird es nicht kommen, wollte sie ihm antworten. Auch das hat sie ihm nicht gesagt. Denn sie wird hier bleiben, und wenn sie eine Lüge erfinden muss! Ja, dazu ist sie bereit!
Aber wie anders ist es, wenn er vor ihr steht und mit ihr spricht! Dann ist es mit ihrer Standhaftigkeit vorbei.
Sie hat ihm nicht viel entgegenzusetzen gehabt, und eine Lüge, nun die ist ihr bis jetzt auch noch nicht eingefallen. Wenigstens eine solche nicht, die ihn hätte überzeugen können, die einleuchtend gewesen wäre.
Sie wird mir schon einfallen, sagt sie sich und hört ihm zu, wie er tief und gleichmäßig atmet.
Etwas Beruhigendes und Angenehmes geht durch sie und lässt sie schließlich einschlafen.