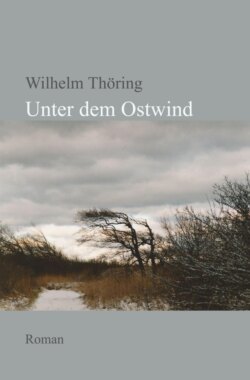Читать книгу Unter dem Ostwind - Wilhelm Thöring - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
ОглавлениеIm Zimmer ist es dämmerig und still. Wenn Schnee liegt, ist es länger hell, aber bis in dieses Zimmer kann kein Schnee heraufleuchten. Es liegt in der oberen Etage der Villa Stanislaus Erdmanns, zudem halten breite und schwere Fenstervorhänge das Licht draußen. Hier sind sie nicht so sehr auf das Tageslicht angewiesen, in allen Zimmern dieses Hauses hängen prachtvolle Lampen, die jederzeit Licht spenden, mehr Licht, als wenn Amalie in ihrer Stube in Zdunska Wola alle Petroleumlampen und ihren ganzen Kerzenvorrat angezündet hätte. In der Ecke tickt die große Wanduhr, die zu gewissen Zeiten sogar eine kleine, abgehackte Melodie hören lässt; das wäre der Anfang eines Volksliedes, wurde ihr gesagt.
Amalie sitzt vor dem Fenster im Erkerzimmer, auf dem Schoß liegt eine Stickarbeit, ein Geschenk ihrer Schwägerin Antonya. „Ich weiß, dass du solche Arbeit von jeher gerne gemacht hast“, hat Antonya gemeint. „Wenn sie fertig ist, dann soll sie dich an diese Tage in Lodz erinnern!“ Es ist eine komplizierte, eine kostbare Arbeit und Amalie findet, die passe eher in dieses Haus, nicht in ihre derbe Stube.
Eben hat die Halina, das stupsnasige Hausmädchen, die Schwägerin nach draußen gebeten. Die Halina ist eine direkte, eine unverblümte Person. Gleich bei der ersten Begegnung hat sie erkennen lassen und eine Bemerkung gemacht, dass sie diese Leute vom Land nicht mag.
Amalie überlässt sich ihren Gedanken.
Sie denkt an die lange Fahrt in der kalten Kutsche, die der Schwager geschickt hat. Die Nachbarn in Zdunska Wola waren nicht besonders überrascht, diese Kutsche vor Erdmanns Haus zu sehen. Sie wussten, das sind die Lodzer Verwandten. Ein wenig erstaunlich war es für sie, dass nach dem Weihnachtsfest das Gefährt wieder auftauchte und gleich für einige Tage auf dem Hof stand. Keiner konnte sich erinnern, sie vor der Beerdigung des alten Siegismunds in dieser Stadt gesehen zu haben.
„Werdet ihr damit zum Jahreswechsel so vornehm in die Kirche fahren?“, wurde Amalie gefragt.
„Nicht in die Kirche.“ Dann etwas überheblich: „Nach Lodz fahren wir. Zum Schwager.“
„Ei, seid ihr vornehme Leute geworden!“
War das vergnüglich! Amalie muss jetzt noch darüber lachen. Nachdem sie sich gegen die Fahrt nicht mehr verweigern konnte, gab es schon wegen der Kinder vieles zu bedenken; dazu die Aufregung und Fragerei bei ihnen!
Für die Kinder hat sie Ziegelsteine heiß gemacht und Wärmflaschen mitgenommen und sie zu ihnen in die Decken gelegt. Es dauerte nicht lange, ein wenig hinter Zdunska Wola, und die Kleinen haben zu jammern angefangen und über kalte Füße und Hände geklagt. So mussten sie und Jendrik während der langen Fahrt abwechselnd das eine oder andere auf den Schoß nehmen, um es zu wärmen.
Als sie durch Pabianice gefahren sind, haben die Kinder Gucklöcher in die vereisten Scheiben gekratzt und gehaucht und sich die Nasen platt gedrückt. In Lodz schließlich wollten sie aussteigen und zu Fuß gehen. Solche breiten und festen Straßen, wo sich Geschäft an Geschäft reiht und wo in einer einzigen Straße mehr Menschen unterwegs waren, als in ihrer Stadt wohnen – das hatte keiner von ihnen je gesehen. Auch Amalie und ihr Mann staunten, und gegenseitig machten sie sich auf die vielen unerhörten Dinge aufmerksam, die es hier zu bewundern gab. Zu beiden Seiten der Straßen standen hohe Lampen, die von einem Mann mit einer langen Stange angezündet wurden, so dass es selbst am Abend heller war als an manchen Tagen in dieser Zeit. Und in unerhörter Fahrt jagten Kutschen rechts und links an ihnen vorbei, dass ihnen schwindelig werden konnte.
„Wohnen hier denn nur Reiche?“ hat sie ihren Mann gefragt. „Wie gut die gekleidet sind! So wohlgenährt ...“
„Das ist die Stadt“, versuchte der Mann zu erklären. „Da kleiden sie sich anders als bei uns auf dem Land. Hier verdienen sie in den Fabriken gutes Geld. Sogar die Frauen arbeiten, sagt Stanislaus.“
Amalie ist entsetzt. „Die Frauen arbeiten? Und die Kinder!“
„Frag meinen Bruder. Arme gibt es hier auch mehr als genug. Die fallen nur weniger auf.“
Sie wunderten sich über die schnurgerade Straße, durch die Menschenmassen schwärmten, über die aneinandergereihten Häuser wunderten sie sich, in denen sie Geschäft an Geschäft sahen. Dann bogen sie in ein stilleres Viertel ein, in dem weniger Menschen unterwegs waren. Nur die Kutschen jagten noch hin und her. Die dichten Häuserfronten blieben zurück, dafür tauchten zu beiden Seiten der Straße Villen auf mit Erkern und verzierten Giebeln, mit hohen hellen Fenstern, vor denen durchscheinende Vorhänge hingen, über die die Frau sich sehr wunderte. Hinter den Scheiben erkannten sie Menschen, die in den Abend schauten oder miteinander sprachen. Manche Villa stand dicht an der Straße, aber eine hohe Mauer oder ein kunstvolles Gitter schirmte sie ab. Andere versteckten sich in einem weiten Park, und der Weg dahin wurde von kleinen Laternen beleuchtet; in der Ferne blinkten ihre Lichter aus hohen Fenstern in die Dunkelheit.
Das Pferd, das ihre Kutsche zog, in der sie saßen, ist ruhig und gelassen durch das Gewühl gegangen. Plötzlich jedoch verfiel es in einen leichten Trab. Es hielt sich dicht an der rechten Straßenseite und einige Frauen, die nebenher gingen, grüßten, und Männer zogen ihre Mütze vom Kopf und verneigten sich.
Sie haben die Straße verlassen und sind in einen dunklen Weg eingebogen, der vom Schnee freigefegt worden war. Verschneite Tannen waren zu erkennen, schwarze Baumstämme und Büsche, die sich unter der Last des Schnees bogen. Nach einer scharfen Kurve tauchte rechts neben der Kutsche ein Haus mit Säulen und einer weiten Freitreppe auf. Jemand leuchtete mit einer Fackel durch das Wagenfenster und rief: „Sie sind da! Sie sind da!“
Augenblicklich waren die oberen Stufen der Treppe voller Licht. Amalie erkannte den Schwager und die Schwägerin, daneben deren Kinder und etwas im Schatten die stupsnasige derbe Person in ihrer Dienstkleidung.
„Wie weit bist du denn, Schwägerin?“ fragt Antonya so leise, als sei jemand eingeschlafen. Sie ist ins Zimmer gekommen, ohne dass Amalie sie bemerkt hat. Antonya lehnt gegen den Porzellanofen. Sie steht tief im Schatten und ist noch immer nicht zu erkennen.
„Ach, Antonya, Schwägerin, bist du hier? Ich habe dich gar nicht gehört. Wovon sprichst du?“
„Von deiner Schwangerschaft. Ich habe das bei der Beerdigung schon bemerkt.“
„Es müsste der dritte Monat sein.“
„Nicht weiter?“ Sie tritt aus dem Schatten. „Diese unersättlichen Kerle!“ schimpft Antonya mehr für sich.
„Nein, ich freue mich auf dieses Kind, denn es wird das letzte sein ...“ gibt Amalie zurück.
Antonya kommt an Amalies Seite, gallig sagt sie: „Ja, das hat man uns gelehrt: freue dich, denn zum Gebären bist du da. Freue dich, Kinder sind eine Gabe des Himmels. Aber jede dieser Himmelsgaben zerstört unseren Körper und macht uns mit einem Schlag um Jahre älter und hinfälliger, und dann ...“ Sie bläst verärgert Luft durch die Nase. „ ... und dann, dann machen sich die Kerle davon und lassen uns mit unseren Himmelsgaben im Regen stehen! So ist das! So machen sie es alle.“
„Jendrik nicht“, widerspricht Amalie.
„Vielleicht jetzt noch nicht.“
Amalie ist, seit sie dieses Haus betreten hat, noch irritierter, als sie es vor der Reise gewesen ist. Diese Antonya ist so ganz anders als jene, die sie vorher kennengelernt hat. Antonya wirkte immer etwas fremd, etwas zurückhaltend und von oben herab, nicht selten sogar dünkelhaft. Der Schwiegervater nannte sie das ‚Polnische Madamchen’, wenn sie oder Stanislaus nicht in der Nähe waren. Oder er winkte ab oder zog die Mundwinkel verächtlich nach unten, wenn jemand ihren Namen erwähnte. Es soll sogar zwischen ihm und Stanislaus, seinem älteren Sohn, zu lauten, zu aufbrausenden Auseinandersetzungen nach der Hochzeit gekommen sein, worauf der Sohn sich nicht mehr in Zdunska Wola sehen ließ. Erst als die Mutter beerdigt wurde, traf er mit dem Vater zusammen und hat sich mit ihm ausgesprochen; zu einer Aussöhnung sei es nicht gekommen, hat der Sohn durchblicken lassen. Antonya ist, als es zu dieser Begegnung kam, in Lodz geblieben.
Das war vor acht Jahren.
Antonya beugt sich über die Handarbeit und hebt sie etwas in die Höhe, um sie besser besehen zu können. „Wie sauber du stickst, Schwägerin. Das sieht aus, als würdest du nichts anderes tun, als käme es aus Asien. Es heißt, die handarbeiten so vollendet wie kein anderer.“
Amalie lacht etwas. „Ich habe seit Jahren nicht mehr gestickt. Was ich getan habe, Schwägerin: am Webstuhl habe ich gesessen! Seit der Heirat – nur am Webstuhl. Dann kamen die Kinder. Haus und Garten waren zu versorgen, zuletzt dazu noch die Schwiegereltern ...“
„Ja, du bist stark. Ich hätte das nicht gekonnt.“
„Nein, stark bin ich nicht.“
„Ich fühle mich an manchen Tagen schon mit den Leuten hier überfordert! Alle diese schwerfälligen Schädel! Wenn du denen nicht jede Einzelheit vorkaust –“ Antonya läutet, und augenblicklich erscheint die Halina, diese stupsnasige Person, als hätte sie hinter der Tür gestanden.
„Halina, bringen Sie uns den Tee. Aber hierher an den Ofen!“ fügt sie mit Nachdruck hinzu.
Später, die Halina hat gehorsam ein Tischchen an den Porzellanofen getragen und einen Stuhl dazugestellt, gesteht Antonya: „Ich habe mich auf das Zusammensein mit dir, Schwägerin, gefreut. Ich weiß, dass du überhaupt keine Lust hattest, nach Lodz zu kommen. Aber ich wollte, dass du mitkommst! Du und die Kinder. Ich dachte mir, nein, ich habe es gehofft, dass das eine Gelegenheit ist, die uns zwei näherbringt ...“ Sie bricht ab und machte eine Pause. Dann: „Zwichen uns gab es immer so etwas wie eine Mauer. Weißt du, ich finde, dass die eingerissen werden muss; ich habe das Gefühl, dass wir uns verstehen könnten.“
Amalie macht ein Gesicht, als verstehe sie nicht.
Die Schwägerin sagt: „Mit den Schwiegereltern war es auch für mich nicht leicht. Sie haben mich abgelehnt. Sie sagten: Wenn so eine sich in eine Weberfamilie drängt, dann will sie etwas. Sie haben mich auch gefragt: Was wollen Sie mit unserem Sohn? Der passt nicht dahin, wo Sie herkommen. Wir sind Weber, wir leben von der Arbeit unserer Hände, ehrlich und aufrichtig. Sie waren hart, alle beide! Hart und fromm und stolz. Und misstrauisch gegen alles, was ihnen fremd war. Sie sagten: Um uns zusammenzubringen, habe mein Vater den Stanislaus gekauft.“
„Wenn ich dabei war, dann wurde nie über die Sache gesprochen“, sagt Amalie. „Aber wie kann man einen Menschen kaufen?“
„Aber das weißt du, dass mein Vater Stanis’ Studium bezahlt hat. Die Schwiegereltern hatten dafür kein Geld. Und hätten sie’s gehabt, dann hätten sie nichts herausgerückt. Wie kann ein Webersohn studieren? Das macht ihn vor der Obrigkeit verdächtig! Für die geriet die Welt aus den Fugen, weil der Sohn aus allem Vertrauten, aus der alten Ordnung auszuscheren versuchte. So etwas hat’s bei den Erdmanns noch nie gegeben!.“
Es ist so dunkel im Zimmer, dass die Frauen sich nicht sehen können. Antonya zündet eine Kerze an und stellt sie auf das Tischchen. „Dass Stanislaus mich liebte und ich ihn – das war für die Schwiegereltern ebenso unmöglich. Wer heiratet denn aus Liebe? Neumodische Kindereien sind das. Wenn geheiratet wird, dann wird weder aufs Gesicht noch auf die Figur geguckt, vielleicht auf den Charakter, sondern auf das, was der andere in der Tasche hat. Aber diese Regel galt bei uns nicht. Nicht bei Stanislaus, nicht bei mir. Denn ...“ Antonya kichert. „Obwohl ich doch, wie man so sagt, mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde – so eine wollten sie trotzdem nicht. So hoch hinaus sollte der Sohn nicht langen, denn da stürzt man schnell und tief!“
Sie ist aufgestanden, um den Rücken am Ofen zu wärmen. „Was man vom Adel zu halten habe, das wisse jeder, sagten sie zu Stanislaus. Der Adel ist faul, er presst die Menschen aus, hat einen Dünkel, dass es zum Himmel stinkt. Selbst wenn er so unbedeutend ist, wie wir es sind. – Bei der Beerdigung des Schwiegervaters überfiel mich wieder die Erinnerung und dieses ... dieses Gefühl, dass ich eine Fremde in der Familie bin und wohl auch bleiben werde.“
„Wie, du selbst denkst das auch?“ bricht es aus Amalie hervor und sie schlägt sich sofort vor Schreck auf den Mund.
„Amalie, Schwägerin, das spürt man doch. Du würdest es auch spüren. Du zeigst eine harte Rinde, aber innen, Amalie, bist du aus weichem Holz, bist verletzbar, ohne viel Widerstand. Und jetzt, da von der alten Generation keiner mehr da ist“, sagt Antonya fast fröhlich, „möchte ich Frieden schließen. Mit dir, auch mit dem Jendrik. Darum habe ich alles daran gesetzt, dass ihr nach Lodz kommt. Und ihr seid gekommen. Glaubst du mir, dass ich mich darüber freue? Sehr freue?“
Antonya kommt um das Tischchen, um die Schwägerin zu umarmen. „Amalie, ich möchte alles versuchen, dass wir uns näher kommen und nicht mehr wie Fremde gegenübersitzen.“
Stanislaus ist mit seinem Bruder an diesem Nachmittag in die Fabrik gefahren, die ihm durch eine Erbschaft seiner Frau mit zugefallen ist. Noch vor seiner Heirat mit Antonya hat er sich ins Praktische der Tuchweberei eingearbeitet und den Betrieb in wenigen Jahren zu einem angesehenen und gewinnbringenden Unternehmen ausgebaut.
Das war einer der Gründe, warum sein Schwiegervater, der alte Graf Zlotczinsky, die Eskapaden seines Tochtermannes ertrug. Der andere war dieser: sein Sohn Krystian, Antonyas älterer und einziger Bruder, war sehr früh als Anarchist in den Untergrund gegangen, um mit einer Gruppe junger Männer und Frauen gegen die russischen Okkupanten zu kämpfen. Sie sollen achtzehnhunderteinundachtzig bei dem Attentat auf den Zaren beteiligt gewesen sein, und seither lebte Krystian irgendwo auf der Welt als Gejagter in einem Versteck, das keiner aus seiner Familie kennt.
Aufgebracht ermahnte der alte Graf seinen Sohn: „Patrioten, mein Sohn, das sind wir alle! Auch deine Mutter, die sich nicht zu den politischen Dingen äußert. Du weißt doch: Gewalt erzeugt Gegengewalt. Was ist das schon, was ihr vollbracht habt? Mit Alexander II. habt ihr den falschen in die Luft gejagt! Die Ochrana und die ganze Polizeimacht wird nicht eher Ruhe geben, bis sie euch aufgespürt und gehängt hat. Mein Sohn, du bringst nicht nur Sorge, Unruhe und Enttäuschung über deine alten Eltern, sondern Angst! Angst um dich, um deine Schwester – auch Angst um uns selbst. Das wir so etwas noch erleben müssen!“
Krystian hatte dazu geschwiegen. Und als der Vater nichts mehr zu sagen hatte, stand er auf, hatte wortlos die Mutter geküsst und war gegangen. Seither hat es kein Lebenszeichen mehr von ihm gegeben.
An manchen Tagen äußerte die alte Gräfin: „Mir sagt eine innere Stimme, dass der Krystian tot ist. Es ist so, als flüstere jemand mir das ins Ohr. Immer wieder, immer wieder ...“
Sie bekam dann rote Augen, verließ die anderen und zog sich für längere Zeit in ihr Boudoir zurück und wollte ungestört bleiben.
So ist denn die Leitung der Tuchweberei in Stanislaus’ Hände gekommen.
Die Fabrik liegt jenseits der Straße, weiter zur Stadt, hinter einer Reihe von kleinen schäbigen Arbeiterhäusern. Diese Häuser, erklärt Stanislaus seinem Bruder, werde er in ein paar Jahren für seine Leute kaufen und sie verbessern lassen. „Bezahle deine Leute gut und schaffe ihnen eine ordentliche Unterkunft, so hältst du sie bei der Stange.“ Er lacht laut. „Wenn du erfolgreich ausbauen und erweitern willst, Bruder, dann musst du auch auf solchen Feldern ackern!“
Überall wo Stanislaus sich mit seinem Bruder sehen lässt, da taucht auch bald ein Schwarm dienstbeflissener Leute auf. Jendrik ist die Unterwürfigkeit der Männer zuwider. Mit krummem Rücken, die Mütze in der Hand, erwarten sie Befehle.
‚Die russischen Herren haben viel verbogen, sogar den Charakter der Polen, denkt er. Mein Bruder scheint es zu genießen, dass sie um ihn scharwenzeln und ihm liebedienern‘, denkt er, denn Stanislaus steht sehr achtunggebietend vor ihnen und schaut mit abwesendem Blick über die gesenkten Köpfe hinweg, als gäbe es die gar nicht.
„Wie kannst du das ertragen?“ fragte Jendrik, als sie wieder allein sind. „Diese Demut, diese Kriecherei ...“
„Ich kann es nicht ändern! Glaube mir nicht, dass ich das mag! Was sollen sie sonst vor dem Herrn tun? Über viele Jahre wurde ihnen das mit der Knute eingebläut. Wie sollen sie sich da nicht bücken vor einem, den sie für mächtig halten? Schließlich haben sie doch nur überlebt, weil sie den Rücken krumm gemacht haben und auf dem Bauch gekrochen sind!“ Er bleibt stehen und hält den jüngeren Bruder am Arm fest. „Wenn du nicht auf dem Acker unserer Väter säßest – Bruder, hier würdest auch du dich krumm machen! Aber so, wie du lebst, lebst du wie ein freier Mann und Herr!“
Der Acker der Väter – ja, darum geht es ihm! Vielleicht hat der Bruder das mit Absicht gesagt. Um über das väterliche Land zu sprechen, dafür ist er nach Lodz gekommen. Bis jetzt hat keiner daran gerührt. Das Land zu teilen bedeutet, in ein bedeutungsloses Kätnerdasein zu fallen und, was beinahe noch ärger wäre, Häme und Spott der Nachbarn hinzunehmen.
Stanislaus lässt den Bruder stehen und wendet sich einer adretten Frau zu, die in gehöriger Entfernung auf ihn wartet. Jetzt, da er auf sie zukommt, streckt sie ihm eine Mappe entgegen. Der Bruder blättert darin und erklärt etwas, und die Frau nickt mit gesenktem Kopf. Plötzlich aber reckt sie sich und sieht ihm keck ins Gesicht, wobei sie sich herausfordernd nach hinten biegt.
Stanislaus ist verärgert und weiß nicht, wie er sich vor dem Bruder verhalten soll. Er herrscht die Frau an und sie flüchtet mit rotem Kopf in die Halle zurück.
„Manchmal schlägt das kleine Luder übers Ziel“, meint er verlegen zu Jendrik und wiegt seinen Kopf: ja, da kann man nichts machen.
„Ja, vielleicht ist es so, dass du sie an einer langen Leine laufen lässt, Bruder“, antwortet Jendrik.
Das väterliche Erbe – vor allem Jendrik spukt der Gedanke an eine Aussprache durch den Kopf und bedrückt ihn. Wenn sie allein sind, dann liegt das bleischwer zwischen ihnen, findet er. Was wird der Bruder vorschlagen und unternehmen, der sich in der Rechtswissenschaft gut auskennt und dem in einer Stadt wie Lodz alle Möglichkeiten offen stehen, um an das zu gelangen, worauf er ein Anrecht hat. Hätte nur der Vater diese Sache noch geregelt! Das wäre nicht anzufechten, das hätte Gültigkeit für alle Zeit. Haben die Alten es nicht über Generationen so gemacht? Wie wird diese Sache ausgehen? Wortlos sitzen sie in der Kutsche einander gegenüber. Jendrik scheut sich, den Bruder anzusehen, als könnte der in seinem Gesicht die Gedanken lesen. Sein ganzes Interesse scheint dem zu gelten, was er draußen sieht: die hetzenden Menschen, die endlosen Häuserzeilen, an denen sie vorbeifahren. Das alles fesselt ihn so, als sähe er es zum ersten Male. Er hört den Bruder sagen: „Mit Vaters Erbe gibt es nichts zu regeln, Jendrik. Es ist geregelt, wie es schon vor seinem Tod geregelt war. Und so soll es bleiben.“
„Ich verstehe dich nicht ... Nichts zu regeln?“, stottert er verwirrt. „Deine Frau sagte doch ...“
„Ach was! – Es bleibt alles, wie es ist. Bruder, ich habe mehr, als ich brauche. Die Tage, die du bei mir bist, habe ich mir die Sache wieder und wieder durch den Kopf gehen lassen. Nein, eigentlich nicht – im Grunde, Jendrik, stand mein Entschluss schon bei Vaters Beerdigung fest. Ich habe mit Antonya gesprochen, die hält es auch für richtig, dass alles so bleibt, wie es ist, und dass das Land nicht in billige, nutzlose Flicken zerrissen wird.“
„Heißt das, dass du verzichtest? Vaters Land, das Haus – nicht teilen? Meinst du das?“
„Ja. Wir dürfen nicht teilen. Denn jeder Erdmann vor uns hat versucht, den Besitz zu vermehren.“
„Ja, das ist wahr.“
„Und du, Bruder, sollst es wie unsere Väter machen! Was ich hier in Lodz besitze, das siehst du ja. Und dann sind da noch die Güter meines Schwiegervaters. Meine Kinder sind versorgt, alle vier. Was mit dem Krystian ist, das steht in den Sternen. Der wird sein Erbe, wenn sich die politische Lage nicht ändert, niemals antreten können. Ja, wenn der überhaupt noch lebt! Solange die Russen einen Fuß in Polen haben, wird der das Leben einer Ratte führen müssen: immer im Untergrund, immer im Verborgenen ... So ist das doch.“
„Ihr wisst nichts von ihm?“
„Gar nichts. Also, noch einmal: mit Vaters Land und Haus bleibt es, wie es ist!“
Vor der Villa toben die Kinder im Schnee. Als sie die Kutsche entdecken, rennen sie schreiend nebenher. Der Kutscher Frantizek ist abgesprungen, um einen Unfall zu verhüten. Er hält die kleine Horde behutsam von den Rädern fern. „Was gibt’s denn?“ fragt Stanislaus durch den Fensterspalt. „Warum schreit ihr wie die Pferdeknechte?“
„Wir dürfen Silvester Schlittschuh laufen, Vater! Alle! Bis in die Nacht! Ach – bis ins neue Jahr hinein!“
„So?“
„Es soll ein richtiges Fest werden! Weil wir Besuch haben!“
„Wer sagt das?“
„Mutter!“
„Ja, dann wird das wohl so sein.“
Antonya steht mitten im Zimmer. Sie kehrt ihrem Mann den Rücken zu als sie fragt: „So, du willst auf die Bärenjagd?“
„Ja.“
„Wann hast du dir das denn überlegt?“
„Seit ich weiß, dass es einen Bären in der Jezower Gegend gibt.“
„Um diese Zeit?“ fragt sie misstrauisch. „Ein Bär? Ende Dezember? Liegen die nicht im Winterschlaf?“
„Man hat ihn aufgestöbert oder aufgeschreckt ...“
„Wer will hier wem einen Bären aufbinden, Stani?“
„Bitte, Antonya, es ist ein Bär ...“ beteuert der Mann. „Mein Bruder wird mitgehen ...“
Sie dreht sich jäh um und kommt einen Schritt auf ihn zu. „Jendrik? Ja, will der sich dieses schreckliche Treiben denn überhaupt ansehen?“
„Er will.“
Damit muss Antonya sich zufrieden geben. Sie lässt die Halina kommen und gibt Anweisung, alles herzurichten, was die beiden Herren für die Jagd benötigen.
Am Vormittag des folgenden Tages brechen die Männer auf, um bei Jezow nach dem Bären zu suchen.
In einem zweiten Wagen fahren ein paar von Stanislaus’ Leuten und die Hunde mit; es geht ostwärts. Ein kleines Stück fahren sie durch die Stadt, dann sind sie im freien Feld. Hier ist es frostiger und der Schnee nicht so grau und voller Flecken. Die Kälte hat einige Bäume zerrissen und manchmal müssen die Männer die Straße von Ästen und Zweigen freiräumen. Es kann vorkommen, dass Bauern, die verstreut im Feld hausen, vor ihre Hütte treten und über die wunderliche Gesellschaft lachen, die bei diesem Wetter mit einer jaulenden Hundemeute übers Land fährt.
„In mir hast du nicht mehr als einen Zuschauer“, sagt Jendrik zu seinem Bruder.
„Kein Gewehr?“ fragt Stanislaus und tut belustigt.
„Nein.“
„Du bist dir treu geblieben, Jendrik, bist immer noch die Taube, die du als Junge schon gewesen bist.“
Die Männer hocken frierend in ihren Pelzen und Decken in der Kutsche. Von oben bis unten sind die Scheiben vereist. Wenn jemand spricht, dann zeigt sich eine Fahne von Rauhreif vor seinem Gesicht. Den Frantizek anschreiend, erkundigt sich Stanislaus, wo, verflixt noch einmal, sie denn überhaupt sind. Die Kälte und das Gerumpel des Wagens zerrten an seinen Nerven. Ebenso laut, dass die beiden Männer zusammenzucken, brüllt der Frantizek seine Antwort durch einen Spalt im Dach. Jendrik hat nichts verstanden, aber der Bruder nickt zufrieden: „Gott sei Dank, jetzt dauert’s nicht mehr lange.“
Der Boden, über den sie fahren, scheint glatt zu sein wie ein zugefrorener See; das Gerumpel hört auf. Wie in einem Schlitten gleiten sie fast lautlos durch lichte Gehölze. Immer öfter verdichten sie sich zu Wäldern, die sich schwarz, abweisend den Fuhrwerken entgegenschieben und die aussehen, als sei noch nie jemand hier durchgegangen. Dann weitet sich das Land wieder und hinter einem Hügel taucht das verschneite Dach einer Hütte auf. Der rauchende Schornstein verrät, dass sie bewohnt ist.
Als die Wagen sich ihr nähern, treten zwei Menschen ins Freie. Die Arme fest um den Leib geschlungen, sehen sie den Ankömmlingen entgegen, und dann erkennen sie sie und beginnen heftig zu winken.
Frantizek brüllt durch den Schlitz: „Die Szannowskis erwarten Sie schon, Herr Graf!“
Stanislaus schlägt die Decken zurück und pellt sich mit steifen, verfrorenen Fingern bei dieser Nachricht aus seinem Pelz. Seine dicken Stiefel treten den Boden, als wollte er ihn einebnen. „Wir sind angelangt!“ ruft er fröhlich. „Bei den Szannowskis können wir uns erst einmal aufwärmen.“
Lachend und sich verneigend kommen die beiden Alten an den Wagen. Von ihren Gesichtern sind nur die Augen zu sehen. „Willkommen der Herr, willkommen! Der Herr Graf will den Bären schießen? Madonna, bei diesem Wetter!“ ruft der alte Mann und reibt vergnügt seine Hände.
„Ja, ja, den Bären! Wo habt ihr ihn gesehen?“ fragt Stanislaus ihn.
Der Alte deutet über seinen Rücken. „Dahinten am Wald. Vorgestern haben wir seine Spuren hier in der Nähe entdeckt. – Aber ans Haus hat sich der Halunke noch nicht getraut. Ich habe auch mehrmals in die Luft geschossen!“
Während seine Alte die Männer in ihr Haus führt, kümmert Szannowski sich um die Pferde. Die Hunde ahnen wohl, worum es geht. Sie kläffen, als röchen sie den Teufel, sie rennen wie besessen durcheinander und schnüffeln in der Luft herum und würden am liebsten sofort losstürmen.
„So bindet doch erst einmal die Viecher an!“ schreit Stanislaus. „Oder sperrt sie weg! Das Höllenspektakel ist ja nicht zum Aushalten!“
Szannowskis Stube ist niedrig und dunkel. Auf den schmalen Fensterbänken hat die Alte zusammengerollte Decken und Säcke vor die Ritzen gelegt, die den Luftzug, der durch die undichten Rahmen kommt, abhalten sollen. In einem Verschlag neben dem Ofen stehen ihre drei Schafe. Die vielen Menschen, die plötzlich die Stube füllen, haben die Tiere erschreckt, dass sie ihr Wasser ablassen und wegzuspringen versuchen. Die alte Szannowska steht bei ihnen und ist bemüht, die Tiere zu beruhigen.
Szannowski langt eine Flasche vom Bord und ein paar Gläser. „Trinken wir!“ ruft er. „Dass es Ihnen glückt, Herr Graf, den Bären abzuknallen. – Das hier wärmt, das macht Mut!“ fügt er augenzwinkernd und die Schnapsflasche schwenkend hinzu.
Alle trinken, auch Stanislaus trinkt mit, worüber sich der Alte dermaßen freut, dass er auf die Tischplatte haut und die Gläser hüpfen lässt.
„Zdrowie, Herr Graf! zur Jagd haben Sie noch nie mit mir getrunken! Brennt der Bestie ordentlich eins aufs Fell“, sagt er „Meine Alte und ich – wir beide haben ja keine Ruhe mehr hier draußen. Knackt einmal ein Balken – dann wird gelauscht und ich laufe nach der Flinte. Aber mit dem Schießen ist das bei meinen Augen so eine Sache. Ich knalle vielleicht noch meine Alte ab. Zdrowie!“ Szannowski gießt den Schnaps in seinen Hals, und weil ihn der hohe Besuch erfreut, gießt er gleich das zweite Glas hinterher.
Die Runde bricht in Gelächter aus. Auch die Alte lacht glucksend mit.
„Leute, wenn wir heute noch zum Schuss kommen wollen ...“ Stanislaus macht eine Geste des Aufbruchs.
Am Abend, wenn die Jagd beendet sein wird, wenn die Männer die Suppe gelöffelt haben, die die alte Szannowska ihnen bereiten wird, dann wird der Graf sie großzügig bezahlen, wie er es immer getan hat. Daran, wie einer dich bezahlt, hat die Alte einmal ihrem Mann zugeraunt, daran kannst du den Herrn erkennen. Ein wirklich großer Herr gibt viel, als wäre es wenig für ihn. Ein Reicher, der wenig gibt, der ist nicht nur ein Geizhals, der hat auch eine schlechte Seele, weil er glaubt, die paar Sloty machen ihn zu einem großen Herrn!
Der alte Szannowski weiß, wo sie den Bären suchen müssen. Darum geht er mit. Er führt die Gruppe an, und vor ihm laufen die Hunde, die immer aufgeregter werden, je näher und tiefer sie in den Wald kommen.
„Sag, wer hat das Tier denn zu dieser Jahreszeit aufgescheucht?“ fragt Stanislaus ihn.
„Partisanen, Herr Graf“, sagt Szannowski, und legt einen Finger auf den Mund. „Eine ganze Gruppe war hier. Trieb sich im Wald herum und knallte, als wäre Krieg.“
„Ist auch Krieg“, sagt der bucklige Marek, einer von Stanislaus’ Leuten, die als Treiber mitgefahren sind.
„Und die haben den Bären aufgescheucht?“
„So muss es gewesen sein. Hier, Herr Graf ...“
Szannowski hat eine Spur entdeckt. Die Männer betrachten sie und die Hunde drücken ihre Nasen hinein und werden noch gereizter.
Stanislaus befiehlt, dass man die Hunde jetzt laufen lassen soll. Unter den anfeuernden Rufen der Männer stieben sie jaulend und bellend davon. Und die hinterherlaufenden Männer haben Mühe, sie nicht aus den Augen zu verlieren.
„Und was machen wir?“ fragt Jendrik.
„Wir warten, bis es so weit ist. Das kann nicht lange dauern. Die Spur scheint einigermaßen frisch zu sein. Also treibt er sich auch noch hier herum.“ Stanislaus zündet seine Pfeife an, und mit seitwärtsgeneigtem Kopf lauscht er den Hunden und den Männern nach, die sich schnell entfernen.
„Wenn es so weit ist, dann kommst du mit“, sagt er zu seinem Bruder. „Bleibe nicht allein zurück. Der Bär kann ausbrechen. Es ist gefährlich, allein zu sein, du bist nicht bewaffnet. Jeder von uns trägt ein Gewehr bei sich, da ist das Risiko geringer.“
Sie stampfen mit den Füßen, aber es hilft nicht viel gegen diese beißende Kälte. Im Westen vergrößert und verfärbt sich die Sonne für den Untergang. Es wird nicht mehr lange dauern und sie verlängert die Schatten, und in ihrem rötlichen Licht bekommt die Kälte noch mehr Schärfe. Ein Krähenschwarm sucht kreischend seinen Schlafbaum auf.
„Also, du meinst, es soll alles so bleiben ... mit dem Erbe, meine ich“, sagt Jendrik.
Stanislaus spürt, dass der Bruder immer noch beunruhigt ist und seine Zweifel und Fragen dazu hat. „Das ist so gut wie verbrieft und besiegelt, Jendrik. Auch wenn du der jüngere bist. Du sollst auf dem Land bleiben! Ich kann da nicht leben, ganz zu schweigen von Antonya und den Kindern.“
„Ich denke, wenn der Vater das rechtzeitig ...“
„Hat er aber nicht. Du weißt, dass die Spannungen zwischen uns nie ganz ausgeräumt wurden. Dann war es zu spät für solche Dinge.“
Für diesen Augenblick wirkt Jendrik wieder erleichtert, als wäre die Sache damit endgültig und ein für allemal geklärt. Er möchte etwas sagen, und da fällt ihm nichts anderes ein als den Bruder zu fragen: „Stanislaus, kannst du dir erklären, warum die Eltern uns slawische Namen gegeben haben? Unsere Eltern, die Großeltern – alle hatten sie deutsche Namen, soviel ich weiß.“
„Nun, vielleicht wollte Vater, dass wir mit unseren Namen ganz in Polen aufgehen, wie er gerne in Polen aufgegangen wäre. Allen Geschwistern hat er slawische, hat er polnische Namen gegeben, den Mädchen, den Jungen – allen! Du weißt, der Vater konnte polnischer sein, als die Behörden es erwarteten. Auf polnischer Erde lebte er, polnischer Boden ernährte ihn, in polnische Erde kehrte er zu den Vorfahren zurück – vielleicht wollte er mit der Wahl solcher Namen mit der langen deutschen Tradition brechen. Wer weiß. Oder er hat sich damit der Mutter widersetzt, die oft genug sagte, sie könne das Polnische nicht ausstehen.“
„Dann hätte er echte polnische Namen wählen sollen:“
Plötzlich ertönt das Signal, dass der Bär gefunden ist. Und gleichzeitig hören sie auch das giftige Bellen der Hundemeute. „Heißt das, dass wir kommen sollen?“ fragt Jendrik.
„Ich denke, sie werden versuchen, ihn ins Feld zu treiben. Warten wir noch.“
Stanislaus hat vor Aufregung seine Pfeife gelöscht. Jetzt kann er nicht mehr still dastehen, er muss sich bewegen. Das Gewehr unter dem Arm, läuft er auf und ab und stolpert, weil er in eine Vertiefung unter der Schneedecke getreten ist.
„Mist!“ schimpft er. „Das fehlt noch, dass ich mir die Knochen breche.“
„Dein erster Bär ist das wohl nicht“, sagt Jendrik. „Oder hast du schon einmal einen erlegt?“
„Das ist mein dritter. Die anderen haben wir in den Wäldern meines Schwiegervaters gejagt. Der ist regelmäßig auf die Jagd gegangen ... Niederwild, Rehwild und Sauen, auch Schnepfen und Bekassinen.“
„Du hast Gefallen daran, ja?“
Stanislaus blickt für einen Moment seinen Bruder halb belustigt, halb skeptisch an. Er weiß, ihm ist das Töten ein Greuel. Er sagt: „Ja, ich bin anders als du, Jendrik. Du konntest nicht einmal einer Henne den Kopf abschlagen oder dem toten Stallhasen das Fell über die Ohren ziehen!“ Lachend zündet er wieder die Pfeife an. „Und ich wette: deine Schweine und Schafe lässt du immer noch schlachten und läufst weg, wenn der Metzger ihnen das Messer an die Gurgel setzt! Aber ganz so schlimm bin ich nicht. Wenn es um Bestien geht, die den Menschen angreifen – ja, dann schieße ich. Bären und Wölfe und ...“ er zögert etwas. „ ...und Russen. Ja, die gehören auch dazu, weil sie schlimmer sind als Bären und Wölfe.“
„Du würdest auf einen Menschen anlegen?“
„Nein, auf Menschen nicht, aber auf Russen?“
„Liebäugelst du am Ende auch mit Anarchisten und allen anderen, die die Ordnung verändern wollen?“
„Anarchisten? Einer in der Familie reicht mir, Bruder! Ich habe einen anderen Weg gewählt: den des Bürgers. Und das heißt, dass ich nicht nur für mich allein Verantwortung trage. Aber das mit den Russen, Jendrik, das ist so eine Sache.“
„Billigst du, was die Anarchisten tun?“
„Du solltest mich nicht danach fragen, Bruder. Aufgepasst, jetzt geht es los. Sieh doch nur ...“
Vor ihnen bricht ein durchdringendes Getöse im Wald los. Die Männer schreien durcheinander und schlagen mit Stöcken gegen die Bäume. Sie johlen und fluchen in deutscher und in polnischer Sprache und schließlich gehen ihre Rufe im Höllenspektakel der Hunde unter.
Stanislaus stapft durch den Schnee, um hinzugelangen, wo sie den Bären gestellt haben. Unerwartet besinnt er sich und kehrt um, und in diesem Moment fallen mehrere Schüsse; alles ist still geworden, sogar die Hunde.
„Jetzt haben die Idioten mich um mein Vergnügen gebracht!“ schimpft er. „Knallen die mir tatsächlich den Bären ab!“
Frantizek ruft durch die Hände: „Herr Graf, kommen Sie!“ Der Kreis um den Bären öffnet sich, als Stanislaus mit seinem Bruder erscheint. Schwanzwedelnd zerren die Hunde an ihrer Leine und winseln und versuchen, nach der Beute zu schnappen. Den Bären sehen sie ausgestreckt auf dem Bauch liegen, die Schnauze hat er unter eine Pfote gesteckt.
„Wir mussten das tun, Herr Graf. Er hat den buckligen Marek erwischt“, erklärt jemand aus der Runde. „Da.“ Unter dem Tier lugen ein Paar verdrehte Beine hervor.
„Vielleicht lebt er noch!“ ruft Stanislaus. „So rollt doch das Vieh von dem Menschen herunter!“
„Es ist besser, wenn Sie alles so lassen, wie es ist“, sagt der Frantizek. „Der Bär hat ihn regelrecht zerfetzt und verstümmelt. Der alte Szannowski wird Sie und Ihren Herrn Bruder zur Hütte zurückfahren, und um das hier, Herr Graf, kümmern wir uns. Fahren Sie nur.“
In der Kutsche sagt Jendrik: „Ein Menschenleben für ein Jagdvergnügen, Bruder ...“
„Es klingt so, als wolltest du mir einen Vorwurf machen? Das ist mehr als nur ein Unfall“, murmelt er, als spräche er mit sich.
„War das mitbedacht?“
„Nein, verdammt noch einmal! Nein, nein!“ Stanislaus ist verärgert, aber er zwingt sich, nicht scharf oder laut zu werden. Er sagt: „Die Bestie ist aus ihrem Winterschlaf geschreckt worden. Das macht sie wild und gereizt. Früher oder später wäre sie über die beiden alten Szannowskis hergefallen, dann über ...“ Er stopft seine Pfeife, ehe er weiterspricht. „Wir mussten ihn erledigen. Wir mussten es tun! Ach ja, der bucklige Marek ... Er hatte nur mit Wölfen Erfahrung. Dies war wohl sein erster Bär. Und sein einziger ...“
Die Rückfahrt kommt Jendrik kürzer vor, und ehe sie sich versehen, stehen sie vor der hingeduckten, schiefen Hütte.
Die alte Szannowska steht mit fragenden Augen neben der Kutsche. „Pan ...“ flüstert sie. „Pan, mein Mann ...“
„Dein Mann kommt. Er kümmert sich mit den anderen um den Bären. Du kannst wieder ruhig schlafen. Wir haben ihn erledigt. Von dem habt ihr nichts mehr zu befürchten.“
Die Alte bekreuzigt sich erlöst und ihr zahnloser Mund öffnet sich weit zu einem befreienden Lachen, ja, ihre Augen werden feucht vor Erleichterung, so dass sie sie mit dem Ärmel ihrer Jacke wischen muss. Mit großer Geste und viel weiter als nötig reißt sie die Tür auf und lässt die beiden Herren eintreten.
Später kommt auch der Wagen mit den anderen Männern. Sie sind ernst und wortkarg. Zwischen ihnen liegen der tote Marek und der Bär, und um die Hunde friedlich zu halten, hat man sie hinter dem Wagen herlaufen lassen.
Die alte Szannowska spendiert eine Decke, in die sie den toten Marek wickeln. Sie erzählt den Männern, wie froh sie ist, dass es nicht ihren Alten erwischt hat. In der Stube ist sie die einzige, die immer etwas zu reden und zu lachen hat.
„Wer sagt seiner Familie, was passiert ist?“ fragt Jendrik.
„Der Marek hat keine Familie“, antwortet Stanislaus. „Der lebt allein.“
Nachdem der alte Szannowski die Männer mit seiner Schnapsflasche aufgewärmt hat, fangen sie wieder zu reden an. Sie erzählen seiner Frau, wie sie den Bären gefunden haben und wie er sofort auf sie losgegangen ist.
„Auf die Hunde!“ verbessert einer. „Die haben den doch mit ihrem Gekeife richtig verrückt gemacht. Man hätte sie nicht ableinen dürfen, vielleicht hätten sie das Ungeheuer dem Herrn Grafen direkt vor die Flinte scheuchen können.“
„Ja, er ist ja auch in die Richtung getrabt, wenn der Marek, dieser Dämlack, ihm nicht den Weg versperrt hätte. Wollte den Helden spielen ... Wollte ihn mit bloßen Händen aufhalten oder in die richtige Richtung zwingen!“
„Ist das wahr?“ fragt Stanislaus.
Die Männer nicken. Er sieht zu seinem Bruder hinüber: „Siehst du, Jendrik, so war es also. Reine Unvorsichtigkeit. Eigene Schuld ... Siehst du.“ Zu den Männern sagt er: „Zieht das Vieh sauber ab. Den Pelz bekomme ich. Das Fleisch, das könnt ihr haben oder den Hunden geben.“
„Pfui Deibel!“ ruft einer über den Tisch, dabei spuckt er etwas von seinem Essen aus, und sofort beugt er sich wie ein geohrfeigtes Kind über seinen Teller. „Bärenfleisch! Wer wird denn so etwas essen!“
„Blödmann!“ ruft einer. „Weißt du, wie das schmeckt? Du würdest nicht nur den Teller, du würdest auch noch deine Pfoten ablecken!“
Es ist dunkel geworden, als sie aufbrechen. Über dem Wald steht der Vollmond und beleuchtet das weiße Land, so dass sie die Laternen nicht anzuzünden brauchen.
„Der ist ja ganz steif, der Marek“, stellt einer der Männer fest.
„Klar, bei der Kälte!“
Die Wagen holpern und schaukeln, und das Knirschen der Räder klingt viel lauter als am Tage.
Sie sind schon ein gutes Stück gefahren, als Stanislaus sich plötzlich seinen Pelz etwas zurück schlägt und horchend an die Wagentür rückt.
„Was ist los?“ fragt Jendrik.
„Hörst du’s nicht? Die singen.“
„Wer singt?“
„Die Männer beim Marek im Wagen.“
Sie müssen sich anstrengen, um das Lied erkennen zu können. Die Männer, die um den toten Marek hocken, singen ’Alle Menschen müssen sterben, alles Fleisch vergeht wie Heu‘.
„Sie singen für ihn“, sagt Jendrik.
„Ja, ja, für ihn.“
Mit einem Male frieren die Brüder noch mehr. Sie wickeln sich fester in die Pelze ein und ziehen die Decken bis ans Kinn und wünschen, dass die Fahrt bald zu Ende sei.
Sorgfältig notiert die stupsnasige Halina, was Antonya anordnet. Sie steht über den Küchentisch gebeugt und lässt die Zunge spielen, während sie schreibt. Das Häubchen hängt keck auf der Seite, als wäre es allzu hastig auf den Kopf gedrückt worden.
Ihr Busen scheint heute üppiger zu sein als sonst. Liegt es vielleicht daran, dass sie ihr Kleid nicht ganz zugeknöpft hat? Antonya runzelt die Stirn. Seitdem ihr Mann den ganzen Tag im Haus ist, kommt ihr diese Halina noch aufreizender und aufsässiger vor. Ihr Blick, ihre Gesten und ihr Gang wirken herausfordernd. Wenn sie die Gräfin anschaut, verrät ihr Blick Geringschätzung für die etwas ältere Frau. Sogar etwas Triumphierendes meint Antonya erkennen zu können; sie kann sich des Gefühls nicht erwehren, dass diese Person etwas im Schilde führt.
Die Ellbogen auf den Tisch gestützt, fragt die Halina: „Die Soße zum Karpfen – wie wünschen Sie die?“
„Haben wir jemals eine andere gemacht?“ Antonya lässt sich gegen ihren Willen reizen. In ihren Ton ist etwas von Kampf gekommen.
Das kleine Luder soll auf der Hut sein, die wird mich noch kennenlernen, denkt sie. Bedrohlich leise, die Augen zusammengekniffen, fragt Antonya: „Wie kommt es, dass sie nach der Karpfensoße fragen? Wie lange, Halina, sind Sie in diesem Hause?“
Aus Halinas nicht ganz geschlossenem Kleid steigt Röte in den Hals. „Die Mädchen in der Küche sind unsicher und lassen fragen“, rechtfertigt sie sich.
„Wie? Ihr wisst nicht mehr, wie die Karpfensoße in diesem Haus zubereitet wird?“ Sie blickt die Mädchen der Reihe nach an, die plötzlich alle viel zu tun haben. „Ja, dann werde ich auch hier öfter einmal nach dem Rechten sehen müssen!“ „Nein, bitte, das ist nicht nötig. Es wird alles gemacht, wie es sein soll!“ Die Halina ist erschreckt. Sie rafft allen Mut zusammen und meint ein wenig verlegen: „Nicht jeder in diesem Haus, Gräfin, mag Ihre ... mag die Soße.“
„Nicht jeder?“ Antonya ist erstaunt, sie ist so dicht an das Mädchen herangetreten, dass sie deren Körperwärme spürt. Sie riecht, dass Halina ein Duftwasser benutzt hat.
„Wer ist: ’nicht jeder‘, Halina?“
Das Mädchen antwortet nicht, es sieht zu Boden. Die anderen kichern heimlich.
„Noch einmal: Wer ist – ’nicht jeder‘? Antworte!“
Antonya packt sie beim Arm. Und wie sie Halinas Wärme und deren Widerstand spürt, steigt kalte Wut in ihr auf. Sie möchte ihr in das freche Gesicht schlagen. Antonya stößt sie von sich. „Geh und tu, was ich dir sage. Ihr alle! Tut, was ihr zu tun habt! Halina, Ich werde herausfinden, wen du mit ’nicht jeder‘ meinst“, zischt Antonya. „Geh an deine Arbeit. Geh!“
Vorsichtig und lautlos, aber sichtbar erleichtert, verschwindet die Halina aus der Küche.
Forsch, mit unverhohlenem Ärger steigt Antonya die Treppen nach oben und läuft einige Male durch das Zimmer. Das Gehen tut gut, nachdenklich bleibt sie am Fenster stehen. Die Sonne kommt herauf und wischt die Schatten der Bäume und Sträucher aus dem Park. Wieder einmal hat die Halina sie beunruhigt. Wäre es nicht besser, das kleine Miststück aus dem Haus zu jagen? Nein, solange sie bei ihr in Diensten ist, hat sie eine gewisse Kontrolle über das, was die Halina unter diesem Dach zu treiben versucht. Manches mag geschehen, wovon Antonya nichts weiß, aber das eine oder andere wird sie durchkreuzen können, sagt sie sich.
Durch den Park sieht sie ihren Mann kommen. Er geht vornübergebeugt und in Gedanken. Dann ist etwas da, das ihn stehen bleiben lässt und das sein Interesse erregt. Er schaut zum Haus herüber, dahin, wo die Küche ist und macht mit der Hand eine abwehrende Bewegung; dann blickt er prüfend zu Antonyas Fenster hoch. Aber hinter den Vorhängen kann er sie nicht sehen, und hastig läuft er auf den Eingang der Dienstboten zu.
Antonyas Wissen und die wilden, quälenden Vermutungen lassen keinen klaren Gedanken zu. Aber so ist es: immer, wenn sie einen klaren Kopf behalten will, dann wird sie nur noch verwirrter. Antonya ist hilflos und weiß nicht aus noch ein. Ganz bestimmt wird sie alles wieder falsch machen!
Dieses polnische Mädchen reizt sie und macht sie wütend, auch ihr Mann macht sie wütend. Aber am meisten kann Antonya über sich selbst aus der Haut fahren.
Später ist die Halina bemüht, so zu tun, als sei nichts vorgefallen. Und auch Antonya versucht den Eindruck zu erwecken, als wäre die Episode in der Küche ihrerseits vergessen. Wenn da nicht die auffallende Schweigsamkeit zwischen ihrem Mann und dem Mädchen wäre. Was die Halina in Stanislaus’ Nähe zu tun hat, das tut sie mit eisernem Schweigen. Ja, sie wagen es nicht einmal, sich anzusehen. Wenn die Halina ihm etwas zureicht, dann zittern ganz schwach ihre Hände und jedesmal kriecht aus ihrem Kragen eine leichte Röte in ihr Gesicht.
Das bleibt Antonya nicht verborgen; zum Teil verunsichert sie das noch mehr, teils sieht sie ihren Verdacht bestätigt, und wieder steigt Wut in ihr hoch und lähmt sie.
Das Essen heute am Silvesterabend ist ruhig verlaufen. Alles geschah, wie die Hausfrau es angeordnet hatte.
Nach der Mahlzeit ist das Personal in den Salon gekommen, so wie es auch am Abend vor dem Weihnachtsfest gekommen ist und alle Jahre zuvor. Sie haben der Herrschaft und den Gästen ein gutes neues Jahr gewünscht und dafür ihre Hand aufgehalten. Auch die Halina ist darunter gewesen. Und von Stanislaus und Antonya haben sie alle ihr ’Feiergeld‘ erhalten, wie es der Brauch in diesem Hause verlangt.
Mit den Kindern haben die Eltern an diesem Abend ihre Plage; die großen wie die Kleinen zeigen keinen Appetit, sie quengeln und liegen den Müttern in den Ohren, wann es denn endlich an den Teich geht, auf dem sie alle Schlittschuh laufen wollen.
Antonya mag nichts mehr hören, sie wird ungehalten und sagt: eine solche lästige Horde könne sie nicht bis um Mitternacht ertragen. Sie werde ihren Plan dahingehend ändern, dass alle, auch die Cousins und Cousinen aus Zdunska Wola, ins Bett gesteckt würden!
Das wirkt.
Ein leichter Schnee fällt, spärlich und fein wie Staub. Rund um den Teich brennen Fackeln, die an den Ästen der in der Nähe stehenden Bäume und an eigens dafür in den Boden gerammten Stangen befestigt sind. An einigen Stellen knistern Feuer in Eisenkübeln, die ein kreisrundes schwarzes Loch in den Schnee geschmolzen haben. Etwas oberhalb des aus dem Eis herausragenden Steges hat das Personal einen Tisch hergerichtet, auf dem, auf einem stattlichen Stövchen, der Punschtopf dampft.
Die Leute stehen in Gruppen zusammen, beim Tisch steht überwiegend weibliches Volk, das mit Antonya zu tun hat An den Feuern, sich einmal vorne, einmal den Rücken wärmend, sind die Männer, und Stanislaus in ihrer Mitte. Unter ihnen befindet sich die Halina, dick in Tücher gehüllt, so dass sie kaum zu erkennen ist. Die Halina beteiligt sich nicht an den Männergesprächen, sie hört zu, was die sich zu erzählen haben.
Antonya läutet mit einer kleinen, schwer zu hörenden Schelle. Niemand reagiert, erst als einer der Männer „Ruhe mal!“ schreit und in seine Hände klatscht, werden sie auf das Läuten merksam. „Ich möchte mit Ihnen allen anstoßen!“ ruft Antonya. „Bitte, kommen Sie zu mir an den Tisch.“
Schwerfällig setzen sich die Menschen in Bewegung und stellen sich im Halbkreis um die Hausherrin. Ganz hinten, als suche sie irgendwo Zuflucht, steht die Halina, die trotz ihrer Vermummung vor Kälte ganz in sich zusammengesunken ist.
Antonya, die das erste Glas einschenkt, sagt zu den Leuten: „Wer nicht mit Punsch anstoßen will, für den hat mein Mann Wodka und Bier im Korb.“
Die Männer murmeln beifällig und die Frauen stellen sich vor dem Punschtopf auf. Alle sind heiter, lachen und schwatzen durcheinander und stoßen sich wie die Kinder.
„Sie brauchen es nicht bei uns in der Kälte auszuhalten. Wer ins Warme gehen möchte ...“ Antonyas Arm vollführt eine Geste der Entlassung, aber sie bleiben, keiner scheint Lust zu haben, ins Haus zu gehen.
Die Kinder toben mit roten Gesichtern auf der Eisfläche. Antonyas Kinder haben alle Schlittschuhe an den Füßen, mit denen die beiden älteren, die Selma und der Otto, geschickt herumwirbeln und Kreise ziehen. Die kleinen stützen sich gegenseitig, und wenn eins hinfällt, dann liegen sie alle lachend und kreischend auf dem Eis.
Für die Kinder ihres Schwagers hat Antonya durch den Frantizek Schlitten herbeischaffen lassen. Einer ist darunter, der wie eine kleine offene Kutsche gebaut ist, vor die man ein Pony spannen könnte. Aber dafür ist er nicht eingerichtet. An der Rückseite hat er einen geschwungenen Eisengriff, mit dem er wie ein Kinderwagen zu schieben ist. Amalie hat die siebenjährige Martha und die kleine Natalie hineingesetzt, die aber vor lauter Angst zu brüllen beginnt, als die Tür hinter ihr geschlossen wird. Frantizek bugsiert den Schlitten um den Teich, und manchmal lässt er ihn allein von der Böschung gleiten, dass die Schlittschuhlaufenden Kinder auf dem Eis kreischend auseinander stieben.
Auch Antonya und Stanislaus wagen sich später unter die Kinder. Beide sind im Eislauf geübt, ganz besonders Antonya. Sie hat, als sie vom Personal Beifall bekommt, für eine kurze Zeit die Eisfläche für sich allein. Sie dreht Pirouetten und wagt sogar schon einmal einen Sprung, dabei hält sie den Muff weit von sich gestreckt und rafft mit der freien Hand den langen Mantel ein wenig in die Höhe.
Sie scheint Gefallen am Eislauf und am Applaus gefunden zu haben, denn sie mag gar nicht mehr aufhören.
Hinter dem Tisch stehen sich Stanislaus und die Halina gegenüber. Als der Mann sein Glas abgestellt hat, nimmt es das Mädchen und dreht es bis zu der Stelle, von der er getrunken hat. Ohne auf die Leute zu achten, die ihr dabei zusehen, hebt sie das Glas mit dieser Stelle an ihre Lippen und prostet ihm zu.
Das ist Antonya nicht verborgen geblieben; mitten im Lauf bleibt sie stehen, dann steigt sie wackelig und vorsichtig die Böschung hinauf und hält einem dürren, blaugefrorenen Mann ihre Füße hin, dass der sie von den Schlittschuhen befreie.
„Ich brauche etwas zu trinken!“ ruft sie. Und, als ihr ein Glas Punsch gereicht wird, wendet sie sich überaus leise und sanft der Halina zu: „Halina.“ Antonya deutet auf das Glas, aus dem die Halina gerade getrunken hat.
Das Mädchen tut, was die Frau wünscht.
„Schmeckt dir der Punsch, Halina?“
Halina sieht sie belauernd an und nickt.
„Gut, Dann trinke auch mit mir, Halina?“
„Ich habe gerade getrunken“, flüstert das Mädchen.
„Vielleicht nicht genug. Du solltest mehr trinken. Ich weiß, dass du mehr möchtest, und auch mehr verträgst, Halina! Na zdrowie!“
Antonya sieht, dass ihr Mann sich zum Haus hin entfernt; sie möchte ihm hinterherschreien, was er für ein feiger Kerl sei, wenn er sich aus dem Staube macht und das Mädchen allein lässt, wenn sie mit ihm abrechnen möchte.
Sie blickt dem Mädchen ins Gesicht. „Ein hübsches Gesicht hast du“, zischt sie. „Aber es ist ein dummes, ein freches und gewöhnliches Gesicht, Halina, so dass ich mich wundere, dass ein Mann ... mein Mann daran Gefallen finden kann, denn ich weiß, dass er alles Gewöhnliche verabscheut!“
Antonyas Finger umklammern das heiße Glas, dass sie es kaum halten kann.
’Es wäre mir ein Genuss‘, denkt sie, ’dir dieses hier mitten in deine Visage zu schütten, so heiß wie es ist!‘
Plötzlich gießt sie den Punsch dem Mädchen vor die Füße, dass ihre Schuhe und der Rock bespritzt sind.
„Merke dir das: da bringe ich dich hin: da in den Dreck.“
Antonya deutet mit dem Kinn auf den dunklen Fleck im Schnee. „Glaube nicht, dass ich keine Augen im Kopf habe! Ich sehe mehr, als dir lieb ist! Unterschätze mich nicht, du ...“ Sie sieht sich nach ihrem Mann um, aber Stanislaus ist verschwunden. Dann wendet sie sich ab und geht zu ihren Kindern, die wieder über das Eis tollen.
Amalie hat von Antonyas Ausbruch nichts mitbekommen, sie ist mit deren Kleinen, Ottilie und Ludwig, und mit ihren eigenen Kindern vor längerer Zeit schon ins Haus gegangen, um sie ins Bett zu bringen.
Später entdeckt Antonya auch wieder ihren Mann. Er steht bei den Männern und scheint ihnen irgendetwas zu erklären. Denn sie hören aufmerksam und mit gesenktem Kopf zu.
Von der Halina ist an diesem Abend nichts mehr zu sehen.
„Wir können nicht bis Mitternacht hier draußen bleiben“, kommt Stanislaus an sie heran. „Lass uns hineingehen. Die Kälte bringt uns alle um.“
„Was ist es, das dich mit einem Male von hier wegzieht? Ist sie es?“
„Tonya, ist es meine Schuld, wenn das verrückte Ding sich Flausen in den Kopf setzt?“ brummt der Mann.
„Flausen nennst du das? Ich denke, mein Lieber, dass diese Flausen nur deshalb gedeihen können, weil du ein guter Boden dafür bist. Seit wann benutzt du den Dienstboteneingang, Stanislaus? “
„Lass uns später darüber reden, Tonya, wenn wir allein sind. Sollen die Leute sich das anhören, was wir bereden? Nicht hier, Tonya, und nicht an diesem Abend.“
„Du fragst doch sonst nicht danach, ob andere euretwegen Stielaugen bekommen oder ihre Ohren spitzen, wenn ihr euch sicher fühlt, wenn ihr eure Köpfe zusammensteckt. Alle hier wissen, was los ist! Und ich, Stanislaus: ich bemerke mehr, als du ahnst.“
„Bitte, Tonya, bitte ...“ Er nimmt ihre Hand, als wollte er sie streicheln, aber es geschieht nichts. Er hält sie nur, ihre feste und in den dicken Handschuhen unerreichbare Hand. Er sagt: „Oft habe ich das Gefühl, ersticken zu müssen.“
„Du?“ höhnt die Frau erstaunt und schüttelt verständnislos den Kopf, und sie schiebt den Mann, als ekele er sie an, mit einem Stoß von sich und wendet sich der Männergruppe zu.
Stanislaus hört, dass sie den Leuten, die es bis jetzt noch in der Kälte bei ihnen am Teich ausgehalten haben, Anweisungen gibt.
Müde, mit hängenden Schultern, geht sie danach mit Jendrik ins Haus.
Als die Glocken das neue Jahr einläuten, steht Stanislaus am Fenster seines Arbeitszimmers. Er hat es eine handbreit geöffnet, um diese Geräusche hören zu können, die nur in dieser einen Nacht des Jahres zu hören sind. Sein Kopf ist voller Gedanken, aber er könnte nicht sagen, was das für Gedanken sind, die ihn durcheinanderbringen; er hat wohl zu viel Punsch und Wodka getrunken.
Seine linke Gesichtshälfte, seine Schulter beginnen unter dem Luftzug, der durch den Spalt weht, zu schmerzen. Jetzt hat er zu lange am Fensterspalt gestanden. Auf den Straßen lärmen die Menschen immer noch.
Wie ein Geschlagener tappt er zur Chaiselongue, um sich schlafen zu legen.
Er hört, wie oben im Zimmer seine Frau auf und ab geht.
Die Sonne steht schräg und lässt den Schnee glitzern, so dass es in den Augen sticht. Alle Erdmanns sind heute mit den Pferdeschlitten unterwegs. Im ersten sitzen die Brüder Stanislaus und Jendrik und die größeren Kinder, ihnen folgen, in einem gepolsterten und luxuriösen Schlitten, die beiden Frauen mit den Kleinen. Amalie hat sich die Zwillinge unter die Pelzdeckegesteckt. Sie sind den gleichen Weg gefahren, den die Männer zuvor für die Bärenjagd gewählt haben. Hier draußen bläst ein schneidender Wind aus Nordost und zwingt sie, noch tiefer in die Pelze zu kriechen. Auf ebener Strecke springt schon einmal eins der großen Kinder, der Otto und auch der Berthold, ab und läuft, von schrillen Zurufen begleitet, neben dem Schlitten oder den Pferden her.
„Passt auf“, ruft Stanislaus ihnen zu. „Hinter einer Schneewehe oder in einem zugeschneiten Erdloch könnte ein Bär oder ein Luchs lauern! Ihr wisst ja, was der mit übermütigen Kindern macht? Er frisst sie mit ihren Pelzen und Schuhen!“ Wenn ihnen Angst eingejagt wird, dann schwillt das Geschrei und Gequieke an und sie sehen zu, dass sie schnell wieder auf den Schlitten kommen.
Auch der Frantizek lässt sich von der Ausgelassenheit der Kinder anstecken. Er wirft seine Pelzmütze in die Luft und lässt dazu einen scharfen schrillen Pfiff hören, der die Pferde veranlasst, sich in noch wilderem Galopp ins Zeug zu legen. Dann schießt der Schlitten nach vorn, dass sie alle aneinanderstoßen oder gar von den Sitzen rutschen.
„Bei euch, Schwägerin, gibt es wohl keine Schwierigkeiten?“ fragt Antonya.
„Du meinst, zwischen Jendrik und mir?“
„Ja, das meine ich. Bei euch, so hat es den Anschein, geht es friedlich und beinahe ohne die sonst üblichen Reibereien und Streitigkeiten ab.“
„Es ist das Alltägliche, Schwägerin, wie es in den meisten Ehen vorkommt.“
„Alltäglich? Was sind alltägliche Schwierigkeiten? Das, was bei mir mit Stanislaus üblich ist, das ist vielleicht bei anderen die Hölle. – Bei dir, denke ich, könnte es die Hölle sein!“
Amalie ahnt, was die Schwägerin anspricht. Was soll sie dazu sagen? Sie macht sich mit den Kindern zu schaffen. Sie möchte nicht über Dinge reden, von denen man zu niemandem spricht, Dinge, die jeder besser für sich behält. Amalie fühlt sich überfordert, wenn die Schwägerin diese Seiten ihres Lebens aufschlägt. Solche Offenbarungen machen sie rat- und hilflos und verwirren sie.
Ja, sie hat von Frauen gehört, die plötzlich durch einen Vorfall nicht mehr bereit waren zu schweigen und zu tragen, was ihnen kein anderer abnehmen konnte. Solche Frauen machten andere zu Mitwissern, und deren Ehe wurde dadurch durchsichtig. Das ist, als müsste man nackt durch die Stadt laufen, so kam ihr das vor.
Sie spürt Antonyas Blick, die etwas von ihr erwartet, wenn schon keine Antwort, dann doch eine Geste. Ihr wird unbehaglich in der Nähe der Schwägerin, aber sie muss es aushalten. Schließlich sagt sie so hin: „Antonya, wo gibt es die Ehe, die wir uns als junges Ding erträumt haben? In Büchern, ja, da soll es so etwas geben. Aber im Leben? Im Leben ist das doch ganz anders ...“
„Kennst du Angst?“ fragt Antonya.
„Angst? Welche Angst meinst du?“
„Von der Angst vor allen Kreaturen, die Röcke tragen und vor den Männern mit den Hüften wackeln, Schwägerin. Es wird dir doch nicht entgangen sein, dass die Halina, diese kleine unverschämte Schlampe, meinem Stanislaus nachstellt. Und das ohne jede Vorsicht! Sie nimmt sich nicht einmal vor mir in Acht!“
„Warum ist sie dann noch im Haus?“
„Weil ich sie unter meinem Dach einigermaßen im Auge habe. Werfe ich sie hinaus, dann habe ich keine ruhige Minute, wenn Stanislaus in der Stadt oder sonst wo zu tun hat.“
„Und er? Ich meine, Stanislaus?“
„Stani? Der fühlt sich geschmeichelt. So junges Gemüse ... Stani will nur eines: erkunden, ob unter den Röcken dieser Proletenweiber etwas anderes versteckt ist, etwas Neues, das er nicht kennt.“
Sie schweigen vorerst, und jede schaut nach einer anderen Seite ins Land.
Antonya beginnt wieder: „Das Schlimme ist, dass man so allein ist ... Es gibt keinen Menschen, zu dem ich davon sprechen kann. Meinen Eltern darf ich damit nicht kommen. ‚Du hast ihn genommen’, sagen sie, ‚und damit hast du auch alles andere genommen.’ Ja, so wird es wohl auch sein: es ist allein meine Last.“ Sie greift nach der Hand der Schwägerin. „Ich hoffe, in dir, Amalie ...“ Antonya spricht nicht aus, was sie sich von Amalie erhofft.
Ohne dass sie es wahrgenommen haben, haben die Schlittenlenker den Rückweg eingeschlagen.
Vor dem Haus werden Stanislaus und Antonya von einem Haufen aufgeregter Leute erwartet; es sind vor allem die Frauen aus der Küche, die palavernd neben dem Schlitten des einfahrenden Hausherrn her laufen und ihn umringen, so dass Stanislaus Mühe hat auszusteigen. Die Halina ist nicht unter ihnen, und das, so meint Antonya, sei verdächtig. Stanislaus, der beim Vorfahren des Schlittens der beiden Frauen herbeigeeilt ist, um ihnen und den Kindern beim Aussteigen zu helfen, raunt seiner Frau zu: „Unannehmlichkeiten. Geh in die Bibliothek und warte auf mich.“
„Was gibt’s denn?“
„Später, später ... Warte in der Bibliothek ...“
Und damit läuft er zu den Ställen hin.
Über die Schulter ruft er dem Bruder zu: „Jendrik, geh mit Amalie und allen Kindern in den Salon! Wir kommen gleich nach!“
Beunruhigt, nervös geworden geht Antonya vor den Bücherschränken auf und ab. Mit meiner Unruhe hat die Halina zu tun, sagt sie sich. Das Luder will sich rächen und hat sich eine Hinterhältigkeit ausgedacht! Was findet Stanislaus nur an diesem pummeligen und gewöhnlichen Weibsbild? In wenigen Jahren ist die eine fette, eine trampelige Wachtel, die kommandiert und schreit und Teller an die Wand wirft!
Antonya betrachtet ihr Spiegelbild in den langen Glasscheiben. Eine schlanke, aufrechte und gepflegte Frau blickt sie an, der die Männer zu Füßen liegen könnten, wenn sie es darauf anlegte. Weiß ihr Mann überhaupt noch, dass sie gut aussieht und manche der ersten Frauen der Stadt, mit der sie Umgang pflegen, in den Schatten stellt?
Halina! Wenn sie doch dieses Mädchen ans Ende der Welt oder auf eine Insel wegschaffen könnte! Was mag die sich ausgedacht haben? Draußen, bei den Frauen, ist sie nicht zu sehen gewesen. Sollte die vielleicht versucht haben, sich selbst oder einem anderen etwas anzutun?
Bei der Tür bleibt sie stehen, sie möchte in das Treppenhaus hinaussehen, weil sie unten verhaltene Stimmen hört, aber dann setzt sie sich mit klopfendem Herzen in einen Sessel, die Hände im Schoß, und wartet.
Es dauert nicht lange, und leise wird die Tür geöffnet, nur ein wenig, und in dem Spalt erscheint Stanislaus, und hinter ihm taucht ein herabgekommener und stoppelbärtiger Mann auf in einem Mantel, der über den Boden schleift; sein Gesicht hat er unter einer zu großen Mütze versteckt.
„Hier“, sagt Stanislaus, „diesen Menschen haben sie bei den Ställen erwischt. Ein Dieb! Vielleicht ein Halsabschneider!“ brüllt er durchs ganze Haus. „Der hat es wohl auf Geld oder Schmuck oder sonstwas abgesehen!“ Stanislaus schiebt den Mann ins Zimmer, so dicht vor Antonya, dass der fast ihre Fußspitzen berührt. Nachdem er die Tür zugedrückt hat, fragt er mit gedämpfter Stimme: „Erkennst du ihn nicht?“
Der Fremde grinst auf die Frau herab; er zittert, als wäre er wirklich bei etwas Verbotenem erwischt worden.
„Wer ist das?“ fragt sie.
„Tonya ...“, flüstert der Fremde. „Tonya ...“
Sie steht auf, um sein Gesicht besser sehen zu können; argwöhnisch starrt Antonya ihn an, dann stößt sie plötzlich einen leisen Schrei aus. Sie ist kreideweiß geworden und geht ein paar Schritte rückwärts und fällt vor Schreck in den Sessel zurück.
„Krystian?“ stammelt sie. „Krystian ... Barmherziger Gott!“ Der Fremde grinst sie weiter an und nickt. Er nickt immerzu, als könnte er gar nicht damit aufhören. Plötzlich reißt er seine Mütze vom Kopf und wirft sie auf den Boden und ergreift ungestüm ihre Hand. „Tonya“, flüstert er wie eben. „Tonya, Tonya ...“ und küsst ihre Hand.
„Krystian, wo kommst du her?“ fragt sie wie benommen und schlägt ihre Zähne in die Faust.
Er hebt die Achseln. „Von überall und nirgends ...“
„Von überall und nirgends“, wiederholt sie, als wäre sie nun im Bilde. Sie hat sich wieder erhoben und ist ein wenig zur Seite getreten, aus angstvollen Augen betrachtet sie den Bruder und schüttelt immerzu ungläubig den Kopf.
„Wie du aussiehst!“
„Erschreckend, nicht wahr? So ist es, wenn man die Gesellschaft wechselt, Schwester.“ Wieder nimmt er ihre Hand, um sie auf seine Brust zu drücken, auf diesen zerschlissenen und verdreckten Mantel. „Tonya, ich brauche Hilfe.“
„Hilfe, ja ... Brauchst du ein Versteck?“ fragt sie.
Wieder nickt der Mann.
„Wie sollen wir dich hier verstecken, Krystian? Unsere Leute wissen, dass du hergekommen bist?“
„Die meisten wissen es“, antwortet ihr Mann. „Aber sie haben ihn für einen Einbrecher gehalten und eingesperrt. Weißt du“, sagt Stanislaus nach kurzem Überlegen, „wir sagen ihnen, er sei wirklich ein Einbrecher ...“
„Den wir so mir nichts, dir nichts einfach wieder laufen lassen?“ Über Antonyas Nasenwurzel erscheinen die scharfen steilen Falten, die sie immer dann bekommt, wenn sie angestrengt nachdenkt, oder wenn sie unwillig oder böse wird.
„Lass mich das machen“, rät Stanislaus, der sich insgeheim darüber freut und eine gewisse Genugtuung verspürt, seine Frau nach dem Streit wegen der Halina in dieser misslichen Lage zu sehen und ihr helfen und beistehen zu können, und außerdem wird sie die Sache mit dem Küchenmädchen vergessen. Er sagt: „Ich werde den Krystian fürs erste in der Fabrik unterbringen. Dann werden wir weitersehen.“
„Wissen die Eltern, dass du hier bist?“ fragt Antonya.
Der Mann lächelt sie an. „Aber nein. Wie könnte ich sie in Gefahr bringen? Die wissen nichts von mir! Gar nichts. Die halten mich doch für tot, glaube ich. Oder sie denken, ich sitze im Zuchthaus, oder ich bin in der Verbannung.“
„Was hast du denn diesmal angestellt, Krystian?“
Wieder lächelt er. „Was ich tun muss, Tonya, das weißt du doch. Eine Sache, die jedem guten Polen zur Ehre gereicht, wenn sie gelingt, Tonya. Wenn du es wissen willst: eine Bombe auf den Großfürsten geworfen. Leider ging es daneben, leider.“
„Du großer Gott! Warst du allein?“
„Allein, Tonya, sind wir nicht, weil wir allein nichts sind. Wir Polen sind nur stark, wenn wir uns vereinigen und auf unser Ziel einschwören. Alle Polen müssen sich vereinigen und für die heilige Sache kämpfen, Tonya. Nicht nur die Jungen. Nicht nur die Intellektuellen, Tonya, alle ... Hörst du: alle!“
Antonya winkt ab. Sie ist dicht an den Bruder herangetreten, dass einer den Atem des anderen spürt. Sie reckt sich auf die Zehenspitzen und drückt wie eingeschüchtert einen Kuss auf Krystians Stirn.
„Krystian“, sagt sie leise, und dabei nimmt sie sein stoppeliges Gesicht in die Hände. „Krystian, Krystian, wie unselig, dass du von solchen Gedanken besessen bist! Vielleicht reibt ihr euch vergeblich auf, und euer Leben opfert ihr auch vergeblich. Glaube mir, die Zeit wird das lösen, was ihr nicht lösen könnt. Du machst nicht nur dich unglücklich, Krystian, du machst uns alle unglücklich. Unsere Eltern leiden. Sie werden darüber sterben, Krystian ... Wo du gehst, da ziehst du eine Blutspur. Das wird dich verderben, das wird deine Genossen verderben und auch uns. Was habt ihr dann erreicht?“
Und plötzlich schlingt sie ihre Arme so wild um seinen Nacken, dass der Mann erschreckt zurückweicht.
„Ein Versteck, Tonya, nur für diesen Tag. In der Dunkelheit werde ich wieder verschwinden. Helft mir, nur dieses Mal.“
„Damit, dass du hier aufgetaucht bist, hast du uns in eine schlimme Sache hineingezogen, Krystian.“
Krystian hebt die Schultern. „Ja, ich weiß, ich weiß. Was soll ich denn machen, Tonya?“
„Wir müssen etwas tun“, mahnt Stanislaus. „Wegen der Leute müssen wir etwas tun! Komm, Schwager, ich bringe dich in ein Versteck. – Hier hat dich niemand erkannt. Ich werde dich wie einen Schurken, wie einen erwischten Dieb aus dem Haus fahren und allen sagen, dass ich dich der Polizei übergeben werde. Und du, Tonya, sagst es ihnen auch. Komm, Krystian!“
„Tonya, leb wohl! Leb wohl. Grüße die Eltern von mir. Es wird sie freuen, dass du mich lebend gesehen hast. Leb wohl ...“
Stanislaus fasst Krystian beim Handgelenk und führt ihn aus dem Haus. Antonya hält ihn verzweifelt am Arm fest, sie schlingt, als er sich losmachen will, wieder ihre Arme um seinen Nacken und weint laut auf.
„So sei doch vorsichtig!“ mahnt ihr Mann. „Wenn dich jemand hört!“
Der Krystian biegt ihre Arme wie bei einer Puppe nach unten und drängt sich an seinem Schwager vorbei ins Treppenhaus.
Antonya blickt ihnen von der Treppe nach, bis die Tür ins Schloss fällt. Dann geht sie über den Flur, um mit Amalie und Jendrik über diese Angelegenheit zu sprechen.
Vor dem Salon zögert sie. Soll sie, so benommen wie sie sich fühlt, zu den Verwandten gehen? Was soll sie denen sagen?
Sie hört die Kinder, sie hört auch gedämpfte Gesprächsfetzen der Erwachsenen. Zittern überfällt sie; wenn sie doch weggehen und für sich allein sein könnte. Sie öffnet die Tür, ohne es gewollt zu haben.
„Was ist denn passiert?“ ruft Amalie. „Antonya, wie du aussiehst! Was ist denn?“
„Der Krystian“, stammelt sie. „Er ist hergekommen. Nein, er ist gegangen ...“
„Der Krystian?“ fragen beide. „Dein Bruder?“
Antoniya nickt und lässt sich gegen die Wand fallen.
„Warte mal!“ Amalie steht auf, um die Kinder aus dem Zimmer zu bringen.
Jendrik nimmt ihre Hand und streichelt sie. „Es kann nur gut sein, wenn die nicht alles mit anhören“, sagt er und rückt der Schwägerin einen Stuhl hin. „Setz dich, du bist ja wie vor den Kopf geschlagen. Nein ... Also der Krystian ...“ murmelt er fassungslos.
Amalie ist schon eine Weile wieder bei ihnen, da beginnt Antonya stockend zu erzählen. Sie berichtet, wie sie ihn nicht erkannt habe, wie er aussieht, wie besessen er immer noch von dem Gedanken ist, für Polen zu kämpfen.
„Nicht nur zu kämpfen!“ ruft sie. „Zu sterben! Mit den anderen! Er hat ein Attentat auf den Großfürsten versucht, dieser Idiot! David gegen Goliath! Wird das was ändern? Nichts! Ich sage: nichts! Es wird die Situation nur verschlimmern!“
Antonyas Betroffenheit, ihre Angst um den Bruder schlägt in Wut um. Ihre Hände knetend läuft sie durch den Salon. „Was können wir tun? Nichts! Wir können nur hinsehen oder wegsehen. Ein Besessener ist nicht zu retten! Nein, er muss an seiner Besessenheit zugrunde gehen.“
Sie bleibt vor den Verwandten stehen. „Bedenken die Schufte denn nicht, dass ihr Treiben auch über Andere Leid bringt? Oder Unglück? Unsere Eltern ... Die dürfen nichts erfahren. Er will, dass ich sie grüße! Für die Alten ist er schon lange tot! Grüßen ... Kein Wort werde ich davon sagen! Jetzt nicht. Vielleicht später. Aber das weiß ich noch nicht!“