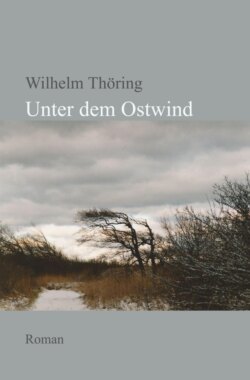Читать книгу Unter dem Ostwind - Wilhelm Thöring - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 4
ОглавлениеDas erste Gespann mit einem Webstuhl ist aus Lodz angekommen.
Es ist ein klarer, ein warmer erster Junitag, und die Luft ist noch erfüllt vom Geschwirr und Gesang der Vögel. Im Westen drängen Haufenwolken über den Horizont. Sie machen das Land klein und heben den Himmel weit hinauf. Die Kastanien, die Erdmanns Haus umstehen, leuchten mit ihren Blütenkerzen, und die Birken färben sich in ein satteres Grün. Die Straße ist leer heute, jeder hat bei diesem prächtigen Wetter im Garten oder im Feld zu tun. Nur ein paar Hunde lungern an den Zäunen entlang. Als aber das Fuhrwerk mit seiner aufsehenerregenden Ladung über den staubigen Schotter knirscht, werden die Menschen neugierig, sie lassen alles stehen und liegen und schließen sich dem Wagen an, um zu sehen, bei wem der Webstuhl abgeladen wird.
„Ja, Jendrik, willst du dir eine Fabrik bauen? Du hast doch mehr Webstühle als wir.“
„Ja, ja, aber sie genügen mir nicht!“ lacht er. „Ich mache es wie in der Kinderstube: ist etwas zu klein geworden, dann wird ganz einfach angestrickt!“
„Er will ein feiner Herr werden wie sein Lodzer Bruder!“ bemerkt ein anderer.
„Das gute Land hinter deinem Haus, Jendrik! Willst du alles zubauen?“
„Jetzt, da der Alte tot ist, wird alles umgekrempelt. Ja, ja, so machen es die Jungen! Sie haben doch keinen Respekt vor dem Erbe der Väter.“
„Wer macht das nicht? Habt ihr es anders gemacht, als euch das Erbe eurer Väter zugefallen ist? Ich sehe, dass sich Haus für Haus verändert, dass es sich vergrößert hat!“, antwortet Jendrik ihnen ruhig, ohne sich herausfordern zu lassen, und stößt das Tor zum Hof auf, dass die paar Hühner, die da herumlaufen, aufgescheucht und gackernd durcheinander fliegen und die kleine Natalie so sehr erschrecken, dass sie laut zu schreien anfängt.
Jendrik setzt das verängstigte Kind auf der Schwelle des Hauses nieder, wo es von der Adelheid in den Arm genommen und beruhigt wird.
„Der erste Webstuhl ist angekommen“, erklärt er seiner Frau, die das Geschrei des Kindes und die Erörterungen der Leute auf der Straße herbeigerufen hat.
„Malchen, schick mir den Witold heraus!“
Jeder Arm ist wichtig, sie müssen alle mit anfassen, um den Webstuhl von dem Fuhrwerk zu bekommen. Auch der Älteste, Berthold, wird herausgerufen, um zur Stelle zu sein, wenn er gebraucht wird. Die Unruhe auf dem Wagen hinter ihnen, das Fluchen der Männer, die Rufe und Schreie machen die Pferde nervös, sie wollen mitsamt dem Fuhrwerk und den Männern darauf die Flucht ergreifen.
„So bindet den Gäulen doch die Beine zusammen, zum Kuckuck!“ schimpft einer. „Die gehen durch! Und dann wird es ein Unglück geben.“
Jemand bindet den Tieren die Vorderbeine zusammen, das macht sie aber noch unruhiger. Bei jedem etwas lauteren Geräusch gehen sie mit dem Hinterteil in die Höhe und treten gegen Wagen und Deichsel.
Amalie sieht von der Tür aus zu. Sie trägt die immer noch schluchzende Natalie auf dem Arm, nein, sie hat sie eigentlich mehr auf ihrem unförmigen Leib sitzen.
„Was sucht denn der Berthold dazwischen?“ fragt die Mutter. „Wie kann der dabei nützlich sein?“
Sie bekommt keine Antwort, weil niemand sie beachtet.
Jendrik hat angeordnet, dass glatte Baumstämme an der Rückseite des Wagens befestigt werden, auf denen der Webstuhl zu Boden gleiten soll. Vorsichtig bugsieren die Männer ihn dahin, sie hebeln mit Stangen und sie schieben ihn und halten ihn an den Seilen, die sie um den Webstuhl geschlungen haben. Zentimeter für Zentimeter bewegen sie ihn auf die glattgeschälten Baumstämme zu.
„Alle auf den Wagen!“ brüllt Jendrik. „Alle an die Seile! Alle, hab ich gesagt! Vorsicht da unten! Fertig?“
„Fertig!“ rufen die anderen.
„Gut, dann los: eins, zwei, drei ...“
Der Webstuhl liegt auf den schrägen Stämmen, ohne sich zu rühren.
„Wir müssen eine glattere Bahn haben. Sag, Jendrik, sollen wir den Wagen und die Stämme nicht mit Seife oder Fett einschmieren? Dann flutscht das Ding von alleine“, rät einer der Männer.
Jendrik blickt den Mann an, wie er die Kinder anschaut, wenn sie Unsinn reden; stattdessen kommandiert er: „Drückt doch mit einer Stange nach! Aber vorsichtig! Nein, hier, an dieser Seite.“
Unten zwischen den beiden Baumstämmen, auf denen der Webstuhl zu Boden gleiten soll, taucht plötzlich der Berthold auf; er zeigt nach oben und ruft: „Der Webstuhl hängt an einem Ast fest! Hier vorne!“
„Was sucht denn der Bengel da? Mach, dass du da unten fortkommst!“ brüllt der Vater außer sich.
In diesem Augenblick hören sie etwas wie ein Aufstöhnen. Einer der beiden Stämme gibt nach, es knackt und reibt und der Webstuhl donnert nach unten und zieht die Männer an den Seilen vom Wagen herunter.
„Berthold!“ schreit Amalie. „Bertel! Großer Gott ...“
Fast hätte sie die Natalie vom Arm fallen lassen, wenn die Adelheid es ihr nicht abgenommen hätte. Sie läuft, so schnell sie mit ihrem dicken Leib laufen kann, in das Knäuel der übereinander liegenden Männer.
„Bertel!“ schreit sie.
„Mutter, hier ...“ Der Junge taucht seitlich unter dem Wagen auf. „Es ist nichts passiert, Mutter ...“
„Du, du ...“ Amalie ist vor Schreck kreideweiß geworden. Sie befühlt seine Schultern, seine Arme und streicht über seinen Kopf.
Und plötzlich holt sie aus und schlägt ihn mehrmals links und rechts ins Gesicht, und dabei schreit sie: „Wie kannst du nur, du verdammter Satan! Willst du dich umbringen? Oder willst du mich umbringen? Mich so zu erschrecken!“ Und immer noch ohrfeigt sie den Jungen und schüttelt ihn, dass er hin und her fliegt.
Doch plötzlich schlägt Amalies Laune um; zusammengesunken und überwältigt kniet sie vor ihm nieder, umschlingt seinen Körper und reißt den sich windenden Jungen an sich.
„Bertel, mein Bertel, warum tust du mir das an?“
„Malchen, dein Mann ... Er blutet!“ ruft jemand aus dem Haufen.
Jendrik rappelt sich auf die Beine. Er hält den rechten Arm an sich gepresst. Der Ärmel ist aufgerissen, die Frau kann eine lange, stark blutende Wunde sehen.
„Was ist passiert. Jendrik!“ ruft sie entsetzt.
„Nichts. Ein Riss. Etwas Blut ...“
Sie läuft nach einem Lappen, den sie um den verletzten Arm wickelt. „Du brauchst Hilfe.“
„Nein“, wehrt der Mann ab. „Ein Riss, sage ich. Nichts weiter. In zwei, drei Tagen ist das vergessen. Ich spüre ihn nicht einmal.“
„Der Junge wäre beinahe erschlagen worden“, klagt sie unter Tränen und wendet sich ab, dass keiner der Fremden ihr Gesicht sehen kann.
„Der Schreck war Lehrgeld genug. Er hat’s begriffen.“
„Jendrik, du weißt, was mir oft in den Sinn kommt. Ob das etwas zu bedeuten hat?“
„Aber!“ Der Mann lacht sie an und tätschelt ihr vor allen Männern die Wange. „Ein kleines Malheur ... Ach was! Eine Nichtigkeit, nicht mehr. Nun mach dir nicht wieder schwere Gedanken! – Männer!“ ruft er in die Runde. „Darauf müssen wir uns einen Wodka genehmigen!“ Als sie ihn alle mit ihren Gläsern umstehen, fragt er seinen Gehilfen: „Witold, und du?“
„Nun, einen kleinen möchte ich schon auf Euer Wohl trinken, Meister.“
„Ich habe mit dir meine Pläne, Witold.“
Der Gehilfe macht ein ratloses Gesicht, dann wird er verlegen und bekommt rote Ohren, als wollte der Meister ein Geheimnis preisgeben.
„Wenn du alles begriffen hast, wenn du gelernt hast, was du als guter Weber wissen musst, dann, Witold, sollst du bei mir der erste Mann werden!“, sagt Jendrik, und jeder, der auf dem Hof ist, kann es hören.
Dem Jungen glühen die Ohren noch mehr, man könnte glauben, sie schwellen an und wollen gleich platzen, und vor Aufregung beginnt seine Hand zu zittern, dass er etwas vom Wodka verschüttet.
„Magst du darauf mit mir trinken, Witold?“
Der Junge nickt.
„Gut. Na, dann – Na zdrowie!“
„Auf Euer Wohl, Meister.“
Später sagt Amalie ihm, dass die Zwillinge so merkwürdig geworden seien. Sie erbrechen oft, und immer, wenn sie sie hochnehme, dann seien sie heiß wie frischgebackenes Brot aus dem Ofen.
„Sie haben Fieber“, sagt er. „Hast du keinen Holundersaft mehr?“
„Nein. Ich habe im letzten Jahr keinen Holunder pflücken können. Du weißt, dein Vater ...“
„Dann solltest du in die Stadt gehen und Rat holen.“
„Jendrik, da ist noch etwas“, sagt sie. „Auch in mir rumort und brennt etwas, das mich krank macht. Zuerst habe ich geglaubt, dass die Zwillinge es von mir bekommen hätten. Aber ich stille sie lange nicht mehr.“
„Bei dir, Malchen, wird das von der Schwangerschaft kommen. Und die Kleinen, die werden sich schon wieder erholen. So kleine, so schwächliche Kinder wie die Zwillinge, die kränkeln leichter als die robusten.“
Die Frau gibt sich damit zufrieden. Sie wird noch ein paar Tage warten. Vielleicht erholen die Kleinen sich, und alle Sorge ist umsonst gewesen. Wenn sie aber wieder einmal mit der Frau Pastor Wohlgethan zusammentrifft, dann wird sie sich von ihr Rat holen. Man sagt, dass sie eine wissende und in Krankheiten erfahrene Frau sei, obwohl sie noch so jung ist, und dass sie schon so manchem Ratsuchenden geholfen habe. Außerdem verstehe sie sich auf allerlei Kräuter. Im Osten, so munkeln welche, habe sie eine leitende Stellung in einem Krankenhaus gehabt. Die Frau des Pastors, davon ist jetzt mancher überzeugt, der sie näher zu kennen glaubt, sei ein wahrer Segen für die Gemeinde.
Vier Tage später standen die beiden anderen Webstühle in Erdanns Haus; um beim Abladen keine Schwierigkeiten wie beim ersten Male zu haben, hat Stanislaus gleich eine Rotte von Arbeitern, wie er es nannte, mitfahren lassen. Es sind durchweg Polen gewesen, etwas unterwürfige und freundliche Männer, die mit den Kindern scherzten und der Hausfrau mit Ehrerbietung begegneten. Jedoch waren für die Arbeiter diese Erdmanns in Zdunska Wola ebenfalls Grafen und vornehme Leute, vielleicht nicht ganz so vornehm wie jene, in deren Diensten sie stehen. Denn diese Erdmanns bewohnten keine Villa, sondern nur ein behäbiges großes Bauernhaus, dessen Dach mit Stroh gedeckt ist und nicht mit roten Ziegeln, die man zu einem hübschen Muster legen kann.
Manchmal lugte einer von ihnen durch die Tür, wo es für ihn ungewöhnliche Dinge zu entdecken gab. Und als Amalie sie am Nachmittag zur Vespermahlzeit ins Haus bitten wollte, da lehnten sie es ab.
„Mit diesen Füßen“, erklärte einer von ihnen und streifte seinen Galoschen ab, um ihr seinen erdigen und schwieligen Fuß zu zeigen, „mit diesen Füßen – nein, mit solchen Füßen mögen wir nicht in Euer Haus kommen.“
„Du brauchst die Schuhe nicht auszuziehen“, sagte Amalie.
Der Mann blieb fest. Er winkte lachend ab. „Nein, nein, mit Schuhen kommen wir erst recht nicht in diese feine Stube. Das machen wir nicht! Wir sind nur ganz einfache Leute, und tragen Euch Schmutz ins Haus.“
Sie hockten sich an die Hauswand und aßen da, und Erdmanns Kinder standen daneben und sahen zu.
Diese zusätzlichen Webstühle haben das Leben in Erdmanns Haus verändert. Es ist lauter geworden, und die neuen Weber, die Jendrik geworben hat, sind polnische Arbeiter, wie er sie bei seinem Bruder an den Maschinen gesehen hat. Es ist für ihn nicht leicht, die Männer anzulernen, denn anfangs haben sie nicht begriffen, was von ihnen erwartet wurde. Ihre Ungeschicklichkeit brachte Jendrik und auch den Gehilfen Witold oft zur Verzweiflung und ließ sie ärgerlich werden. Wurde ihnen etwas erklärt, dann nickten sie verstehend und lachten, als brächte man ihnen altbekannte Kindereien bei. Waren sie aber auf sich selbst gestellt, dann blieb Verwirrung, ja, dann blieb das Chaos nicht aus.
„Jagt sie weg, Meister“, hat der Witold geraten. „Sie werden es nie begreifen. Und wenn sie es doch begriffen haben, glaubt mir, dann geht es im Schlendrian weiter.“
„Ja, Witold, du hast es ja auch gelernt. Und vom gemächlichen Trott hast du dich auch nicht anstecken lassen. Nicht wahr?“
Was sollte der Gehilfe darauf antworten? Er ist doch auch ein Pole, daran ist er erinnert worden. Ihm war, als wäre er auf eine feine, aber schmerzende Weise gerügt worden.
Schweigend machte der Witold sich wieder an die Arbeit. Oft schämte er sich der anderen polnischen Webergehilfen, die, wenn der Meister nicht im Hause war, jede Gelegenheit nutzten, zu faulenzen. Dann standen sie beisammen, oder sie gingen an die Luft, ja, sie setzten sich sogar in einen stillen Winkel und spielten Karten. Der Witold hatte dann das Gefühl, für sie mitarbeiten zu müssen.
Wenn der Meister ihn erst zum Aufseher in der Weberei gemacht hat, dann wird er damit aufräumen! Ein frischer Wind wird unter seinen Landsleuten blasen. Alles will er daransetzen, ihnen mehr Zucht und Eifer beizubringen.
Dazu ist der Witold fest entschlossen.
Eines Abends, die untergehende Sonne scheint durch die Baumkronen und ihr Licht fällt wie grelle, leuchtende Stäbe und Bündel aus den Wolkenlöchern auf die Erde, steht der Witold beim Stall. Seine Arbeit hat er getan und sein Abendbrot gegessen. Der Meister und die Frau sitzen noch lange am Tisch, weil die Kinder sich Zeit lassen mit ihrem Brei, um das Schlafengehen hinauszuzögern. Heute hat der Witod die Adelheid durch den Hof in den Garten gehen sehen, tänzelnd und leicht wie ein Fohlen, das auf die Wiese läuft. Er sieht sie oft hier draußen, und jeden Tag sitzt er bei den Mahlzeiten mit ihr an dem großen Tisch in der Stube, und manchmal kommt sie wegen irgendeiner Sache zu ihm gelaufen, um ihn zu befragen - aber noch nie hat er das Besondere an dem Mädel bemerkt, es noch nie mit diesen Augen angesehen, mit denen er sie in den Garten hüpfen sieht. Dem Witold ist, als sähe er dieses Mädel zum ersten Male.
Staunend bemerkt der Witold an diesem Sommerabend, welche Wirkung auf seine Seele nicht allein die Adelheid hat, sondern ein alltäglicher Sonnenuntergang und dass in ihm etwas geweckt wurde, das er nicht kennt und ihn mit einer guten Wärme überschüttet, die er noch nie in sich gespürt hat und für die er keinen Namen weiß.
Durch das geöffnete Stubenfenster hört er die Frau mit den Kindern sprechen. Während dieser Schwangerschaft spricht sie leiser als sonst, aber manchmal kann sie laut werden, und ihre Stimme klingt böse, dann ist der Edmund gemeint, der sich wieder einmal bei irgendeiner Angelegenheit durchsetzen will, der bockig und aufsässig wird und der der Mutter ungezogene Antworten gibt.
Ohne es zu wollen, geht der Witold ins Feld. Er geht dahin, wo die Sonne untergeht, wo sie auf der Oberfläche der Warthe schimmernde Goldplatten schaukeln lässt.
Beim Gehen reißt er Wiesenschwingel aus und kaut den Halm bis zur Ähre, und wenn er den Speichel nicht mehr im Mund halten kann, dann spuckt er ihn mit seitwärtsgedrehtem Kopf in hohem Bogen ins Feld.
Den Witold hat etwas gepackt, und er weiß nicht, was es ist.
Amalie sorgt sich um die Zwillinge. Sie essen nicht und weinen auch nicht mehr. So oft die Frau die Kinder aus dem Bettchen nimmt, findet sie sie in ihrem Kot. Sie bleiben in ihren Kissen liegen, wie sie sie hingelegt hat, apathisch und ohne Bewegung und sehen sie nicht mehr an, wenn sie sich über sie beugt. Ihre Augen sind trübe und glasig und hängen an einem Punkt, den nur sie sehen können. Sie hatten es immer gern, wenn sie ihnen etwas vorsummte oder ihnen ein Liedchen vorsang und dabei mit den Fingern Figuren in die Luft malte. Jetzt hören sie es nicht mehr, sie sehen an der Mutter vorbei oder sie sehen durch sie hindurch.
Amalie traut sich kaum noch, die Kinder aufzunehmen, so heiß sind sie. Und wenn sie eins auf den Arm nimmt, dann hängt es wie ein schlaffes Tuch vor ihrem Leib.
Einmal ist die bleiche Rosa in die Stube gekommen, ohne dass Amalie sie bemerkt hat. Die Mutter drückte ihr Gesicht auf die heiße Stirn Gotthards, und dabei weinte sie lautlos vor sich hin.
„Mutter, sterben die?“ fragte die Rosa hinter ihr.
Amalie schreckte zusammen. „Sterben? – Ja, bist du denn ganz verrückt geworden!“, schrie sie und ohrfeigte das Mädchen, dass es vor Entsetzen in die Kniee ging.
„Sag das nicht noch einmal“, drohte sie leise, mit tonloser Stimme. „Hörst du! Ich will das Wort nicht wieder hören! Nie wieder!“
Rosas Gesicht war noch bleicher geworden, und ihre tiefliegenden umränderten und geröteten Augen schienen noch tiefer in den Schädel gesunken zu sein; Sie rührte sich nicht, sie stand nur da und blickte die Mutter voller Entsetzen an; Amalie hatte dieses Kind niemals geschlagen.
So leise, dass die Mutter es kaum hören konnte, sagte das Kind: „Aber beim Großvater ist es auch so gewesen. Und dann ist er gestorben und wurde ins Loch getan ...“
Amalie sackte vor dem Kind auf die Knie und umfasste den dürren zitternden Körper. Ganz steif stand die Rosa da und ließ es zu, dass die Mutter wie wild ihre Arme um sie schlang, dass sie ihren Kopf gegen den Bauch des Kindes presste und wie ein Hund aufheulte.
„Meine Rosa“, schluchzte sie. „Mein Herz, ich habe das nicht gewollt. Keine Schläge ... Verzeih mir, bitte. Keine Schläge, nein ...“
Und etwas später, als sie sich beruhigt hatte und wieder aufgestanden ist, sagte sie zu dem Kind herunter: „Später wirst du das verstehen können, mein Kind, später, wenn du erwachsen bist, wenn du Angst um eigene Kinder haben wirst.“ Damit ließ sie die Rosa stehen und ging aus dem Zimmer, ohne noch einmal nach den Zwillingen zu sehen.
In der Stube fällt sie auf die Bank, als wäre sie niedergeschmettert worden oder hätte eine gewaltige Arbeit verrichtet. Ihre Hände im Schoß verhaken sich ineinander, dass die Knöchel ganz weiß hervortreten.
Plötzlich springt sie in die Höhe, sie reißt die Tür auf und schreit in den Hof: „Jendrik! Jendrik! Du musst sofort in die Stadt. Die Zwillinge ...“
Als der Mann vor ihr steht, verschwitzt und dreckig, sagt sie: „Hilf mir, Jendrik, hilf den Kindern, sie sterben ...“
Zuerst begreift er nichts; er wischt sich die Stirn und kratzt seine gebräunten Arme. „Wer stirbt, Malchen?“
„Die Zwillinge“, stöhnt die Frau, und vor lauter Leid fällt sie auf einem Stuhl ganz in sich zusammen, dass der Mann fürchtete, sie werde im nächsten Augenblick auf den Boden stürzen.
„Soll ich die Pastorin holen?“, fragt er.
„Sie brauchen einen Arzt ... Ach, vielleicht auch den Pfarrer.“
Amalie hört nicht, wie Jendrik die Pferde anschirrt und gleich danach den Hof verlässt. Sie hört auch nicht, dass der Witold dem Meister etwas hinterher ruft; sie rauft sich die Haare wie eine Wahnsinnige.
Und plötzlich schießt wieder jener Schmerz durch ihren Leib. Sie möchte schreien, möchte eins der Kinder rufen, aber dieser gewaltige Schmerz, dieses Bohren und Stechen, diese Flamme, die da in ihr aufgeschossen ist, schlägt ihr die Beine weg, und mit einem gurgelnden Laut stürzt die Frau hin ...
„Sie hat doch schon so viele Kinder geboren“, hört Amalie eine Fraustimme sagen. „Und jetzt leidet sie solche Qual. Da muss doch etwas geschehen sein, als sie sie empfangen hat. Wisst Ihr etwas?“
„Nichts“, hört Amalie Jendrik sagen. Seine Stimme ist heiser und sie kommt von weit her. Ein Mensch mit einem fremden Geruch beugt sich über ihr Bett, sie kann einen Schatten erkennen und die Wärme des fremden Gesichts ganz dicht an dem ihren spüren.
Dann fällt sie wieder in ihre Träume zurück.
Himmel, da kommt die bucklige Wanda angeschlurft, ihre Nase tropft in den brabbelnden schwarzen Mund. Die Alte trägt einen Stern, einen blutroten sengenden Stern, der mit seinem Licht alles verglüht, was links und rechts von ihr am Wege steht. Die Alte brabbelt vor sich hin und kichert vergnügt, als sie Amalie hinter dem hohen Lattenzaun entdeckt; die Wanda ruft ihr etwas zu, aber sie kann es nicht verstehen. Sie möchte ins Haus flüchten und stößt sich von den Latten des Zaunes ab, doch ihre Beine bleiben fest an der Stelle wo sie steht, als wäre sie angewachsen.
Amalie ruft nach ihrem Mann, sie ruft nach dem Berthold und dem Witold. Sie schreit, weil sie auch ihre Hände nicht von den Latten losreißen kann. Nicht nur ihre Beine, auch die Hände sind wie angewachsen. Sie schreit und schreit – aber es ist keiner da, der sie hört und ihr zu Hilfe kommt. Die alte Wanda lacht noch verrückter, sie streckt einen Arm aus und hält ihr eine Nachtschwalbe hin, ein struppiges halbnacktes Vieh, blau- und rosafarben, das wie aus Katzenaugen unverwandt zu ihr herüberstarrt.
Eine fremde, bewegte Stimme sagt: „Geben Sie ihr das. Sie muss es morgens, mittags und abends trinken. Und achten Sie darauf, dass sie im Bett bleibt. Sie darf nicht aufstehen. Ihre Frau braucht Ruhe, unbedingte Ruhe!“
Von Jendrik hört Amalie ein schwaches „Ja, ich merke mir das: morgens, mittags, abends ... Ja, ja.“
„Und die Zwillinge“, fährt die fremde Frauenstimme fort, „Herr Erdmann, die lassen Sie da liegen, wo wir sie hingelegt haben. Und jetzt – bitte, kommen Sie nach nebenan, da können wir unbefangener sprechen.“
Ihr Mann und die Frau mit der unbekannten Stimme und dem fremden Geruch entfernen sich.
Amalie liegt wieder allein; das, was sie von der buckligen Wanda geträumt und das, was sie gehört hat, das verwebt sich zu etwas Dunklem und Bedrohlichem. Ihre Gedanken gehen durcheinander, halb sind es Phantasien, halb sind es die Geschehnisse, die hinter ihr liegen und auch das, was sie wahrnimmt. Und alles kommt von dieser Flamme in ihrem Leib, die ihr blindwütiges, versengendes Brennen verloren hat, die aber als eine beständige, gleichbleibende Glut weiter brennt.
Durch die Hälfte des kleinen Fensters fällt das Licht der untergehenden Sonne bis auf Amalies Gesicht. Zuerst wagt sie nicht, die Augen zu öffnen, sie bringt das Licht mit der Flamme in ihrem Innern in Verbindung. Dann vernimmt sie leise Tritte; jemand geht auf nackten Füßen durch ihr Zimmer und nähert sich ihrem Bett.
„Jendrik?“ fragt sie.
Am Fußende ihres Bettes taucht Rosas krankes Gesicht auf. Die geröteten, verklebten Augen blicken wie suchend in der Stube herum, und als sie sich auf die Mutter richten, ist ihr, als wäre in diesem Blick ein stiller Vorwurf.
„Rosa, mein Kind, was machst du hier?“
Das Mädchen lacht albern und zeigt auf den Stuhl neben dem Bett. „Sitzen, da.“ Sie zeigt auf den Stuhl, setzt sich aber breitbeinig auf Amalies Bettkante.
„Du sollst bei mir sitzen? Wer sagt das?“
„Der Vater.“
„Wo ist der Vater?“
Wieder lacht das Mädchen und erhebt sich. „Draußen. Er muss kommen ...“
„Warum soll er kommen, Rosa?“
„Ich darf nicht sprechen.“
„Warum denn nicht?“
„Weiß nicht. Er muss kommen.“ Das Kind will gehen, doch mit einem Mal schlägt es seine lange Schürze vors Gesicht, als wollte es nicht gesehen werden oder nichts sehen, oder als müsste es weinen.
„Rosa! Was ist? Weinst du?“
„Nein.“
„Warum versteckst du dein Gesicht?“
„Nur so ...“ sagt das Mädchen schnell und patscht auf seinen nackten Füßen aus der Stube, um den Vater zu holen.
„Malchen“, flüstert gleich darauf der Mann neben ihrem Bett. „Wie geht es dir? Hast du immer noch Schmerzen?“
Die Frau nickt und lächelt dabei. Sie schiebt das Deckbett etwas zur Seite, dass er sich zu ihr setzen kann. „Sie sind auszuhalten“, sagt sie.
„Die Pastorin Wohlgethan war hier. Und auch der Arzt.“
„Der Doktor?“ ruft sie erstaunt. „Jendrik, was das kostet!“
„Nichts, Malchen, nichts. Mein Bruder hat ihn geschickt und auch bezahlt.“
Sie überlegt. Dann sagt sie: „Dein Bruder ist doch ein guter Mensch, Jendrik.“
„Ich bin froh, dass es dir etwas besser geht. Weißt du, dass du hier drei Tage ohne Bewusstsein gelegen hast?“
Nein, sie schüttelt den Kopf. Ihre knochige Hand streicht über die Stirn. „Drei Tage?“ fragt sie.
Sie überlegt wieder, und dabei wird ihr Gesicht von vielen Falten überzogen. „Jendrik, warum hast du der Rosa verboten, mit mir zu sprechen?“
„Nun, du kennst sie doch! Sie hat einen kleinen Verstand. Sie hätte dir die ganze Zeit nur mit ihrem Kinderkram zugesetzt und dir keine Ruhe gelassen, Malchen.“
Die Frau versucht, sich im Bett aufzurichten, und sofort treten Schweißperlen auf ihr Gesicht. Sie schaut bittend zu ihrem Mann auf. „Jendrik, was ist mit den Zwillingen?“
Der Mann schaut durchs Fenster. Er lässt sich Zeit mit der Antwort. Die Frau wartet, dann fragt sie wieder: „Die Zwillinge, Jendrik.“
„Nun ja“, spricht er zögernd gegen die Scheiben. „Da hat sich nicht viel geändert. Es ist noch so, wie es gewesen ist.“
„Hol sie mir.“
„Malchen, das geht nicht, weil sie eine ansteckende Krankheit haben. Sie müssen für sich bleiben. Niemand soll zu ihnen, niemand!“
Die Frau fällt in die Kissen zurück. Sie starrt gegen die Decke und atmet schwer, und unruhig geworden reibt sie die Hände.
„Sie brauchen mich, Jendrik. Ich bin doch die Mutter.“
Er sagt nichts darauf, er steht nur da mit hochgezogenen Schultern und starrt durch die Scheiben ins Land. Er möchte gehen und sie allein lassen, aber er darf jetzt nicht gehen. Plötzlich beginnt der Mann zu zittern. Sein Kopf schlägt gegen das Fensterkreuz und ganz leise beginnt er zu weinen.
„Sie sind tot ...“ sagt die Frau hinter ihm.
Der Mann schüttelt den Kopf. „Malchen, sie werden aber sterben, alle beide.“
„Sterben? Was ist es, Jendrik?“ fragt die Frau ganz ruhig.
„Der Arzt sagt, sie haben die Ruhr.“
Wieder denkt sie nach, bevor sie ihn fragt: „Und wo sind sie? Wo habt ihr sie gelassen?“
„Wir haben sie in den Stall bringen müssen, dahin kommen die anderen Kinder nicht.“
„In den Stall? Mein Gott, dahin?“, flüstert die Frau.
„Natalie und Martha, und auch die Rosa – Malchen, wir konnten sie nicht von den Zwillingen fernhalten.“
„Mein Gott ...“ stöhnt sie. „Wenn es denn sein muss ... Wenn nur die anderen sich nicht anstecken.“
„Nein, wenn sie nicht zusammenkommen, oder wenn sie nichts anfassen, was von den Zwillingen kommt ...“
„Jendrik, wer kümmert sich um die beiden?“
„Die Küsterin Klingseil hat ihre ledige Schwester kommen lassen, die, die bei Sieradz wohnt. Du wirst sie kennen, Malchen: die kleine hüftlahme Jadwiga. Die mit dem schiefen Gesicht. Erinnerst du dich?“
„Jadwiga? Die?“ Die Frau runzelt ihre Stirn; das Nachdenken fällt ihr so schwer; gegen die Zimmerdecke starrend fragt sie nach einer Weile: „Sag, Jendrik, kann die das überhaupt?“
„Ach, Amalie, wenn du sie sehen könntest! Sie ist so liebevoll. Sie pflegt sie, als wären es ihre eigenen.“
„Das beruhigt mich ... Ja, das ist gut. Nun ja, die Klingseil ... Die weiß doch immer Rat. – Was ist die Klingseil doch für ein prächtiger Mensch“, fügt sie hinzu und dreht sich auf die Seite.
Später, als Jendrik allein in der Stube sitzt, hört er seine Frau wie ein Tier in der Schlafstube stöhnen und ächzen.
Den ganzen Tag liegt Amalie mit dem Gesicht zur Wand, ohne mit jemandem zu sprechen. Sie ißt und sie trinkt nichts, ja, es sieht aus, als bewege sie sich nicht mehr.
Und nach den Zwillingen fragt sie nicht.
Drei Tage später hilft ihr Emma Klingseil, die Küsterin, einen gesunden Jungen auf die Welt zu bringen, den sie, wie es besprochen war, nach seinem Großvater ‚Siegismund’ nennen.
An diesem Tag sind auch die Zwillinge auf ihrem Strohlager im Stall gestorben. Die hüftlahme Jadwiga hat die beiden während dieser Zeit keinen Moment aus den Augen gelassen. Erst als sie sich mit einem Spiegel und einem Gänsefederchen davon überzeugt hatte, dass sie nicht mehr atmeten, ist sie aufgestanden und hat das letzte getan, das noch getan werden musste: sie hat, nachdem sie die Kinder in ihre Särge gelegt und die Särge verschlossen hatte, das Stroh, die Decken und die Kleidung der Kinder verbrannt. Das, was in der Nähe gestanden hat und noch gebraucht wurde, das hat die hüftlahme Jadwiga in einen Kessel mit kochendem Wasser geworfen, um die todbringenden Keime zu vernichten. Danach hat sie sich selbst gereinigt; sie hat ihre Hände und Arme geschrubbt, bis sie ganz rot geworden sind, und hat ihre Kleidung und die Schuhe gewechselt und das Getragene in eine Gummidecke geschnürt und ist gegangen.
Im Ort ist es sehr schnell bekannt geworden, dass die Zwillinge an der Ruhr gestorben sind. Die Ruhr, so meinen die Leute, sei ebenso schlimm wie die Cholera. Darum findet sich keiner aus der Nachbarschaft, der an der Beerdigung teilnimmt. Stellen nicht alle, die unter dem Dach der Erdmanns leben, eine Gefahr dar? Es ist ratsam, vorsichtig zu sein und sie zu meiden; das versteht jeder, entschuldigt sich der eine beim anderen; und die Erdmanns müssen es auch verstehen.
So werden die kleinen Zwillinge in einem traurigen Leichenzug zu Grabe getragen, an dem neben dem Vater und den beiden ältesten Kindern, Berthold und Adelheid, nur die Küsterin, die hüftlahme Jadwiga und die Frau des Pastors teilnehmen.
Amalie wird lange im Wochenbett liegen, so dass sie mutlos wird und insgeheim Jendrik an ihrem Leiden die Schuld gibt; sie hat weder die Zwillinge noch dieses Kind gewollt, denn nach der Rosa hat sie sich während jeder Schwangerschaft krank und alt gefühlt, und sie fragt sich, ob sie sich von der Geburt dieses Kindes noch einmal erholen wird.
Jendrik kommt von der Beerdigung wie ein Kranker nach Hause, mit schleppendem Schritt, kalkweiß, und die Lippen presst er zusammen, wie man es bei ihm sehen kann, wenn er vor Wut nicht weiß, was er anstellen soll. Er wirft die Mütze gegen den Ofen, und als er die Schuhe aufgebunden hat, wirft er sie hinterher. In der Tür zu Amalies Kammer stiert er vor sich hin, ohne der Frau etwas zu sagen. Amalie wartete ab. Sie hat den kleinen Siegismund neben sich im Bett liegen, der wie ein Bündel verschnürt an ihrer Schulter liegt.
„Wo sind sie beerdigt worden?“, fragt sie schließlich, weil sie es nicht ertragen kann, den Mann so stumm und leidend im Zimmer zu haben.
„Neben dem Vater“, murmelt er.
„Das ist gut“, sagt sie erleichtert. „Ich dachte schon, man würde sie irgendwo an der Hecke begraben.“
„Warum sollten sie an der Hecke begraben werden?“ fragt der Mann gereizt. „Sie sind getauft! Sie sind Christen. Sie sind Menschen wie du und ich, wie alle hier.“
„Ach Jendrik, sei nicht böse, mich quälen die verrücktesten Gedanken. Unsere kleinen Kinder ...“ klagt sie leise. „Mein Gott, warum haben Johann und Gotthard so früh sterben müssen? Die Kleinen haben ja noch nicht einmal gewußt, dass sie leben! Sage mir, Jendrik, wozu habe ich den Siegismund hier geboren? Auch dafür? Jendrik, dieses Kind muss so schnell wie es nur geht getauft werden!“
„Was du dir für Gedanken machst! Sieh zu, dass du bald auf die Beine kommst, dann können wir darüber reden!“ sagt er barsch und geht aus dem Zimmer.
Warum ist er nur so böse? Sucht er die Schuld bei mir, dass die beiden Kleinen gestorben sind? Oder ist er böse, weil ich dich, kleines unschuldiges Herzchen, Amalie legt ihren Arm über den Säugling, geboren habe? Vielleicht ist das seine Art geworden, zu trauern, denkt sie. Ähnlich ist das nach dem Tod seines Vaters gewesen. Manchmal zeigt er sich von einer Weichheit und Milde gegen mich und die Kinder, dass ich mich darüber nur wundern kann. Dann wieder kann er abweisend sein und barsch, so wie er es jetzt ist.
Behutsam wickelt sie den Kopf ihres Kindchens aus der Decke, es schläft, die Fäustchen neben dem immer noch faltigen Gesicht, das sich im Schlaf zum Weinen verzieht und dabei die Unterlippe vorschiebt, die sofort nach unten klappt und den kleinen feuchten Mund aufmacht, wenn die Mutter sie mit der Fingerspitze berührt.
’Siegismund – du trägst den Namen deines Großvaters, der schon nicht mehr lebt. Es ist gewiss nicht nur der Name, der dich, mein Kind, mit ihm verbindet. Später wird es sich zeigen, wo du ihm ähnelst. Später ...‘
Sie denkt daran, wie der alte Siegismund gewesen ist. Besonders deutlich formt sich vor ihr das Bild, wie er in seinem Sarg gelegen hat, so entrückt und erhaben, dass ein lauter Ton, ein unvorsichtig gesprochenes Wort wie eine grobe Unziemlichkeit vor dem Sarg gewirkt hätten.
Amalie betrachtet das kleine unruhige Gesichtchen, und plötzlich zieht sich etwas in ihr zusammen. In ihrem Hals wächst ein Kloß, die Tränen schießen hervor und sie reißt das Kind an sich, dass es wach wird und weint.
„Weine nicht, mein Kindchen“, schluchzt sie an seinem Gesicht. „Weine nicht, du stehst am Anfang deines Lebens, mein Herz, eines langen Lebens ... Länger, als das des alten Siegismund gewesen ist. Ja, länger, als Johann und Gotthard gelebt ...“
Ihr Weinen wird noch heftiger, sie schreit, um nicht gehört zu werden, in die Kissen.
Später hat sie das Gefühl, als habe sie den ganzen Tag nichts anderes getan, als nur geweint. Und als sie endlich zur Ruhe kommt, da fühlt sie sich leichter.
„Meinem Mann ist bei der Durchsicht der Listen aufgefallen, dass Sie vergessen haben, die Adelheit zum Konfirmandenunterricht zu schicken. Sie hätte schon konfirmiert sein müssen!“ Die Pastorin Wohlgethan sitzt sehr steif auf der Kante des Stuhls, den sie so gerückt hat, dass sie im Schatten sitzt und ihr Gesicht nur unklar zu erkennen ist.
Sie hat durch ihren Besuch Kühle in dieses Haus mitgebracht, und auch Verlegenheit und Unsicherheit bei mir und sogar bei den Kindern, findet Amalie.
Die Pastorin nippt in kleinen Schlucken von dem Tee, den Amalie für sie bereitet hat. Zuerst hat die Pastorin Tee abgelehnt: „Danke, ich möchte jetzt keinen Tee Um diese Zeit trinke ich nichts!“
Aber Amalie hat darauf bestanden. „Wie dumm, ich kann Ihnen nichts anderes als Tee anbieten. Eine Tasse werden Sie doch trinken. Nur ein Tässchen.“
Einwilligend hat die Pastorin den Kopf gesenkt: Ja, wenn es unumgänglich ist ... Widerstrebend trinkt sie den aufgenötigten Tee. Sie trinkt ihn so, dass die Hausfrau die Überwindung spüren muss.
Die Pastorin Wohlgethan ist gekommen, um Amalie Erdmann, deren Ansehen im Ort durch die zusätzlichen Webstühle und das Beschäftigen von drei neuen Webern gestiegen ist, für den neugegründeten Hülfsverein zu gewinnen.
„Was wir vorhaben, scheint vom guten Geist“, die Pastorin blickt gegen die Zimmerdecke, „begleitet zu werden, Frau Erdmann. Uns ist es gelungen, das Häuschen des Totengräbers umzubauen“, sagt sie, „bescheiden umzubauen. Unsere Mittel sind ja auch bescheiden, das können Sie sich denken“, erklärt sie mit einem dünnen Lächeln. „Aber immerhin haben dadurch sieben alte Leute für ihren Lebensabend eine Bleibe bekommen.“
Sie blickt Amalie wie aus Katzenaugen an, starr und nichts Gutes verheißend. Anscheinend überlegt sie, wie sie weiter vorgehen soll, wie sie dieser schlichten, aber doch wohl mit einem gesunden Verstand ausgestatteten Frau ihr Anliegen vorbringen soll.
Sie nippt noch einmal von dem Tee, bevor sie fortfährt: „Gutes zu tun ist unsere Christenpflicht. Ist es nicht so, Frau Erdmann?“, fragt sie listig, „dass wir, wenn wir das Leid der Leidenden und Hungernden lindern – dass wir damit die Qualen unseres Herrn zu lindern versuchen, die er für uns alle auf sich genommen hat?“
Wieder heften sich ihre Katzenaugen an Amalie, aber diesmal ist ein wenig Freundlichkeit darin oder Leutseligkeit.
Amalie nickt, sie wartet ab; sie ahnt, warum die Pastorin Wohlgethan zu ihr gekommen ist. Zuerst hat sie vermutet, es sei wegen Siegismunds Taufe, oder dass da noch etwas wegen der Beerdigung der Zwillinge zu regeln sei.
Aber schließlich hat die Pastorin ihr direkt und ohne irgendwelche Umschweife das Versäumnis vorgehalten, dass sie die Adelheid nicht zum gültigen Termin in den Konfirmandenunterricht geschickt habe.
Doch das, Amalie vermutete es, waren nur Einleitungen.
Amalie sagt: „Ja. Aber da ist noch die Sache mit dem Unterricht. Sie wissen, wie die letzten Wochen der Schwangerschaft gewesen sind ... Und dann kam der Tod der Zwillinge ...
Ja, die Adelheid muss nun in den Konfirmandenunterricht. Das Mädel ist schon über zwölf Jahre hinaus! Ich kann ja nun beide schicken, die Adelheid und die Rosa.“
„Die Rosa?“ fragt die Pastorin verwundert.
„Die ist noch elf“, sagt Amalie. „Die ist im richtigen Alter.“
„Das schon. Aber die Rosa – die ist doch recht unverständig, ist schwach im Kopf, dass sie nicht einmal in die Schule gehen kann.“ Der Kopf der Pastorin wird vor lauter Verwunderung über Amalies Vorschlag weit in den Nacken gezogen. Langsam beugt sie sich endlich vor und besieht irgendetwas in ihrer Teetasse. Sie sagt: „Wie soll dieses Kind in die Geheimnisse der christlichen Lehre eingeführt werden? Wie soll sie den Katechismus lesen und begreifen? Wie, frage ich Sie, kann bei einem solchen Menschen der Glaube an unseren Herrn Christus zu einem Baum wachsen, unter dem andere Schutz und Erquickung finden?“ Wieder streckt sich der Körper der Pastorin in die Höhe und der dicke Knoten zieht den Kopf zum Rücken hin: ’Die Rosa? Ausgeschlossen!‘ scheint sie zu denken, sie sagt es aber nicht.
„Nein“, sagt Amalie bedrückt. „Alles das kann sie nicht: sie kann nicht lesen und nicht schreiben, und sie begreift die einfachsten Dinge nur sehr, sehr schwer. Aber – ist das alles denn so wichtig? Braucht der Mensch einen klaren und gescheiten Kopf, wenn er ein gutes Herz hat?“ Sie ist mit jedem Wort leiser geworden; hilflos sitzt sie der Pastorin gegenüber und weiß jetzt nichts anderes zu tun, als die Hände im Schoß zu besehen.
Die Pastorin wartet ab. Schließlich rät sie: „Sprechen Sie mit meinem Mann darüber. Er ist der Pastor und erteilt den Unterricht und weiß, was er den Kindern zumuten kann. Aber, meine liebe Frau Erdmann, ich wollte sie dieses fragen: unser Hülfsverein braucht gute, er braucht angesehene Frauen. Bis jetzt hat mir keine Frau unserer Gemeinde, die ich in dieser Sache angesprochen habe, eine Absage erteilt. Denken Sie nur, sogar zwei Lodzer Fabrikantengattinnen, die gerne zur Mitarbeit bereit gewesen wären, haben wegen des weiten Weges absagen müssen, aber sie haben mir jede Hilfe und Unterstützung zugesagt! Wir haben Weber in unserer Stadt, die für diese Lodzer Fabriken weben, die meinen, dass in die Verantwortung der reichen Fabrikanten in Lodz auch solche Orte einbezogen werden müssen, aus denen ihre Arbeiter kommen. Zwei dieser Fabrikanten und ihre Gattinnen sind gemeinnützig und sehen das ebenso und haben zugesagt, uns nach Kräften zu unterstüten.“
Ganz offensichtlich ist die Pastorin stolz, zwei solch hochgestellte Damen vorweisen zu können. Während sie sich erhebt, leert sie die Tasse und stellt sie dann mit spitzen Fingern auf den Tisch zurück. Beim Abschied sagt sie: „Ich kann doch auch mit Ihnen rechnen, Frau Erdmann? Es ist eine ehrenvolle und christliche Aufgabe, die von diesem Verein getan wird.“
Und kerzengerade, die Welt gleichsam von oben betrachtend, weil sie durch das Gewicht ihres Haarknotens dazu gezwungen wird, schreitet die Pastorin Wohlgethan davon.
Beim Abendessen erzählt Amalie ihrem Mann von diesem Besuch. Sie erzählt, als wüsste sie nicht so recht, was von den Dingen wichtig ist und unbedingt gesagt werden muss und was sie besser für sich behält. Sie weiß auch nicht, wie er das Anliegen der Pastorin sehen und beurteilen wird. Jendrik hat diese Pfarrfrau nie gemocht. Es könnte sein, dass er unwillig wird, weil sie seiner Frau Aufgaben zumutet, die ihr selbst und der Familie lästig werden können. Hat Amalie etwa durch Äußerungen dieses Anliegen herausgefordert? Hätte sie nicht rechtzeitig das rechte und klare und entscheidende Wort sprechen müssen?
Amalie ist immer unsicher und ohne Selbstbewusstsein gewesen, doch in letzter Zeit, so kommt es Jendrik vor, hat diese Unsicherheit selbst bei den alltäglichen kleinen Aufgaben zugenommen. Dazu fühlt sie sich allzu oft müde und kraftlos. Manche Nacht liegt sie stundenlang wach neben ihrem schlafenden Mann, weil schwere und quälende Gedanken und Träume sie überfallen und ihr zusetzen. Wie kann sie sich dagegen wehren? Das Aufstehen fällt ihr schwer, sie fürchtet sich vor den Aufgaben des neuen Tags, sie fürchtet sich vor den Forderungen der Kinder, auch davor, dass mit einem fremden Menschen etwas noch Unangenehmeres und Bedrohlicheres ins Haus kommen könnte.
„Ich bin so müde“, gestand sie eines Morgens ihrem Mann von der Bettkante. „So schrecklich müde, dass ich ...“ Sie wollte sagen: dass ich mich nach der langen Ruhe sehne, wie Tote sie haben müssen.
„Was soll das?“ fragte er unwirsch. „Du hast doch die ganze Nacht geschlafen!“
Daraufhin hat sie es vorgezogen, nicht mehr davon zu sprechen. Sie erhob sich unter Mühen und ging daran, ihre Aufgaben zu erledigen und den Mann nicht spüren zu lassen, wie schwer ihr das alles fällt.
Was wird er dann zu dem Besuch der Pastorin Wohlgethan und ihrem Anliegen sagen? Als würde es um etwas Belangloses gehen, beginnt Amalie stockend und leise zu erzählen.
Jendrik sitzt tief über seinem Teller, beide Arme seitlich davon aufgestützt und ohne irgendwelche Anzeichen, dass er ihr wirklich zuhört.
Wenn er kaut, dann kann sie sogar Muskeln an seinem Hals spielen sehen. Früher hat sie der Anblick solcher Kraft erregt. Vorsichtig, weil es nicht schicklich ist, hat sie sich ihm genähert, hat solche Stellen mit den Fingerkuppen berührt, bis der Funke auch auf ihn übergesprang. Jetzt erregt sie das nicht mehr. Sie sieht die Muskeln spielen, aber sie können das, was in ihr eingeschlafen, vielleicht schon abgestorben ist, nicht mehr wecken. Von unten herauf blickt sie ihren Mann an und wartet, dass er endlich etwas zu dem Besuch sagt.
Gemächlich erhebt er sich schließlich. Er gähnt und streift sich die herabhängenden Hosenträger wieder über die Schultern. Leicht geduckt schaut er zum Fenster hinaus. „Ja, wenn die Pastorin dir eine Mitarbeit in diesem Verein zutraut, dann kannst du ihr das nicht abschlagen. Es sollte uns ehren, Malchen, dass sie uns solche Aufgaben anträgt, und dass wir mit solchen Herrschaften ...“ Er dreht sich jäh um. „Möchtest du es denn, Malchen?“
„Ich weiß es nicht.“
Der Mann wendet sich ihr zu. Auf seinem Gesicht liegt immer noch der Ausdruck von Abwesenheit. „Wenn du es möchtest, dann solltest du es auch tun, Malchen.“
„Eigentlich möchte ich nicht“, sagt die Frau gequält. „Sie werden mir Arbeiten zutrauen, die ich nicht erledigen kann.“
„Was sind das für Arbeiten, die du nicht erledigen kannst?“
„Wenn sie mir mit dem ganzen Schreibkram kommen ...“
„Aber du kannst doch schreiben und lesen!“ ruft er.
„Wenig, Jendrik, ganz wenig.“ Sie wendet sich ab und beginnt vor Verlegenheit mit dem Schürzenzipfel über den Tisch zu wischen. „Ich muss es dir ehrlich sagen: ich kann nicht schreiben. Nur meinen Namen, nicht mehr.“
„Nicht schreiben? Aber lesen kannst du doch!“
„Auch das nur wenig. Wenn ich in ein Buch schaue, in die Bibel oder in das Gesangbuch, dann möchte ich nur den Eindruck erwecken, als könnte ich lesen. Die anderen sollen glauben, dass ich es kann. Das ist es, was mir den Entschluss schwer macht, Aufgaben im Hülfsverein zu übernehmen. Nichts anderes. Ich hätte es gerne gelernt, aber dazu fehlte uns Kindern damals die Zeit. Und außerdem hatten meine Eltern nicht das Geld, die teuren Schulbücher zu kaufen.“ Amalie steht traurig da, beschämt, dass sie ihm diesen Betrug, diese Last gestanden hat.
„Und wenn du an deine Eltern geschrieben hast?“
„Dann war das auch nur Täuschung. Kein Mensch hätte das lesen können. Es ergab keine Wörter, und schon recht keinen Sinn. Ich habe meine Briefe schreiben lassen.“
„Du hast auch mich hinters Licht geführt?“
Die Gleichgültigkeit ist aus dem Gesicht des Mannes gewichen. Ungläubig steht er vor ihr, die Arme vor der Brust verschränkt, als wollte er mit ihr einen Kampf aufnehmen. Für Sekunden, so meint die Frau, glimme in seinen Augen etwas wie Enttäuschung und Verachtung auf. Er fragt noch einmal: „Mit deiner Schreiberei hier an dem Tisch hast du auch mich an der Nase herumgeführt?“
„Nein“, antwortet sie kaum hörbar. „Ich habe es für mich getan, Jendrik. Es war so schön, dazusitzen und so etwas wie Buchstaben auf ein Blatt Papier zu malen, auch wenn es keine richtigen waren. Aber es war schön.“
„Malchen! Du bist ja eine ganz Abgefeimte!“ ruft der Mann und biegt sich vor Lachen. „Und all die Jahre habe ich geglaubt, dass ich an dir eine gebildete Frau habe! Und dabei war es nichts weiter als Täuschung ... Als gekritzelter Unsinn!“
Mit hängenden Armen blickt sie zu ihm auf. Ihre Augen werden feucht. Die Frau fühlt sich, als hätte sie sich vor ihm ausgezogen. „Es war schön“, sagt sie noch einmal. „Auch wenn es nicht leicht gewesen ist. Denn immer saß mir die Angst im Nacken, dass ich mit meiner Täuscherei auffalle.“
Er nimmt sie in die Arme und drückt sie an sich, obwohl eines der Kinder in der Tür steht und zusieht.
„Ja, es könnte sein, dass sie dich einmal zur Schriftführerin des Vereins machen wollen“, sagt er an ihrem Ohr. „Oder sie bitten dich, einen Brief zu schreiben ...“
„Darum möchte ich es nicht machen“, sagt sie.
Der Mann hält sie an den Schultern etwas von sich, wie um sie besser ansehen zu können. Mit verschlagenem Gesicht meint er: „Malchen, bei mir ist dir die Finte gelungen. Meinst du nicht, dass du die Pastorin mit ihrem Verein ebenfalls ...“
„O Gott! Nein, nein!“ ruft sie entsetzt. „Jendrik, das würde mich so sehr verunsichern, dass ich nicht einmal mit denen reden könnte! Ich würde alles falsch machen. Alles! Jendrik, ich säße zitternd und mit rotem Kopf da und würde jeden Moment das Unglück erwarten.“ Sie lächelt ihn schwach an. Mit dem Handrücken wischt sie sich die Augen. „Jetzt weißt du, warum sich alles in mir sträubt, im Hülfsverein mitzuarbeiten.“
„Nun ja“, sagt er nicht mehr ganz so sicher wie vorhin und er reibt sich dabei das Kinn. „Du könntest die Pastorin bitten, dich wegen der Kinder und der Arbeit in diesem Hause mit Schreibarbeiten zu verschonen. Hin und wieder würdest du einen Besuch machen, oder etwas Ähnliches ...“
„Meinst du, dass das gehen wird?“ fragt die Frau. Denn das Angebot der Pastorin hat schon einen gewissen Reiz für sie.
„Du solltest es versuchen“, rät der Mann. „Weißt du, wenn sie etwas von dir verlangen, was du nicht tun kannst, dann, Malchen, ziehst du dich ganz einfach aus diesem Verein zurück. Gründe werden sich immer finden lassen. Aber du hast deinen guten Willen gezeigt!“
„Ja, Jendrik, ich werde mir das durch den Kopf gehen lassen.“
„Für dich und für unser Ansehen wäre es gut“, er nickt überzeugt. „Jetzt, da wir expandieren ...“
„Ja.“
„Versuche es.“
„Ich muss mir das überlegen.“
„Ich, Malchen, gebe dir die Zeit. Aber ob die Pastorin Wohlgethan sie dir geben wird? Ich denke, die wird schon in den nächsten Tagen hier auftauchen und dich wieder bedrängen.“
„Ja, das denke ich auch. Aber ich brauche Zeit.“
„Hast du ihr das gesagt?“
„Nein.“
„Du hättest sie gleich an deine Arbeiten erinnern sollen.“
„Ich habe nicht daran gedacht.“
„Ja, ja.“
Es scheint dem Mann Freude zu bereiten, dieses von seiner Frau zu wissen. Er lacht sie an und schüttelt manchmal ungläubig den Kopf. Dann reißt er sie an sich. „Malchen“, sagt er. „Ich habe dich immer für eine Wölfin oder für eine Bärin gehalten, für eine gutmütige und sanfte Bärin, aber doch stark und mir in manchem weit überlegen. Und jetzt muss ich erfahren, dass du ein Reh bist, voller Angst und voller Schrecken!“
„Das darfst aber nur du wissen“, sagt sie an seiner Brust. Und dann: „Du musst etwas Geduld mit mir haben, Jendrik. Vielleicht lerne ich es noch, Briefe zu schreiben und zu lesen. Und manches andere auch.“
„Ja, willst du es denn lernen?“
„Ich möchte schon. Aber wie kann man das lernen?“
„Ich werde darüber nachdenken“, sagt er. „Denn hier können wir keinen Menschen danach fragen.“
„Und auch darin bitte ich dich um Geduld: meine Müdigkeit wird auch wieder vergehen.“
„Du bist müde?“ fragt er verwundert.
„Lange schon. Ich habe es dir sagen wollen, Jendrik. Einige Male habe ich es versucht, aber du hast mir nicht zugehört. Du bist sogar böse auf mich geworden.“
„Malchen!“ ruft der Mann erschreckt.
„Doch, doch.“
Er beugt sich über sie, dass sie fast ganz in seine Körperkrümmung geschmiegt ist. „Meine kleine Wildgans, du.“
„So hast du mich schon lange nicht mehr genannt. Bald nach der Hochzeit hast du vergessen, dass du mir einmal diesen Namen gegeben hast.“
„Malchen ...“ bittet er. „Manchmal weiß ich nicht, wo mir der Kopf steht ... Die Arbeit, die Leute ...“ Sie hat ihn beschämt, und er steht da, die Arme um ihren Leib geschlungen, und weiß nicht, was er tun oder sagen soll. Sie hat ihm heute eine ihrer verborgenen und unbekannten Seiten gezeigt, die ihn so verblüfft und gleichzeitig auch ein wenig stolz und überlegen gemacht hat.
Bevor er seine Frau verlässt, versichert er ihr in der Tür: „Ich werde über die Sache nachdenken, Malchen. Das ist ein Versprechen.“
Der Witold konnte nicht an sich halten und hat seine Mütze ungehalten auf die Erde geschmissen; erst war er rot vor Wut, jetzt ist er bleich geworden, und vor lauter Ohnmacht kaut er seine Lippe, bis sie blutet. Aufgebracht blickt er seinen Herrn an, und der steht da und amüsiert sich, scheint sich sogar über Witolds Wutausbruch lustig zu machen, und das bringt den Witold noch mehr auf. Wie kann der Herr die Sache mit den polnischen Webern nicht ernst nehmen? Wie kann er ihn selbst nicht ernst nehmen, da er doch nur auf Ordnung und Verlässlichkeit bedacht ist!
„Witold, ich weiß, dass sie öfter mit verschränkten Armen dastehen. Nur – ich habe sie noch nie dabei erwischt!“
„Nein, weil die Hunde gerissen sind. Vor Ihnen, Meister, sind sie auf der Hut. Aber bei mir – für die bin ich nur ein polnischer Rotzlöffel. “
„Ja, Witold, ein junger Pole bist du. Und das ärgert die drei da drinnen. Aber du wirst ihnen zeigen, dass du ernst zunehmen bist.“
„Und die Polen, sagen die Deutschen, die sind alle faul. Tagediebe sind sie.“
„Wer sagt das? Ich sage das nicht!“
„Nein, Sie nicht. Aber die anderen sagen das.“
„Hast du das gehört, Witold?“
„Nein.“
„Und du, Witold, bist alles andere als faul. Du bist mein bester Mann in der Weberei. Darum sollst du Vorarbeiter werden.“
„Aber die drei da sind faul!“ beharrt Witold und deutet mit dem Kinn nach der Weberei. „Und ihre Arbeit ist schlecht. Wenn Sie sie danach bezahlen würden, dann ...“
„Was dann, Witold?“
„Schreien und herumbrüllen würden die Halunken, weil sie für ihre Arbeit einen Bettellohn bekämen und jedem erzählen, dass alle Deutschen ausbeuter und Halsabschneider sind. Vielleicht würden sie sogar versuchen, einen Aufstand anzuzetteln, wie es einige Arbeiter in den großen Lodzer Webereien schon getan haben.“
„Wie gut du Bescheid weißt. Woher hast du denn diese Neuigkeit?“
„Ach, das wissen doch alle. – Sie sollten sie nach ihrer Arbeit bezahlen, Meister. Gute Arbeit – gutes Geld. Miese Arbeit – ja, dann kann der Lohn nicht anders sein.“
„Gut, Witold, ich werde ein Auge auf die drei haben.“
„Das sagen Sie nur so.“
„Nein, ich will auf sie achtgeben, damit du, Witold, es mit denen leichter hast und dich nicht über sie ärgern musst.“
Beruhigend klopft Jendrik ihm auf die Schulter und nicht ganz überzeugt geht der Witold wieder an seine Arbeit. Seine Mütze dreht und knetet er zwischen den Fingern und er verschafft sich in der Weise Luft, dass er ausspuckt und so leise, dass der Meister es nicht hören kann, in seiner Sprache vor sich hinflucht.
Der Meister ist zu seinem Bruder nach Lodz gefahren.
Seiner Frau sagte Jendrik, als sie ihn erstaunt und fragend anblickte, der Bruder wüsste Rat, wie er mit seinem Leinen noch bessere Geschäft machen könnte.
„Bist du nicht zufrieden mit dem, was wir mit unserer Ware verdienen, Jendrik?“
„Wenn es möglich ist, auszubauen ...“
„Noch mehr Leute, noch mehr Ärger“, sagt Amalie. „Dein Bruder klagt über seine Leute, und jetzt willst du dir ähnliches an den Hals laden ... Bitte, tu mir den Gefallen, und fahre nicht allein, Jendrik. Ich habe gehört, dass sich Gesindel bei Lodz herumtreibt.“
Zuerst hat der Witold ihn begleiten sollen, dann aber hat Jendrik es sich anders überlegt und den Berthold, seinen Ältesten, mitgenommen; der Junge ist alt genug, auch ernsthafte Gespräche zu hören; es schadet auch den Witold nicht, wenn er einen Tag allein mit den Webern zurechtkommen muss, sagte Jendrik sich. Am Abend, so hat er seine Frau und die Leute wissen lassen, würde er zurück sein.
„Witold“, hat Jendrik sich von seinem Gehilfen verabschiedet, „damit hast du wieder eine Gelegenheit, deine Umsicht und deine Verantwortung zu beweisen.“
An diesem Tag ist der Witold damit beschäftigt, ein Loch im Zaun des hinteren Hofes abzudichten. Die Hausfrau hat darüber geklagt, dass ein Fuchs ihr wieder eine Henne gerissen und fortgeschleppt hätte. Am frühen Morgen sei es gewesen. Sie habe die Hühner füttern wollen, da sei der rote Satan mit der toten Henne durch das Loch entwischt. Sie habe ihm Holzscheite hinterher geworfen, aber der Fuchs sei, die Henne neben sich herschleifend, da hinten in den Büschen verschwunden.
Dem Edmund ist nicht verborgen geblieben, dass der Witold sich hinter den Kohlstauden am Zaun zu schaffen macht; unbemerkt ist er zwischen die Stangenbohnen geschlichen; mit belustigtem, und wer dem Jungen nicht grün ist, der würde sagen: mit verschlagenem Blick, beide Hände tief in den Hosentaschen, sieht der Edmund zu, wie der Witold sich müht, die bei jedem Hammerschlag federnden Latten so zu verlängern, dass sie einige Hände breit in die Erde reichen, um den Fuchs daran zu hindern, sich unter dem Zaun einen Zugang zu graben. Der Edmund ist erfinderisch; er hat auch jetzt wieder einen Plan, eine umwerfende Idee, wie er glaubt.
„Witold!“ ruft er aus seinem Versteck heraus, so dass der Angerufene sich vor Schreck hinsetzt. „Witold, wenn du eine Klappe an dem Loch anbringst, dann könnten wir den Fuchs fangen!“ Ein wenig aufgeblasen kommt der Edmund durch den Kohl gestelzt.
„Wozu das denn? Was willst du mit dem Fuchs?“
„Wir könnten ihm den Pelz abziehen. Dann hätte meine Mutter auch einen Fuchs, den sie sich auf die Schultern legen kann.“
„Und wie willst du ihn fangen, he?“
„Du nagelst eine Feder an die Klappe, und wenn der Fuchs die berührt, peng, dann knallt die Klappe zu! Um ihn anzulocken, musst du nur etwas Fleisch, ein totes Huhn vielleicht, in den Garten legen. Sonst kommt der nicht. Pass einmal auf ...“
Edmund hockt sich neben Witold auf den Boden und entwickelt ihm seinen Plan für die Falle.
Anfangs hört der Witold zu, dann macht er sich unbeeindruckt daran, das Loch weiter zuzunageln.
„Warum hörst du nicht zu, Witold? Warum probierst du das nicht mit der Falle?“
„Weil du Kokolores redest.“
Der Edmund ist beleidigt. Er hockt schweigend neben dem Gehilfen und sieht ihm bei der Arbeit zu und wartet darauf, dass etwas schief gehen, oder dass der Witold sich verletzen könnte.
„Drück mal mit einem Stein gegen die Latte“, fordert der den Jungen auf. „Dann federt sie nicht, und ich kann die Nägel besser einschlagen.“
Der Edmund ist aufgestanden. Zum Zeichen, dass er überhaupt nicht daran denke, vergräbt er seine Hände wieder in die Hosentaschen. „Alles, was ihr macht, ist so ... so einfach, so blöd!“ mault der Junge und zieht sich gekränkt zurück.
Damit ist der Witold eine Zeitlang beschäftigt gewesen.
Als er jetzt über den Hof kommt, hört er einen Webstuhl arbeiten. Langsam und gleichmäßig, wie es die Art der kränklichen Rosa ist. Er sieht das Kind am Webstuhl sitzen, mit schmalem, gebogenem Rücken, und den Kopf, weil sie schlecht sieht, tief auf das Garn gesenkt.
Lauschend wartet der Witold eine geraume Zeit vor der Tür. In seiner Hand baumelt der Hammer von der Zaunarbeit. Im Stubenfenster taucht der Kopf der Martha auf. Als sie den Witold entdeckt, winkt sie ihm, dann ruft sie etwas, und weil er ihr nicht antwortet, ruft sie laut seinen Namen. Der Witold gibt ihr Zeichen, stille zu sein. Aber das Kind achtet nicht darauf. Sie formt die Hände vor ihrem Mund zum Trichter und brüllt wieder: „Witold! Witold! Witold!“
Er muss gehen. Vorsichtig und lautlos tritt er in die Werkstatt.
Ja, er sieht nur die bleiche Rosa gekrümmt über ihrer Arbeit; die Webstühle der drei polnischen Weber stehen verlassen.
„Rosa! Wo sind die anderen?“ ruft er.
Das Mädchen hört ihn nicht. Dafür taucht ein Kopf hinter dem Regal auf, in dem das Garn liegt. Es ist der Hendryk Wielopolski, der jüngste der polnischen Weber.
„Hier sind wir!“ ruft der Hendryk.
Alle drei sitzen um einen umgestülpten Eimer auf dem Boden und würfeln. Ignacy, der älteste von ihnen und meistens ihr Wortführer, ein Mensch mit einem genarbten und finsteren Gesicht, rückt zur Seite und sagt auf Polnisch: „Komm, du Großschnauze, und spiel einmal mit!“
„Ihr habt zu arbeiten!“ brüllt der Witold ihn an. „Macht, dass ihr an eure Plätze kommt!“
„Spielst dich auf, als wärst du der Herr“, sagt der Ignacy.
Adam, der dritte von ihnen, lacht auch jetzt wieder sein meckerndes, ziegenhaftes Lachen mit hängender Unterlippe, das an ein hochnäsiges Tier denken lässt. Adam scheint zu spüren, dass es böse ausgehen könnte, und so versucht er zu beschwichtigen und die Angelegenheit zu verharmlosen, und wenn er dazu sein meckerndes Lachen hören lässt, wird der Witold die Sache nicht so ernst nehmen.
Adam sagt: „Ein kleines Spielchen nur. Vergiss es! Wir werden die Zeit herausarbeiten, Witold!“
„Was? Herausarbeiten?“ schreit der Ignacy. „Willst du vor dem Schleimlecker auf dem Bauch kriechen? Was ist der schon? Hier ist der Bengel ein nichts! Eben ein Bengel. Für sein Alter hat der eine viel zu große Fresse, die ich ihm gerne einmal stopfen möchte. Ich hab es schon lange satt, mir ständig das Gewäsch von diesem Rotzlöffel anzuhören!“
Ignacy ist aufgestanden; drohend steht er vor dem Witold, drohend krempelt er seine Hemdsärmel höher; seine Narben im Gesicht sind noch röter geworden.
„Willst du uns damit zur Arbeit zwingen?“ fragt er mit einem Blick auf Witolds Hammer. „Pass nur auf, dass wir dir damit nicht deinen Schädel einschlagen, du ... Du bist nicht mehr als wir auch: ein Polacke bist du, wie wir alle. Jawohl! Für die sind wir ohne Ausnahme nur Polacken! Wanzen. Wir sind nur so lange gut für sie, wie sie uns brauchen, dann ...“ Mit seiner Fußspitze vollführt er eine Drehung auf dem Lehmboden. „Aus! Weg damit!“
Der Hendryk meldet sich: „Wartest wohl darauf, dass die Fräuleins erwachsen werden, um dich hier in ein gepolstertes Nest setzen zu können, was? Spielst nur darum den Hund für den Alten!“
„Seid vernünftig, Männer. Kommt!“ mahnt der Adam. Er geht ohne sich um die anderen zu kümmern an seinen Webstuhl.
„Ach du Rindvieh!“ schreit der Ignacy hinter ihm her. „Fürchtest dich vor dem Hammer, den der Dämlack mit sich herumschleppt? Wenn ich Pause mache, dann mache ich Pause! Und was ich in meiner Pause treibe, das geht niemanden etwas an!“
„Jetzt ist aber keine Zeit, um Pause zu machen“, sagt der Witold.
„So, jetzt ist keine Zeit, um Pause zu machen, sagt der!“ höhnt der Ignacy. „Er wird mir sagen, wann ich mich verschnaufen darf, ja? Hast schon ganz die Manier der Deutschen angenommen!“
Der Hendryk hat sich wie der Adam auch an seinen Webstuhl gesetzt, aufrecht wie eine Rohrdommel und ebenso gespannt. Der Adam raunt ihm etwas zu, worauf der Hendryk seinen Kopf schüttelt.
„Nimm Vernunft an, Ignacy. Der Meister wird mich heute Abend fragen, wie es gegangen ist ...“
„Ja, ja, ja! Und natürlich wirst du ihm alles brühwarm auftischen. Dazu hat er dich doch in den Betrieb geholt, nicht wahr, du Bluthund. Ihm alles zu erzählen, das ist deine Aufgabe, nicht wahr? Eine schöne Aufgabe hast du, das muss ich schon sagen! Andere bespitzeln, sie antreiben und schließlich beim Alten anschwärzen. Der ist noch stolz auf diese Aufgabe“, ruft Ignacy den anderen zu.
„Ignacy!“ ruft der Hendryk über seiner Arbeit. „Laß es genug sein! Gib endlich Ruhe. Lass ihn gehen.“
„Nun, halte ich ihn fest? Kann er nicht gehen, wohin er will? Ich halte ihn doch nicht! Denkst du, ich fasse so etwas mit meinen Händen an?“
Er lacht gallig. Die verzogenen und schrundigen Narben entstellen sein Gesicht und machen es zur Fratze. Schließlich, als er begreift, dass er von den anderen keine Unterstützung bekommt und allein nichts ausrichten kann, spuckt er dem Witold vor die Füße.
„Wie mich das hier alles ankotzt!“ sagt er und geht endlich auch an seinen Arbeitsplatz.
Hinter der Tür, im Flur, hört der Witold zuerst den Ignacy lachen, dann lachen auch die beiden anderen mit.
Amalie schiebt ihrem Mann den Teller über den Tisch. Er ist spät nach Hause gekommen; dass sie sich gesorgt hat, das sagt sie ihm nicht. Abwartend sitzt sie ihm gegenüber und sieht zu, wie er ißt. Als er in den Hof eingefahren ist, hat er zuerst nach dem Witold gerufen. Sie haben sich leise besprochen, dann ist er zu ihr gekommen.
Mitunter blickt der Mann sie über den Teller hinweg an, aber sie kann an seinem Gesicht nicht ablesen, ob es gute oder schlechte Dinge waren, die er mit seinem Bruder besprochen und was er erreicht hat; Jendrik lässt sie warten, und so wartet sie eben; sie kennt seine Art.
Weil das Stummsein ihr unbehaglich wird, sagt sie: „Heute hat die Rosa wieder einen schlimmen Tag. Das Mädel sagt ja nichts, aber die Tränen sind ihr vor lauter Kopfstechen nur so gelaufen ...“
„Ich habe einmal gehört“, brummt der Jendrik auf seinen Löffel. „dass sich so etwas ändern kann, wenn sie erwachsen wird. Oder auch, wenn sie ein Kind bekommen hat.“
„Jesus Maria! Soll sie bis dahin warten?“
Der Mann hebt die Schultern, dann meint er: „Die Rosa wird das ihr Leben lang ertragen müsse, Malchen, denn sie wird nie Kinder bekommen; kannst du dir einen Mann vorstellen, der einen Menschen wie die Rosa nehmen wird?“
„Sag das nicht, sie ist ein guter Mensch.“
„Ja, das ist sie. Aber der Mann müsste dann auch von demselben Holz sein. Und zwei Schwachsinnige? Wie soll das gehen? Und wenn ein anderer, ein Normaler, ein Gesunder sie nimmt, Malchen, dann wird sie es haben wie ein Hund.“
Er lässt sich den Teller noch einmal füllen, und während er zu essen beginnt, fragt sie ihn endlich: „War es ein gutes Gespräch mit deinem Bruder?“
Er nickt; damit muss sich die Frau erst einmal zufrieden geben. Später, als er auf der Ofenbank sitzt, sagt er: „Ich bin zum Umfallen müde. Was ist die härteste Arbeit in der Webstube oder im Feld gegen das Zuhören, das Rechnen, gegen angestrengtes Nachdenken! Und dann auf der Heimfahrt das Kind neben mir! Diese Fragerei, sein pausenloses Schwadronieren ... Der Junge wird vierzehn Jahre alt, aber der redet manchmal wie ein kleines Kind!“
Schweigend hat die Frau neben ihm auf der Bank zugehört, wo sie Spitzen häkelt, mit denen sie ein Kopfkissen und Tischtücher einfassen will. Das, was Jendrik vom Bertel sagt, empfindet sie wie eine Stichelei gegen sich. Nach ihrer Meinung ist dieses Kind das verständigste und zuverlässigste von allen. Außerdem ist ihr keines ihrer Kinder so zugetan wie Bertel. Und auch sie liebt ihn in einer besonderen Weise. Sie liebt sie alle, aber mit Bertel ist es noch anders. Er hat ein Gespür für das, was die Mutter empfindet, denkt die Frau, und er lässt es sie auch wissen. Liebte sie ihn nicht in besonderer Weise, dann wäre sie damals nicht derart aus der Rolle gefallen, als der Webstuhl über den Jungen hinweg rutschte.
Amalie erinnert sich, wie er nach dem Unfall ihrer Mutter zu ihr gekommen ist, um sie zu trösten. Das Kind war fünf Jahre alt, als sich dieses zutrug:
Ihre Mutter, Anna Plaschke, stammte aus der Gegend von Plock, da wo die Weichsel sich zu einem See verbreitert und man sich von einem Fährmann helfen lassen muss, um ans jenseitige Ufer zu gelangen. Die Mutter lebte abgelegen in einem niedrigen, geräumigen Haus, das inmitten eines von einem hohen Zaun gesicherten Gartens lag, bei ihrem Sohn.
Anna Plaschke hatte frühzeitig die Aufgaben der alten Frau auf dem kleinen Anwesen übernommen. Sie meinte sich darin nützlich machen zu müssen, dass sie bei Wind und Wetter mit einer Kiepe durch die Gegend streifte, um Brennmaterial für den Winter zu sammeln, so dass ihr Sohn sie anfangs ein wenig aufzog, später dann sogar mit der alten Frau schimpfte, weil er nicht wusste, wo die Äste und Tannenzapfen sicher vor dem Regen untergebracht werden sollten.
An einem Spätsommerabend ist es gewesen, dass Anna Plaschke, gebückt unter der Last ihrer Kiepe, den Hof überquerte, um hinter dem Verschlag das Gesammelte abzuladen. Langsam war sie gegangen, die tiefstehende Sonne blendete sie, darum hatte sie ihr Kopftuch weit ins Gesicht gezogen.
Im Frühjahr hatte sich ihr Sohn einen Zuchtbullen gekauft, ein wildes und kaum zu bändigendes Tier, dass er nur mit einer Stange führen konnte, die er an einem Ring befestigt hatte, den sie dem Bullen durch die Nase gezogen hatten. Außerdem war an seine Hörner eine dicke Eichenplatte gebunden, so dass er nur das sehen konnte, was er vor der Nase hatte. Ohne dass es von jemandem bemerkt worden war, hatte der Bulle im Stall die Platte vor seinen Augen zertrümmert, hatte sich losgerissen und stand in der Stalltür, verwirrt von der Weite, die er sah, vielleicht auch geblendet von der untergehenden Sonne, die er so noch nie gesehen hatte. Die alte Frau, die schräg an ihm vorüberzog, erregte ihn. Blitzschnell war er auf sie losgestürmt, schnaubend und mit gesenktem Kopf, und hatte mit der Spitze seines Hornes die Kiepe erwischt. Die alte Frau wurde einmal um die eigene Achse gewirbelt und gegen die Schuppenwand geschleudert. Dabei stieß sie mit dem Gesicht gegen einen herausragenden Nagel, der ihr das linke Auge aus dem Kopf riss. Ihr gellendes Geschrei machte den Bullen stutzig und erst einmal für einen neuen Angriff unfähig, so dass er sich wie eine harmlose und sanfte Kuh an seinen Platz führen und anketten ließ.
Die Leute waren zusammengelaufen, und irgend jemand hatte der alten Frau das heraushängende Auge wieder in die Höhle gestopft. Sie aber stand ganz krumm und wackelig da und hielt sich die Schulter und klagte über Schmerzen, die sie im Rücken und in der Brust hatte.
„Er hat sie im Rücken getroffen“, glaubte jemend von den Leuten zu wissen, der auf dem Anwesen von Amalies Bruder arbeitete; vorsichtig rieb der Mann die schmerzhaften Stellen, worauf die Frau noch mehr schrie und nach ihm schlug.
„Wir brauchen den Schäfer! Der Schäfer muss her. Wenn hier jemand helfen kann, dann nur er. So lauft doch und holt ihn!“ schrie die Schwiegertochter der alten Frau.
„Und das Auge? Mutter, was ist mit Ihrem Auge?“ fragte der Sohn. Die Alte winkte ab. Das war wohl nicht weiter schlimm gewesen. „Mutter, Ihr Auge hing heraus. Haben Sie denn da keine Schmerzen?“
„Hier, hier“, jammerte die Mutter und fuhr sich mit den Händen über die Seiten und die Schultern.
„Der Schäfer wird sofort kommen. Der wird Ihnen helfen, Mutter.“
Der Schäfer war gekommen; er legte die alte Anna Plaschke auf den Lehmboden und befühlte und beklopfte sie lange, und hin und wieder bewegte er vielsagend und auch zweifelnd den Kopf dabei. „Hier muss es sein!“, stellte er fest, drehte die Alte auf die Seite und setzte sich auf ihre Hüfte und bog sie etwas.
Anna Plaschke schrie auf und quiekte wie ein gestochenes Schwein und verlor das Bewusstsein; viele Tage lag sie da wie eine Tote. Die Kinder waren alle gekommen und saßen verzweifelt an ihrem Bett und warteten, dass sie endlich die Augen aufschlage.
Auch Amalie war gekommen, und die vier Kinder hatte sie mitnehmen müssen, den Berthold und die Adelheid, die Rosa und den Edmund, dessen erster Geburtstag in die Zeit fiel, da sie am Krankenbett ihrer Mutter saß und wachte.
Als Anna Plaschke erwachte, klagte sie nicht nur über ein Stechen und Reißen im Rücken, auch der Kopf tat ihr weh, und auf dem linken Auge konnte sie nichts mehr sehen. Sie war darauf blind geworden.
Von diesem Unfall sollte sich die alte Frau nicht mehr erholen. Wenn es möglich war, dann ließ sie sich ans Fenster führen, um mit dem gesunden Auge auf die vom Wind bewegten Bäume oder die ziehenden Wolken zu starren; aber meistens lag sie mit zusammengekniffenem Mund im Bett, das Auge bewegungslos auf einen Punkt geheftet, und wenn sie angesprochen wurde, dann ließ sie sich mit der Antwort Zeit, so dass sie oft den Eindruck erweckte, als könnte sie auch noch schlecht hören.
Die Großmutter war dem kleinen Berthold unheimlich, er fürchtete sich vor ihr und wich seiner Mutter nicht von der Seite. Wenn er nicht bei den kleinen Schwestern war, dann saß er still an Amalies Seite und wandte kein Auge von der schweigsamen, verbissen daliegenden Großmutter. Wenn es für ihn unerträglich wurde, dann schlang er seine Arme um den Hals der Mutter und versteckte sein Gesicht unter ihrer Achsel. „Mutter, bist du traurig, weil die Großmutter liegen muss?“, fragte er.
Amalie nickte.
„Wo tut es ihr weh?“
„Überall. Im Kopf, im Rücken ...“
„Aber die weint doch nicht. Die liegt doch ganz still, siehst du? Die schläft sogar; die Großmutter wird gesund! Du brauchst nicht mehr traurig zu sein. Du brauchst auch nicht mehr zu weinen.“
„Bertel, ich weine doch gar nicht.“
„Doch, doch!“ das Kind hatte ernsthaft genickt. „Immer, wenn du meinst, ich sehe es nicht, dann weinst du.“
Und dieser kindliche Trost rührte sie. Oft, wenn er so zu ihr sprach, dann ließ sie ihn sitzen und ging hinaus, er sollte nicht sehen, dass er es gewesen ist, der sie mit seinen unbeholfenen Tröstungsversuchen zum Weinen gebracht hat.
Das fällt der Frau jetzt ein, als sie neben ihrem Mann auf der Ofenbank sitzt und ihm zuhört, wie er in seiner Ungeduld das Kind beurteilt und an dem Jungen herummäkelt.
„Willst du mir nicht sagen, was ihr besprochen habt?“ fragt sie ihn.
„Nun, zuerst einmal dieses: ich werde für ihn arbeiten.“
Die Frau lässt die Handarbeit in den Schoß fallen, sie versteht nicht, wovon er spricht. Sie beugt sich vor: „Wie soll das gehen: du arbeitest für ihn? Hat er dir nicht seine Webstühle überlassen? Und jetzt – war die ganze Arbeit mit dem Umbauen umsonst, Jendrik?“
„Nein, nein. Wir weben hier im Haus weiter wie bisher. Aber wir weben für ihn.“
„Du willst das Tuch nicht mehr an den Juden verkaufen, sondern an deinen Bruder?“
„Ja, das will ich.“
„Sind wir vom Juden nicht gut bezahlt worden?“ fragt die Frau.
„Für gutes Tuch, gab es gutes Geld, das ist wahr. Aber mein Bruder, Amalie, nimmt uns alles ab, was wir ihm liefern! Er steckt seine Finger nicht in die Ballen und wühlt darin herum und reißt sie auf der Suche nach einem Fehler auseinander, wie andere es machen. Und du weißt, oft hatte dieser oder jener an vielen Ballen etwas auszusetzen. Ja, mit dem Anstieg unseres Ansehens trauen sie sich nicht mehr, so offen wie früher nach Webfehlern zu suchen. Aber hin und wieder wagt es doch jemand, und dann liegt die Ware hier und lässt sich nicht verkaufen und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. So, wie ich es jetzt machen werde, das, Malchen, ist richtig. – Und es wird uns nicht enttäuschen“, fügt er überzeugt hinzu.
Die Frau kann das nur schwer glauben. Sie seufzt etwas. Von dieser Abmachung mit dem Schwager hält sie zuerst nicht viel. Sie fühlt sich, als stünden sie durch diesen Handel vor einem Risiko, dessen Ausgang niemand von ihnen abschätzen kann. Sie weiß, dass der Schwager ein erfahrener und gerissener Geschäftsmann ist, und so wittert sie auch hierbei nichts anderes als einen Winkelzug, bei dem ihm die Familie seines Bruders nur nützlich sein kann. Sie sagt: „Ja, er hat seinen Gewinn im Kopf, der Stanislaus. Und damit hat er es weit gebracht. Wie kann er uns die minderwertigen Ballen abnehmen und dafür auch noch bezahlen?“
„Ich habe sein Wort, dass ich nicht verlieren, sondern nur gewinnen werde. Malchen, wenn du wüsstest, wohin seine Beziehungen reichen! Polen und Deutschland sind ihm zu klein. Seine Ware, sagt er, geht nach ganz Europa. Sogar bis nach Asien ...“
Die Frau hört ihm staunend, aber doch ungläubig zu. Neuerungen und Veränderungen, das weiß sie, haben ihr immer Angst eingejagt. Und von dieser Neuerung hängt ihre Existenz ab, die Existenz und auch die Zukunft ihrer Kinder.
„Wir sind dabei aufzubauen“, sagt sie mehr für sich. „Und ich habe Angst, dass wir stattdessen zerstören.“
„Nein, wir bauen auf, Malchen!“ ruft der Mann hoffnungsvoll und überzeugt. „Ich sage dir: wir bauen auf, wie es keiner vor uns für möglich gehalten hätte!“
„Gebe es Gott, Jendrik.“
Er ist aufgestanden. Zärtlich, wie sie es lange nicht mehr erlebt hat, umfasst er ihre Schultern. Sie riecht seinen Geruch, den Geruch eines kräftigen und gesunden Mannes, der sie früher erregen und wild machen konnte.
„Ich möchte, dass du Recht behältst, Jendrik.“
„Ich möchte das doch auch, meine kleine Wildgans. Glaube mir, wenn ich davon nicht überzeugt, wenn ich nicht ganz sicher wäre, – Malchen, ich hätte niemals eingewilligt.“
„Ich weiß nicht, ob du stark genug bist, deinem Bruder etwas abzuschlagen.“
„Stanislaus hat zu seiner Webereifabrik auch noch eine Spinnerei eingerichtet. Das wollte ich dir auch noch sagen. Alles Garn, das wir in Zukunft verarbeiten werden, wird er uns liefern. Er sagt, dass er schon halb Lodz damit versorge.“
„Das auch noch?“
„Ja, das auch noch. Ich brauche dafür einen großen, eigenen Raum.“
„Du wirst also wieder anbauen.“
„Ich muss, wenn ich das wagen will.“
„Ja, du musst. Denn du hast ja schon Ja dazu gesagt.“
„Mehr noch, meine Wildgans: ich habe unterschrieben!“
„Was hast du?“
„Ja, unterschrieben! Als ich überzeugt war, das Richtige getan zu haben, als ich ihm mein Versprechen in die Hand schlagen wollte, da hat er über mich gelacht, ja! ‚Große Geschäfte besiegelt man heutzutage nicht mehr mit Handschlag, wie es unsere Väter getan haben!‘ hat er gesagt. ‚Weißt du, Bruder, Vereinbarungen von einem solchen Ausmaß, die werden nur noch unterschrieben!‘ Ja, und dann habe ich ihm, nachdem er mir das Schreiben vorgelesen und erklärt hat, meinen Namen unter den Vertrag gemalt.“
Nein, auch dieses Großartige kann ihr noch nicht das Vertrauen in die Sache geben. Sie braucht eben ihre Zeit, sie ist nicht nur ein vorsichtiger Mensch, ist auch ein schwerfälliger Mensch. Sie weiß das. Der Mann sagt: „Malchen, jetzt wird nicht mehr angestrickt – jetzt wird auch bei uns expandiert! So nennt mein Bruder das. Ich habe mir dieses Wort gemerkt.“
Sie sieht aus, als habe sie ihm zugehört, aber mit ihren Gedanken ist die Frau woanders. Sie lässt es zu, dass er ihr Gesicht zwischen die Hände nimmt und es zu sich aufhebt. Bekümmert sagt sie: „Wenn wir die Kraft dazu haben ... Dein Bruder, ja, der hat sie. Und seine Frau, die Antonya, die hat sie auch. Aber wir, Jendrik? Einen solchen Sprung, den hat niemand vor uns gewagt.“
„Wie sollst du das alles auch sofort verstehen können, du kleine Wildgans, du? Ich verstehe es ja auch nicht ganz.“
„Siehst du – und das macht mir Sorgen.“
„Das sind unnötige Sorgen, die du dir machst, Malchen, nichts als unnötige Sorgen. Wir haben meinen Bruder an der Seite!“
„Ich möchte ihm auch so vertrauen können bei der Sache, wie du ihm vertraust. Aber, Jendrik, auch der Gescheiteste macht Fehler.“