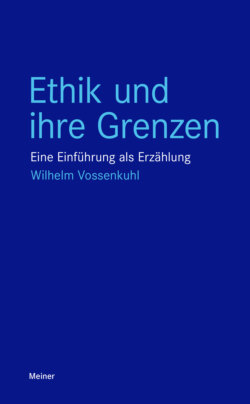Читать книгу Ethik und ihre Grenzen - Wilhelm Vossenkuhl - Страница 8
SORGE
ОглавлениеSittlichkeit und sittliche Gefühle sind nicht nur eng mit der Lebensstimmung der Sorge verbunden, sondern von ihr abhängig. In der Einleitung wies ich darauf hin, dass die Sorge nicht nur eine helle, das Leben bewahrende und schützende, sondern auch eine dunkle, das Leben gefährdende Seite haben kann. Entscheidend ist das Maß der Sorge. Zu wenig ist ebenso gefährdend wie zu viel. Zwischen sorglos und ängstlich müssen wir das rechte Maß der Sorge finden, weil das sittliche Leben vom rechten Maß der Sorge abhängig ist. Die Sorglosigkeit kann verantwortungslos, und die übermäßige Ängstlichkeit kann erdrückend sein. Beides gefährdet die Sittlichkeit.
Das Verständnis der ›Sorge‹ hat eine literarische Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte, auf die ich kurz eingehe, verändert ihre Bedeutung aber nicht. Wenn von ›Sorge‹ die Rede ist, denken Philosophen weniger an Goethe, sondern eher an Heidegger. Das ist nicht ganz gerecht, weil Heidegger selbst, vermittelt durch Konrad Burdachs Studie Faust und die Sorge (1923), zuerst an Goethe dachte und sich dann die Sorge für sein eigenes Denken aneignete. Genauer nachlesen können wir dies bei Sebastian Kaufmann (Heidegger liest Goethe, 2019, 21). Die Anregung durch Goethe ist in Heideggers Gedanken zur Sorge nur noch indirekt und vage erkennbar. Ich gehe auf seine Gedanken ein, obwohl sie den Zusammenhang zwischen der Sorge und der Sittlichkeit nicht unmittelbar berühren.
Heidegger sagt in Sein und Zeit über die Sorge, sie sei ein Werden zu dem, was der Mensch sein kann. Der Raum dieses Werdens sei die Freiheit. Das Freisein des Menschen »für seine eigensten Möglichkeiten« sei eine Leistung der Sorge (1967, 199). Das »In-der-Welt-sein« sei »wesenhaft Sorge« (193), und dieses Grundphänomen könne mit nichts erklärt werden, was es in der Welt gibt. In der Sorge sieht Heidegger die grundlegende Weise des Daseins. In ihr liege »das Sein des Daseins beschlossen« (231). Dieses Dasein definiert er als »Sich-vorweg-schon-sein-in« der Welt (249, 192). Dasein sei ein Entwurf, der in der Sorge »gründet« (259). Heideggers nächster Gedanke ist der Tod, das »Sein zum Ende« (252) und sein übernächster ist das »Gewissen als Ruf der Sorge« (§ 57, 274). Der Zusammenhang von Sorge, Tod und Gewissen ist das Spannungsfeld des Daseins, dem wir in Sein und Zeit literarisch begegnen.
Die Sorge hat für Heidegger eine ontologische und nur indirekt über den Tod und das Gewissen eine sittliche Bedeutung, die er aber nicht anspricht. Die Lebensstimmung, von der ich spreche, ist auch eine Daseinsstimmung. Deswegen können wir ihr in Heideggers Worten zubilligen, ›wesenhaft Sorge‹ zu sein. Damit wird aber nicht sichtbar, wie die Sorge wirkt, und was sie wirklich tun kann. Ontologisch bleibt die Sorge ein Gedanke, der abstrakt, farblos und frei von Schwankungen ist. Die Bedeutung der Sorge für das Leben wird postuliert, aber nicht so beschrieben, dass wir ihre Bedeutung für das eigene Leben erkennen können.
Anders verhält es sich mit der Sorge, die Goethe im Faust beschreibt. Ich wiederhole noch einmal seine Verse: »Die Sorge nistet gleich im tiefen Herzen, / Doch wirket sie geheime Schmerzen, / Unruhig wiegt sie sich und störet Lust und Ruh« (V. 644 – 646). Dies trifft die Unruhe stiftende, gefährdende Lebensstimmung der Sorge. Das Maß dieser Sorge entspricht Fausts verzweifelter Verfassung. Im »Zweiten Teil« des Faust erscheint die Sorge als eine von vier »grauen Weibern« (V. 11384 – 11498) um »Mitternacht«.
Der Kommentator Albrecht Schöne (1925 – 1952) nennt dies »Endzeitangabe« (2003, 732) und weist auf die unterschiedlichen Deutungen der Sorge hin, als »Dämon«, als »qualvoll beengende Gewalt« (733). Dabei ist Faust sorglos in seiner rastlos blinden Tätigkeit (734). Michael Jaeger deutet Fausts Bewegungsdrang als »Abwehr der Todesahnung«, als Ausdruck einer »existentialistischen Ontologie« (Fausts Kolonie, 427). Die Gestalt der Sorge stellt diesen verdrängenden Bewegungsdrang Fausts als »vermeintlich pragmatischen Vorsatz zum Weiterschreiten« bloß, wie Jaeger feststellt (429). Goethe beschreibt die Sorge als Ankündigung eines fatalen Endes: »Wen ich einmal mir besitze, / Dem ist alle Welt nichts nütze; / Ewiges Düstre steigt herunter, / Sonne geht nicht auf noch unter, /… / Glück und Unglück wird zur Grille, / Er verhungert in der Fülle« (V. 11453 – 56, 11461 f.). Faust will davon nichts wissen: »Hör auf! so kommst du mir nicht bei! Ich mag nicht solchen Unsinn hören« (V. 11467 f.). Albrecht Schöne erkennt in den Sorge-Versen, angelehnt an den Mediziner Nager, »alle klassischen Lehrbuchsymptome« einer Depression (2003, 739).
Da es um Fausts Ende geht, beschreibt Goethe nur die düstere, lebensgefährdende Sorge als Krankheitsphänomen, eine Krankheit zum Tode ohne die Selbst- und Glaubenszweifel, die diese Krankheit bei Kierkegaard (1813 – 1855) hat. Faust wehrt sich gegen die Selbstzweifel und will mit aller Macht die Einsicht in seine ausweglose Lage verdrängen. Diese Sorge kann nicht mehr lebensstiftend und lebensbewahrend werden. Sie ist nur noch zerstörerisch, eine das Leben gefährdende, verzweifelte Kraft. Paul Stöcklein beschreibt ausführlich die größere Gefühlseinheit der Sorge von der »quälenden Entschlußlosigkeit« bis zum quälerisch verzagten Reuegefühl (21960, 93–162, hier: 118).
Wir sollten beide Seiten der Sorge ernst nehmen, die helle und die dunkle, weil beide unser Dasein bestimmen können. Wir können uns, wie Heidegger annimmt, zu dem entwerfen, wer wir sein können, wir können uns aber auch wie Faust, den Tod und das eigene Versagen verdrängend, in blindem Bewegungsdrang verfehlen und in Depression verfallen. Es kommt auf das Maß der Sorge an, das zwischen einem erdrückenden Übermaß und einer törichten Sorglosigkeit liegen sollte. Die Sorge wirkt im moralischen Handeln, aber auch jenseits der Ethik. Sie mutet uns mehr zu als das, was ethisch gerechtfertigt werden kann, vor allem dann, wenn es um Entscheidungen über Leben und Tod geht.
Das Selbstverständnis, das wir der Sorge um unser Dasein verdanken, entsteht nicht in unseren sittlichen Gefühlen. Würden wir dies dennoch annehmen, würden wir Vorher und Nachher, das Spätere mit dem Früheren, verwechseln. Unsere Gefühle sind im Übrigen unzuverlässig und wechselhaft. Es hat keinen Sinn zu behaupten, dass wir sittliche Wesen sind, weil wir sittliche Gefühle haben. Damit würden wir nur sagen, dass wir sittliche Wesen sind, weil wir sittliche Wesen sind. Und was für welche (!), könnten wir gleich darauf resignierend bemerken. Das Normative als Normatives zu erklären, ist zirkulär, beliebig, manipulierbar und gedankenlos. Wir entfliehen damit der Schuldigkeit, die wir unserem Dasein gegenüber haben.
Den Anspruch der Schuldigkeit vertritt auch Heidegger, wenn er von der Sorge als Schuldigkeit, sich zu entwerfen, spricht (Sein und Zeit, 286). Er nennt die Schuldigkeit auch »Entschlossenheit« (297). Deren Bestimmtheit sei die Unbestimmtheit (298). Dies ist kein inhaltsleeres Paradox. Die Formulierung will zeigen, dass die Sorge nicht schon bestimmte Ziele hat, auf die wir uns richten können. Würde die Sorge fertigen Entwurfszielen folgen, wäre sie nicht nur ontologisch, sondern auch moralisch vorherbestimmt. Wir würden schon wissen, wohin wir gehen sollten und gegangen sein werden, bevor wir unser Dasein entworfen haben. Wir kennen nur die Schuldigkeit als Sorge um uns selbst, um die anderen, um die Natur und die Umwelt.
Mit der Sorge folgen wir keinem vorgefertigten Katalog von Maximen in dem Glauben, damit unserer Schuldigkeit gerecht zu werden. Wir leben mit einem gewissen Maß an Angst vor dem Scheitern, vor dem Ende des Daseins und vor dem sinnlosen, oberflächlichen Dahinleben. Wir sind offen für Glücken oder Scheitern. Das Scheitern ist nicht weniger wahrscheinlich als das Glücken. Wenn die Sorge von Sorgfalt und Hingabe begleitet wird, sind wir zur Sympathie und zum Wohlwollen anderen gegenüber fähig.
Die Lebensstimmung der Sorge verstehen wir ontologisch nur unzureichend, weil wir so ihre Verbindung mit der Sittlichkeit nicht verstehen. Heideggers Gedanke der »Geworfenheit« ins Dasein lenkt von dieser Verbindung sogar ab, weil er Voraussetzungslosigkeit suggeriert. Wir sind als Einzelne nicht ins Dasein geworfen, sondern sind Nachkommen in einer Welt, in der es schon andere gibt. Zuerst sind wir Nachkommen, dann erst Einzelne. Es entspricht der Ordnung unseres Daseins, zuerst in Beziehungen mit den Anderen in der Welt zu leben und dann erst allein und mit uns selbst.
Hartmut Rosa nennt diese Beziehungen ›Resonanz‹ (2018). Er meint damit Schwingungen, die sich überlagern und synchronisiert werden sollten, wenn wir ein gutes Leben führen wollen. Rosa versteht Resonanz zunächst angeregt durch Heidegger als »Art des In-der-Welt-Seins« (55). Heideggers Konzept der Sorge deutet er als »Aufrechterhaltung einer Resonanzbeziehung« (191). Wir verursachen selbst Schwingungen und empfangen die Schwingungen der Anderen und der Dinge in der Welt. Heideggers Konzept der Angst versteht Rosa als Verlust der Resonanzbeziehung.
Das Wort ›Resonanz‹ ist gut gewählt, weil es Senden und Empfangen, das Aktive und das Passive, Sprechen und Hören, Subjekte und Objekte, ich und die Anderen nicht trennt. Allen Dichotomien geht mit der Resonanz etwas voraus, was noch nicht geschieden ist, die Dichotomien aber beeinflusst. Die Relation bestimmt die Relata. Die fühlbaren, hörbaren und sichtbaren Beziehungen kommen vor dem eigenen Tun. Das ist beim Antworten offensichtlicher als beim Fragen und Sprechen, trifft aber auf beides zu. Auch die Sittlichkeit ist eine Beziehung vor dem eigenen Tun und Lassen. Das Tun und Lassen ist dann aber unausweichlich. Wir sind gefordert und aufgerufen, uns erkennbar zu machen. Die Sittlichkeit vereinzelt uns. Wir werden zu Handelnden. Die Resonanz unseres Handelns müssen wir dann verantworten und für uns selbst einstehen.
Über die Resonanz wirkt die Sorge im moralischen Raum unseres Lebens. Ob etwas aus allgemein geltenden Gründen und nicht nur aus sittlicher Gewohnheit zu tun ist, und ob etwas gegen schlechte Sitten getan werden soll, ist von der Sorge um das gute Leben bestimmt. Es geht um das gute Leben zu Hause und mit Menschen aus anderen Kulturen. Diese Sorge findet ihren Ausdruck in der gelebten Sittlichkeit. Thematisch wird die Sittlichkeit in der Ethik. Die Sorge wirkt damit über die Sittlichkeit in eine Ethik, weil es die Ethik nicht gibt.
Wir suchen nach einer Ethik, mit der wir unser Dasein gestalten können. Wenn uns nicht schon aus sittlichem Empfinden klar ist, was wir tun sollen, kann uns eine Ethik helfen, das, was wir sollen, zu begründen. Die nächste Frage ist aber, mit welcher Ethik dies gelingt. Die Lösung liegt nicht auf der Hand, weil keine Ethik so selbstverständlich wie eine Sitte gilt. Eine Ethik kann außerdem vielen Sitten widersprechen. Schließlich erheben viele Ethiken den Anspruch, allgemein, unabhängig von kulturellen Grenzen, zu gelten. Die Sorge um das Leben mit Menschen aus anderen Kulturen, die mit anderen Sitten leben, ist ein Gebot der Sittlichkeit, aber noch keine Ethik. Jene Sorge ist aber ein Motiv, die Gegensätze zwischen Sitten und Kulturen zu überbrücken, zumindest aber zu entschärfen und ihnen ihr gewalttätiges, lebensbedrohliches Potential zu nehmen.
Die Konflikte zwischen Sitten unterschiedlicher Kulturen legen nahe, dass eine gute Ethik hilft, regional geltende Sitten zu überwinden und zu ersetzen. Theoretisch ist dies einfach, praktisch nicht. Die Resonanz der sittlichen Beziehungen existiert vor jeder Ethik. Diese Resonanz kann in eine Ethik überführt und in ihr verstärkt, aber durch keine Ethik aufgehoben werden. Wir müssen den Resonanzraum der Sittlichkeit auch ethisch respektieren. Es wäre ungerecht, wenn wir uns ethisch zu Richtern über die Sittlichkeit anderer Kulturen machen würden. Dafür haben wir keine ethische Lizenz. Wir bilden unser sittliches Bewusstsein ja selbst zuerst in unserer eigenen Kultur. Wir lernen dabei, was sich gehört, und entwickeln ein Gefühl für das, was gilt. Ohne dieses sittliche Gefühl wüssten wir nicht, was es bedeutet, dass wir etwas tun oder lassen sollten, was gut oder schlecht ist. Dieses Gefühl ist etwas, was keine Ethik vermitteln kann. Wenn wir unser eigenes sittliches Gefühl schätzen, sollten wir dies auch Menschen anderer Kulturen zubilligen und nicht über sie richten.
Wir können uns das Verhältnis zwischen Sitte und Ethik am Verhältnis zwischen Dialekt und Fremdsprache klar machen. Die Sitten, für die wir ein Bewusstsein bilden, lernen wir wie unsere erste Sprache. Wir lernen erst einen Dialekt, dann die Hochsprache, zu der er gehört. Die sittliche Hochsprache ist die Sittlichkeit. Zu ihr gehören die Sitten, die wir zu Hause, aber besonders im Religions- und Schulunterricht kennenlernen. Verglichen damit ist jede Ethik eine Fremdsprache, die wir ebenfalls erlernen können. Wir können sie aber nur erlernen, wenn wir vorher schon sprechen können, also schon einen Dialekt (Sitte) und eine Hochsprache (Sittlichkeit) kennen. Außerdem können wir eine Fremdsprache nur erlernen, wenn wir wissen, was eine Grammatik ist. Die Grammatik, die wir für eine Ethik benötigen, enthält viele Begriffe, u. a. des Guten, des Sollens, der Pflicht, der Verantwortung und des Zusammenhangs zwischen ihnen. Jede Grammatik ist eine begrifflich anspruchsvolle, abstrakte Angelegenheit, die uns einiges abverlangt und viel Wissen voraussetzt. Wir müssen wissen, was ein ethisches Prinzip von einem Gebot unterscheidet und wie das eine vom anderen abhängt. All das benötigen wir nicht für das sittliche Bewusstsein, das wir als Erstes erwerben.
Keine Grammatik vermittelt die sprachlichen Grundlagen, die wir benötigen, um sie zu verstehen. Genauso verhält es sich mit jeder Ethik. Keine Ethik vermittelt das sittliche Bewusstsein für unser Verständnis all der Begriffe und ihrer Zusammenhänge, die in ihr eine Rolle spielen. Der Ethikunterricht in der Schule kann nur dann erfolgreich sein, wenn die Schüler schon ein sittliches Bewusstsein für das haben, was sich gehört. Wir erwerben keine Ethik ohne sittliches Bewusstsein, ähnlich wie wir keine Fremdsprache ohne unsere Sprachfähigkeit erwerben können. Eine Ethik kann fehlendes sittliches Bewusstsein nicht ersetzen. Ein guter Ethikunterricht nimmt darauf Rücksicht und ignoriert oder verurteilt nicht das bis dahin erworbene sittliche Bewusstsein der Jugendlichen. Selbst wenn es das Ziel des Unterrichts ist, schlechte Sitten zu überwinden, sollte der Unterricht bei den guten Sitten beginnen und sie vertiefen. Es wäre ähnlich unsinnig, wenn mit dem Erwerb einer Fremdsprache die Muttersprache oder der heimische Dialekt ignoriert oder verurteilt würden. Beides wird leider häufig getan.
Die Rückbindung des Ethikunterrichts an die Sittlichkeit ist unverzichtbar, weil die guten Sitten die Wurzeln und Grundlagen des sittlichen Bewusstseins sind, ohne die keine gute Ethik gelten kann. Es gibt auch schlechte Ethiken. Sie sind daran erkennbar, dass sie die Sittlichkeit und das gute sittliche Empfinden verletzen und dem sittlichen Bewusstsein der Menschen widersprechen. Eine Ethik, die dem Egoismus und dem Selbstinteresse des Einzelnen einen Vorrang vor allen anderen Interessen einräumt, wird dem guten sittlichen Bewusstsein vieler, vielleicht der meisten Menschen widersprechen. Ähnliches gilt für eine Ethik der Vergeltung, welche die Grausamkeit gegen Straftäter zur Abschreckung vor künftigen Straftaten bis hin zur Folter rechtfertigt. Der Schritt von der Anwendung der Ethik der Vergeltung auf Andersdenkende für ihr Anderssein ist nicht groß. Eine Ethik des Egoismus toleriert auch das grausame Töten von Tieren. Und auch dies widerspricht dem guten sittlichen Bewusstsein vieler, vielleicht der meisten Menschen.
Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass der Ethikunterricht in den Schulen in unserer Zeit schlechte Ethiken vermittelt. Es gab rassistische und fremdenfeindliche Ethiken in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. Sie existieren auch heute in vielerlei Gestalt im Alltag, in der Wirtschafts- und Arbeitswelt vieler Gesellschaften. Wenn ihnen Jugendliche begegnen, deren sittliches Bewusstsein davor durch Hilfsbereitschaft, die Achtung vor der Person des Anderen und Fremden, die Sorge für sich und die anderen geprägt war, werden sie nicht mehr wissen, was nun eigentlich gilt. Eine Ethik des Egoismus kann nahtlos an das ebenfalls in vielen Gesellschaften vorhandene schlechte sittliche Bewusstsein anknüpfen. Keine Gesellschaft ist ohne Unsitten und Amoral. Die Irritation, die der Gegensatz zwischen einer schlechten Ethik und den guten Sitten auslöst, kann den Glauben an die Geltung der Sittlichkeit und einer guten Ethik untergraben. Dann fehlt einer guten Ethik ihre Geltungsgrundlage. Sie hat dann keine Wurzeln und ist auch nicht zuverlässig wirksam. Wenn der Ethikunterricht in Schulen nicht an eine geltende Sittlichkeit anschließen kann, ist er unwirksam. Es fehlt ihm die Grundlage einer guten Ethik, nämlich die Einsicht in das, was sich gehört.
Eine gute, an der Würde des Menschen und den Menschenrechten orientierte Ethik kann aber auch das zu Hause erworbene sittliche Bewusstsein verletzen, wenn dies von Verachtung und Gewalt gegen Andersdenkende und Frauen und von Rache gegen diejenigen, welche die eigene Ehre verletzt haben, geprägt ist. Opfer dieser Rache aus verletzter Ehre können die eigenen Verwandten auf grausame Weise werden. Es sind in vielen bekannt gewordenen Fällen Frauen, die ihren eigenen Weg gehen und sich nicht den Sitten ihrer Ethnie, ihrer Verwandten und ihres Clans unterwerfen wollten.
Die Bildung der Sittlichkeit in der Schule ist angesichts eines solchen archaischen sittlichen Bewusstseins durch die abstrakten Angebote des Ethikunterrichts schwer möglich, aber nicht unmöglich. Die Teilnehmer des Unterrichts werden für die Bildung ihres sittlichen Bewusstseins vielleicht von der Lektüre von Anne Franks Tagebuch mehr gewinnen als von einem Ethik-Lehrbuch. Es ist erschütternd zu lesen, dass Anne Frank (1929 – 1945) kurz vor ihrer Deportation 1944 in das Konzentrationslager Bergen-Belsen und ihrem Tod 1945 schreibt, in den Menschen herrsche eine zerstörerische Kraft zu töten, die Kriege verursache. Es seien nicht die Politiker allein schuld an Kriegen. Die Kriege werden so weiter gehen, wenn die gesamte Menschheit sich nicht ändere, schreibt die fünfzehnjährige Anne.
Dieser erschütternde Appell richtet sich an uns alle. Vielleicht erreicht er auch diejenigen, die von einem archaischen sittlichen Bewusstsein geprägt sind. Es wird aber kein direkter Weg von einem archaischen sittlichen Bewusstsein zu einer guten Ethik führen, bevor nicht die Sittlichkeit und die Bedeutung der guten Sitten, die auch von diesen Menschen anerkannt werden, vertieft worden ist. Der Ethikunterricht darf die Selbstachtung der Jugendlichen nicht verletzen, auch wenn sie schlechtem Verhalten zugrunde liegt, weil ohne Selbstachtung die Bereitschaft, das eigene sittliche Bewusstsein zu korrigieren, nicht denkbar ist. Denn ohne Selbstachtung kann niemand Sorge für sich und andere tragen.
Die Selbstachtung kann gestärkt werden, wenn die Bedeutung der Gastfreundschaft, der Hilfsbereitschaft und anderer guter Sitten, die auch für diese Menschen gute Sitten sind, im Unterricht ernst genommen werden. Wer versteht, dass diese guten Sitten den archaischen Rache- und Verachtungssitten widersprechen, wird erkennen, dass nur die guten Sitten Grund zur Selbstachtung geben. Der Widerspruch wird daran erkennbar, dass die Rache- und Verachtungssitten auch diejenigen treffen können, die sie vertreten. Die Menschen können zu Opfern ihrer eigenen Amoral werden. Es mag nicht einfach sein, dies jungen Menschen klar zu machen, vor allem dann nicht, wenn sie zu Hause das Gegenteil hören.
In jedem Fall müssen die Wurzeln der Sittlichkeit sorgfältig gepflegt und vertieft werden, bevor die Angebote einer Ethik mit ihren abstrakten Begriffen Aussicht auf Erfolg haben. Denn keine Ethik schafft mit abstrakten Begriffen die Sittlichkeit und ein gutes sittliches Bewusstsein und Empfinden. Die Selbstachtung ist Teil dieses Empfindens und das Empfinden selbst ist ein Ausdruck der Sorge der Menschen um sich selbst, um ihr Leben und das Leben der Anderen. Eine Ethik sollte auf der Grundlage eines guten sittlichen Bewusstseins gelten.