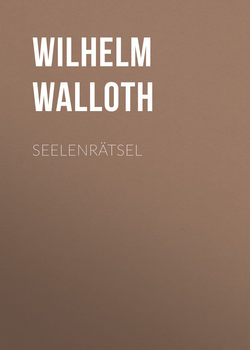Читать книгу Seelenrätsel - Wilhelm Walloth - Страница 3
III
Оглавление»Ich muß zurück nach München, liebe Mutter,« rief Eduard Enger, »hier, wo mir jede Anregung durch Gleichstrebende fehlt, gelingt mir kein Pinselstrich.« Eduard hatte sich das nördlich gelegene, eigentlich nicht zum Bewohnen bestimmte, sogenannte gute Zimmer des Forsthauses zum Atelier eingerichtet, da er beschlossen, einige Zeit bei seinen Eltern zuzubringen, um sich einesteils von den anstrengenden Studien zu erholen, andernteils sich mehr, als er es seither gethan, der Landschaft, dem Tierstück zu widmen. Das Zimmer, nicht größer und nicht höher wie die übrigen vier oder fünf des Hauses, mußte seine schwerfälligen Möbel dazu hergeben, Farben und Pinsel zu beherbergen; auf dem muldenförmig ausgesessenen Sopha, auf welchem Vater Enger sein Mittagsschläfchen zu machen pflegte, standen Rahmen; selbst der gutmütige, lederne Sorgenstuhl, in welchem der Urahne der Familie verstorben war, mußte sich herbeilassen, zum Aufbewahrungsort der Pinsel zu dienen. Zwar mochte der moderne Gewehrschrank ziemlich verdrießlich auf die Unordnung herabschauen; auch das Rehgeweih neben dem Spiegel reckte sich grimmig empor, aber die vorher kahlen Wände trugen ihren reichen Schmuck an halbvollendeten Bildern sehr befriedigt zur Schau. So saß denn Eduard in dem mit Skizzen aller Art beklebten, niedrigen Zimmer vor seiner Staffelei und führte jenes Bild, das wir bereits kennen, genauer aus. Nebenan in dem einfach behaglich eingerichteten Familiengemach deckte die Mutter den Tisch. Ihre Schicksale, die wir bereits kennen, hatten keine sichtliche Spur in ihrem Antlitz zurückgelassen, der Förster wußte die Erinnerung an dieselben zu verwischen. Nur eines fiel auf: sie war frühe gealtert; ein Augenleiden, das ihrem Blick einen starren Ausdruck gab, ebenso ein nervöses Zittern, das zuweilen ihren hageren Hals befiel, trug dazu bei, sie älter erscheinen zu lassen. Ob dieses Augenleiden in Verbindung mit den Lebenserfahrungen stand, würde schwerlich zu entscheiden gewesen sein. Wie vorsichtig prüfend sie die Teller stellte, wie unsicher sie nach dem Messer tastete. Der Sohn warf zuweilen durch die geöffnete Thüre einen besorgten Blick auf die Beschäftigte, die mit ihren mageren Armen über den Tisch fuhr. Die Bäume, die das Haus auf jener Seite dicht umgaben, warfen über das weiße Tischtuch, über das Geschirr und über das bleiche Gesicht der Frau einen grünen Schleier, der zuweilen zitternd seine runden Lichtflecken bewegte. Auf dem Schrank standen mehrere Bücher, die deutschen Klassiker, sogar griechische Schriftsteller in Uebersetzungen, welche der Förster billig erstanden und die er sich abendlich von seiner Frau hatte vorlesen lassen, solange deren Augen es erlaubten. Verstand er auch nicht alles, so gefielen ihm die Bücher doch, ja es war ihm, dem Ungelehrten, vielleicht mehr zum Bedürfnis geworden, zu lesen, als vielen der sogenannten Gebildeten. Auch schien die Familie bessere Tage gesehen zu haben, die Bruchstücke einer glänzenderen Haushaltung, z.B. ein Spiegel mit vergoldetem Rahmen, bewiesen das; Eduard hatte manchmal über frühere Verhältnisse nachgefragt, erinnerte sich auch eines größeren Hauses und einer Mühle. Der junge Maler war nicht mit sich zufrieden, seine Arbeit mißfiel ihm gründlich und manchmal zuckte es ihm in der Hand, das ganze Gemälde mit einem energischen Pinselstrich zu verunstalten. Es ging ihm gewöhnlich so. Er begann eine Arbeit mit außerordentlichem Enthusiasmus, bis er nach einigen Tagen die Lust daran verlor. Zwar waren ihm mehrere Bilder gelungen, aber es hatte dabei die beständige Ermutigung seiner Freunde bedurft, um ihn an diesen Arbeiten festzuhalten; hier fehlten ihm jene Ermutigungen, er fühlte sich nicht genug gesteigert und setzte sein Talent in seinen eignen Augen herab.
»Ich sehe Dir bereits eine Stunde lang zu,« sagte die Mutter, einen Teller in der Hand, nähertretend, »Du hast in dieser Stunde wenig gearbeitet. Auch bist Du so nachdenkend, was fehlt Dir denn, liebes Kind?« Sie legte ihre Hand auf seine Schulter, vergebens auf eine Antwort harrend. Nachdem er so einige Zeit hastig weiter gemalt, lachte er verdrießlich vor sich hin. »Es ist eine Thorheit, liebe Mutter.«
»Was ist Thorheit?« frug sie verwundert.
»Ei nun! Das Menschenleben überhaupt,« sagte er.
Frau Enger war andrer Meinung. Sie gab ihrem Sohne zu verstehen, das seien wunderliche Redensarten, an die er selbst nicht glaube, er möge nur den Geruch des Rehbratens einziehen, der aus der Küche herüberdränge, der werde ihn eines Besseren belehren. Eduard erklärte sich für überwunden, für völlig geschlagen, an den Rehbraten habe er freilich garnicht gedacht, als er sein großes Wort ausgesprochen, fügte jedoch, als sich die Mutter bereits zufrieden erklärte, mit seinen umgewandelten Ansichten hinzu: Wenn ihn seine Kunst nicht hielte, liebe Mutter, glaube mir, Dein Sohn wäre längst dem Leben davongelaufen. Frau Enger strich ihm über das krause Haar und betrachtete den Sohn kopfschüttelnd mit bekümmerten Blicken. Er muß krank sein, dachte sie, dies München hat seine Gesundheit angegriffen.
»Nicht wahr,« frug sie, »Du hast recht schlecht gegessen in München?«
Der Künstler lachte und meinte, sein Magen habe allerdings zuweilen Gelegenheit gehabt, das Verdauen zu verlernen.
»Nun, von was hast Du denn gelebt?« frug Frau Louise ängstlich. Eduard erzählte, daß das Stipendium von 600 Mark, das ihm der Graf Ibstein verschafft, nicht ausgereicht habe, die Modelle zu bezahlen und dabei auch auf die Gesetze der Ernährung Rücksicht zu nehmen. Er habe zum ersten Male die Segnungen des Kaffees empfunden. Da die Mutter eine nähere Erklärung des Wortes »Model!« wünschte, ließ sich der junge Mann hierauf nicht näher ein, sondern setzte ihr seine Absicht auseinander, sich hier in Ibstein für die Entbehrungen Münchens zu entschädigen.
»Hättest Du dem Vater gefolgt,« murmelte Louise, »er wollte einen Gärtner aus Dir machen; das Malen ist Dein Unglück, Du hättest jetzt Dein Brot.«
»Freilich, freilich,« bestätigte der Sohn, die Stirn runzelnd, »es ist mein Unglück, Gärtner hätte ich werden sollen. Du hast vollkommen recht.« Und er schleuderte nervös gereizt den Pinsel von sich. Die Mutter, erschrocken über ihr vorschnelles Wort, das ihr Kind so tief berührt, stammelte:
»Nein, nein, so meinʼ ichʼs nicht – male nur weiter, der Graf sagte doch, Du habest viel Talent – gewiß, dies schrieb mir auch Dein Freund Alfred.«
»Alfred hat Dir geschrieben?«
»Ja gewiß, ich will Dir den Brief zeigen.« Sie eilte an die Kommode und legte ihm den Brief des Freundes vor. Eduardʼs Züge nahmen, als er die belobende Stelle gefunden, sogleich einen mutigeren Ausdruck an.
»Er verstehtʼs,« sagte er, »nun, es mag sein. Alfred ist ein guter Junge, ich stehe nicht einmal sehr gut mit ihm, desto mehr freut mich sein Urteil.« Frau Louise sah immer noch traurig auf ihren Sohn herab. Als nun aber dieser, sich umwendend, zu ihr empor sah, gab sie ihrer Miene sogleich einen heiteren Ausdruck, durch welchen er jedoch den bekämpften Schmerzenszug noch durchleuchten sah.
»Gewiß, Du wirst Dir Dein Brod schon verdienen,« sagte sie, »später oder früher, es hat keine Eile, so lange wir noch leben. Deine Bilder sind ja gewiß schön, ich verstehʼs nicht, aber Alfred sagtʼs.«
Er faßte die Hand der alten Frau und versuchte die Heiterkeit, die sich seines Gemüts bemächtigt, auch der Mutter mitzuteilen.
»Alfred verstehtʼs,« sagte er, »der ist ein scharfer Kritiker und ein eminenter Maler. Weiß Gott, nun habʼ ich wieder Lust zur Arbeit.«
Nochmals griff er zu jenem Brief und las jene Zeilen mit freudiger Stimme sich selbst laut vor. »Ist bald Essenszeit?« frug er darauf, »wo bleibt Ludwig? Ich habe den Jungen heute noch nicht zu Gesicht bekommen.«
»Er ist in den Wald, den Vater zu Tisch zu bitten,« entgegnete die Mutter, die sich nun ausführlich über die verschiedenen Gewohnheiten des Försters, besonders über seine immer zunehmende schlechte Laune, zu verbreiten begann. »Es ist zuweilen schwierig mit ihm auszukommen,« seufzte sie, »er war immer barsch, je älter er wird, desto schlimmer wird es. Ich darf kaum drei Worte aussprechen, so werde ich zur Ruhe verwiesen, eine eigene Meinung darf ich natürlich nicht haben, überhaupt verstehe ich gar nichts, er allein ist allwissend und allmächtig.« Sie trocknete sich rasch die Augen mit der Schürze und gab ihrem Sohn mit einem gutmütigen, durch Thränen schimmernden Lächeln zu verstehen, er solle nicht weiter fragen, da sei nichts zu ändern und im Übrigen sei der Vater der beste Mann von der Welt. Ohne rechten logischen Zusammenhang berichtete sie sodann, daß der Vater heute Bäume fällen ließe, daß er nach solcher Arbeit müde nach Hause käme, es liebe die Suppe dampfend auf dem Tisch zu finden und daß man ihm alsdann auch ein Gläschen Rum nicht mißgönnen dürfe. Diese Bemerkung mit entschuldigendem Hüsteln begleitend, eilte sie an den Tisch zurück, ihr Werk zu beenden. Als man nun von weitem die fröhliche Stimme Ludwigs, vermischt mit Hundegebell, erschallen hörte, trat Eduard, sein Malzeug bei Seite legend, an das Fenster. Durch das Hofthor schritt, Ludwig an der Hand, von seinen Hunden umwedelt, der alte, weißbärtige Förster. »Hans, Hans!« erscholl seine Stimme über den Hof. Der Knecht, dem er gerufen, kam ihm aus einer Stallung entgegen; beide blieben im Hofe stehen, wie es schien, in ein Gespräch über Hundedressur vertieft.
»Hans,« rief der Förster darauf, »gib den Hunden zu fressen, dem Kato eine besonders reichliche Mahlzeit, er hatte sehr unter der Hitze zu leiden, das arme Tier. Nicht wahr, Alter?« Hiermit beugte er sich zu dem Hund hernieder, der keuchend die rothe Zunge aus dem Rachen hängen ließ und klopfte ihm auf den schweißbedeckten Rücken. »Darfst nicht so springen in der Hitze,« fuhr der Förster fort, freundlich den Hund anzureden, »aber das wird schmecken, das Fressen heutʼ, wie? Hans, daß Du dem kalten Wasser umʼs Himmels Willen warmes beimischst, ehe es die Tiere trinken.«
Eduard ergriff die Zärtlichkeit, mit welcher der Vater für seine Tiere sorgte, und doch ward ihm seltsam weh umʼs Herz, als er den alten Mann darauf mit solchem Ernst, solcher Wichtigkeit von Dingen sprechen hörte, die ihm so trivial, so gleichgültig vorkamen. Gewiß, er liebte seine Eltern und doch schob die Bildung, die er sich allmälig in der Fremde errungen, zwischen ihn und die Eltern eine dunkle, unübersteigliche Wand, seiner Liebe mischte sich eine Kälte der Gefühle bei, über die er selbst zuweilen schauderte. Die Kunst erzieht den, der sich ihr ergeben, zum Egoisten. Schon als er zum ersten Male vor Jahren entdeckt, daß die Eltern auch Fehlern, so gut wie alle übrigen Erdbewohner, unterworfen seien, stellte sich dies schneidende, kalte Schmerzgefühl bei ihm ein, das zersetzend auf seine Liebe wirkte. Jetzt konnte er eigentlich nur dann ein wärmeres kindliches Gefühl in sich erzwingen, wenn er sich beide, als alte hilfsbedürftige Leute, nicht als seine Erzeuger, vorstellte. Mit Trauer blickte er in die Vergangenheit zurück, da ihm das Wort: »Vater« noch der Inbegriff alles höchsten, heiligen gewesen. Wohin war diese Märchenzeit geschwunden und zu was ist die höhere Bildung, die der Kunstenthusiasmus verleiht, nütze, wenn sie uns solche Jugendgefühle raubt. War er denn eigentlich ein herzloser Mensch, der nicht lieben konnte? Dem widersprach doch zu sehr das Gefühl, das er für den kleinen Ludwig hegte. Wie wohl that ihm der aufmerksame, ehrfürchtige Blick des Knaben, welche Lust bereitete es ihm, den aufgeweckten Burschen heranzubilden und selbst seine oft auf Eigennutz beruhenden Schelmenstreiche, wie gerne verzieh er sie, wie fesselte gerade diese Schalkhaftigkeit ihn an den Jungen. Er wandte sich schmerzlich bewegt vom Fenster weg zur Mutter, die bereits, da sie von der Ankunft ihres Mannes Kunde erhalten, ein frisches Hemd am Ofen ein wenig wärmte.
»Seine Haare wurden in den letzten Jahren sehr grau,« sagte er leise, wie geistesabwesend, »auch scheint mir, daß ihm sein Asthma mehr zu schaffen macht, ihr müßt ihm das zuviele Arbeiten verbieten!«
Die Mutter beschäftigte sich gerade mit dem Austeilen der Suppe, die ihr Gesicht in eine Dampfwolke hüllte, die Gelegenheit, dem zurückgekehrten Sohn ihr Herz auszuschütten, konnte sie indeß nicht vorübergehen lassen.
»Nicht wahr, er arbeitet zu angestrengt?« fiel sie sogleich ein, ohne sich in ihrem Geschäft stören zu lassen, »da läßt er sich nichts dʼreinreden, wenn es sich um seinen Wald handelt.« Nun tadelte sie, die letzten Reste der Suppe in die verschiedenen Teller ausgießend, eifrigst diese übertriebene Liebe des Mannes für die grünen Bäume, die ja, wie sie meinte recht schön, ja sogar, was mehr, nützlich seien, die es jedoch mit einer regelrecht gebauten Straße in der Stadt keineswegs aufnehmen könnten. Ihrem Manne goß sie sodann den Teller bis an den Rand voll, ein kleines, gefülltes Liqueurgläschen in die Nähe schiebend.
»Denke Dir nur,« fuhr sie fort, während Eduard sinnend zuhörte, »als er im vorigen Jahre einige Wochen hindurch krank lag, mußte ihm der Knecht das ganze Bett mit frischen Buchenzweigen umstecken, damit er stets an seinen Wald erinnert würde, von dem er getrennt war.«
Auf Eduard machte dieser kindliche Zug im Charakter des Vaters zwar einen tiefen, doch mehr einen ästhetischen Eindruck Die Liebe des Alten zum Wald berührte, wie er sich, mit sich selbst unzufrieden, eingestand, weniger sein Herz, mehr seinen beobachtenden Kunstverstand. Ebenso weckte dieser dampfende Tisch, die geschäftige Mutter, der nach Hause kehrende Förster mehr seine malerische Produktionslust, als daß dieses Bild seinen Familiensinn befriedigte, er fühlte mit Unbehagen, wie er statt mitten in der Situation zu leben, viel mehr über derselben schwebte, ein Gefühl, das ihn öfter überraschte und ihm die rechte, mitempfindende Teilnahme am eignen, wie am Dasein anderer zerstörte.
Schon hörte man die näherkommenden Schritte des Försters, als die Mutter ihren Mund verstohlen an ihres Sohnes Ohr legte.
»Lieber Gott!« flüsterte sie, »wenn ihn der Graf nur nicht pensioniert. Es ging schon im vorigen Jahre das Gerücht. Der Gehalt ist alsdann zu gering. Doch das ginge noch. Er würde aber sterben, Eduard, wenn er nicht mehr in seinem Wald arbeiten dürfte. Ich sage Dir, er würde sterben,« setzte sie mit zitternder Stimme hinzu. Eduard zuckte zusammen, es ward wieder auf einige Augenblicke warm in seiner Brust. Die Liebe dieser Frau zu dem unfreundlichen Mann beschämte ihn.
»Du hast Recht,« hatte er noch Zeit zu flüstern, »wenn seine Kräfte abnehmen, sorgt dafür, daß der Graf davon nichts merkt. Das darf nie geschehen. Das ist sein Tod.«
»Wer spricht hier vom Tod?« erdröhnte die rauhe Stimme des Försters inʼs Zimmer, »laßt mir doch das garstige Wort.« Verdrießlich lachend warf er seinen Hut auf ein an der Wand befestigtes Hirschgeweih, legte die Pfeife bei Seite und schielte, sich über die triefende Stirne fahrend, nach dem Liqueurgläschen.
»Es ist heiß, aber heutʼ Abend wirdʼs regnen, der Hund fraß Gras,« meinte er, noch immer lachend, dem Sohn zunickend, während Frau Enger bemüht war, ihm den Rock auszuziehen.
»Schweigʼ nur still,« rief er dann barsch seiner Frau zu, noch ehe diese ein Wort gesprochen.
»Wie der Mann geschwitzt ist,« wollte sie dann sagen, erhielt aber kaum nach dem zweiten Wort die Weisung, nur den Mund zu halten, sie verstände nichts. Sie ließ sich dadurch weiter nicht einschüchtern, brachte es jedoch nie zu einem geschlossenen Satz, immer wieder wurde ihr das Wort im Munde mit einem rauhen: Nur still! zerschnitten. Anfangs widersetzte er sich wie gewöhnlich der Operation des Rockausziehens, murmelte verschiedene Redensarten, ließ es dann endlich geschehen und verfügte sich brummend ins Nebengemach, ein trockenes Hemd anzulegen, da ihn Louise an den Rheumatismus erinnerte, der ihm vor drei Wochen gar nicht aus dem Rücken gewollt habe.
»Muß alles mitgemacht werden,« rief er im Weggehen ärgerlich-lustig, »ist ganz recht so, der Rückenschmerz muß auch mitgemacht werden . .«
Als nun aus der Thüre des Nebengemachs die Mahnung: Nur still, nur still! ununterbrochen hervortönte, begleitet von den begütigenden, ängstlichen Bitten der Frau, fühlte sich Eduard recht unbehaglich. Die Art, mit der der Vater (der gegen Fremde die Liebenswürdigkeit selbst war) seine Frau als Dienstmagd behandelte, gefiel ihm nicht, obgleich er wußte, daß sich die Mutter nun seit Jahren an dies barsche Benehmen gewöhnt.
»In welcher Ehe ist es anders,« sagte sie meist entschuldigend, »er ist der Schlimmste noch lange nicht.«
Ich halte es hier keine drei Wochen aus, dachte der Künstler, ruhig diese väterliche Tyrannei mit ansehen mag ich nicht, dreinreden läßt er sich nicht, er wäre im Stande, mich alsdann aus dem Hause zu jagen. Das ist so die vielgerühmte deutsche Familiengemütlichkeit! Er fühlte mehr denn je den Abstand, der ihn von den Eltern trennte. Noch als er sie vor drei Jahren besucht, hatte er sich besser in ihre Lebensart zu schicken gewußt, diesmal kam er sich wie ein Fremdling in der Heimat vor. Und doch war der Vater ein guter Mensch, der kein Tier leiden sehen konnte, warum er nur seinen Angehörigen gegenüber immer diese Tyrannenlaune hervorkehrte.
»Guten Tag, Eduard,« rief eine helle Knabenstimme, während aus dem Nebengemach das Gezänke weiter forttönte, und Eduard fühlte sich jetzt heftig von dem hereinstürzenden Ludwig angerannt. Der Knabe warf sich mit ausgebreiteten Armen auf seinen eben noch von so trüben Gedanken heimgesuchten Freund und diesem ging das Herz auf, als er den Krauskopf an sich geschmiegt fühlte.
»Onkel Heinrich hat mir ein Reh gezeigt,« sagte der Kleine, »wirst Du mir denn auch ein Reh zeigen?« Des Knaben Augen waren so vertrauensvoll bittend zu dem Maler emporgeschlagen, es leuchtete jener eigentümliche Glanz aus ihnen empor, in dem man die Keime der sich entwickelnden Seele belauschen zu können wähnt.
»Gewiß,« erwiderte Eduard von diesem träumerischen Glanz des Kindesblicks getroffen, »wenn Du artig bist, erhältst Du Alles, was Du willst, mein Liebling.« Der Knabe errötete ein wenig, was seinem reizenden, schwarzumlockten Gesicht sehr gut stand, atmete dann tiefer auf und ließ seine Blicke verlegen im Zimmer umhergleiten.
»Fehlt Dir etwas?« frug der Maler.
»Lieber Eduard,« stammelte er lächelnd, »gieb mir – weißt Du —?«
»Nein, was soll ich Dir geben —?«
»Du weißt es,« sagte er, schalkhaft mit dem Finger drohend.
»Ich? ich weiß nicht, was Du meinst?«
»O doch.«
»Nun, so sprich deutlicher.«
»Es sieht braun aus und ist viereckig,« flüsterte Ludwig, seinen Kopf in seines Freundes Rock verbergend. Er hatte nicht Zeit, seine Beschreibung des gewünschten Gegenstandes zu vollenden, der Förster, in einen bequemen Schlafrock gehüllt, trat, sich den starren, weißen Schnurrbart streichend, aus dem Schlafgemach. Rasch benutzte der Kleine die Gelegenheit und flüsterte, als der Förster auf Eduards Staffelei zuschritt, dem Maler zu:
»Die vornehme Dame gab mir gestern davon.« Eduard erriet, daß er Chokolade meinte und verwies ihm mit ein paar tadelnden Worten diese Naschhaftigkeit, welcher Tadel seine beschämende Wirkung nicht verfehlte.
»Du bist doch zu alt,« meinte der Maler, »um an solchen Leckereien Gefallen zu finden.«
Der zehnjährige Schlaukopf drückte errötend die Augen zu, atmete hastiger und nickte, als gäbe er seinem Erzieher vollkommen recht.
»Siehʼ, da ist Kato,« rief er dann mit jener der Jugend eigenen Verschmitztheit, auf ein angenehmeres Thema übergehend, eilte an das Fenster und that, als ob er draußen den Hund erblickte, der nirgends zu erblicken war. Der Förster hatte sich indessen vor das Bild gestellt, um es in Tabaksrauchwolken einzuhüllen, die er wohlbedächtig aus der kurzen Pfeife gesogen. Seine Augenbrauen, die sich über seinen lebhaften Augen wie zwei angeklebte, weiße Wattballen ausnahmen, hielt er mit wichtiger Miene zusammengezogen und, obgleich ihn die Arbeit seines Kindes höchlichst ergötzte, schüttelte er mißbilligend den grauen Kopf.
»Hm! das gefällt mir nicht,« sagte er, sein Wohlgefallen unterdrückend, »so krumm darf kein Baum stehen in einer ordentlichen Waldung und das Unterholz da vorn dürfte ein gewissenhafter Förster auch nicht stehen lassen, der Weg hier läuft so sehr im Zickzack, daß ich mich schämen würde, wenn ich ihn angelegt.«
»Lieber Vater,« wandte Eduard bescheiden ein, »das soll auch keine vorschriftmäßige Waldung sein mit schnurgraden Wegen und glatt angestrichenen Wegweisern.«
Des alten Sanguinikers Augen hatten die Eigenschaft, sich von innen heraus zu entzünden, wenn er lebhafter wurde.
»Mag sein, daß Du das Bild hübsch findest,« entgegnete er, »der wirkliche Wald ist mir lieber, als der gemalte – ich verstehe doch etwas davon, wie ein Wald aussehen muß – Louise sei still —« wandte er sich darauf zu seiner Frau, die auch eine Bemerkung mit einfließen lassen wollte, »Du verstehst gar nichts von der Sache – nun, Eduard, wenn sie Dir nur das Bild gut bezahlen. Kannstʼs brauchen. Wie viel erhieltest Du für Deine Gebirgslandschaft?«
»Dreitausend Mark, Vater.«
»Gar kein Geld, gar kein Geld,« sagte der Alte wegwerfend, konnte dabei jedoch nicht umhin, dem Sohn einen bewundernden Blick zuzuwerfen. »Dreitausend Mark, damit kannst Du kaum ein Jahr leben in München. Wer hat das Bild gekauft?«
»Ein reicher Amerikaner.«
»So, so,« schmunzelte der Vater, »hm! wir wollen uns zu Tische setzen. Louise sei nur still, die Suppe ist immer noch warm genug, brauchst nicht zu zanken. Fragʼ doch einmal den Hans, ob er die Hunde versorgt.«
Als Antwort hierauf kam, als man sich eben zu Tisch begab, Kato, ein prächtiger Hühnerhund, zur Thüre herein und legte sich befriedigt zu den Füßen seines Herrn nieder. Der Förster, der es sich nicht eher schmecken ließ, als bis er seine Tiere versorgt wußte, langte nun tüchtig zu, einige Male wohlwollende Blicke zu Eduard hinüber und auf seinen Kato herabsendend. Wen er von beiden mehr liebte, würde in der That schwer zu entscheiden gewesen sein. Er freute sich über Eduards Talente, über seine schlanke Gestalt, seine städtischen Manieren, mit denen er das Brod brach oder das Fleisch zerlegte. Doch redete er, um sich absichtlich die Freude an seinem Sohn zu zerstören, nicht, wie er es so gern gethan, von ihm und seinen Arbeiten, sondern von allerlei unangenehmen Berufsgeschäften, Holzarbeitern, Pferden, oder dem Schaden, welchen das Wild auf benachbarten Feldern angerichtet. Dann trat ein Zeitpunkt ein, in welchem sich alle Anwesenden mit solcher Innigkeit den Genüssen der Mahlzeit hin gaben, daß, außer dem Gerassel der Messer und dem Geräusch der Kauwerkzeuge, kein Laut die dämmernde, sonniggrüne Stille des Gemachs störte. Ludwig konnte es natürlich nicht unterlassen, dem Hunde zuweilen die Überbleibsel seines Tellers zuzuschieben, was ihm auch einige Zeit hindurch ungestraft auszuführen gelang, bis endlich Eduard, durch die Unruhe des Tieres aufmerksam gemacht, die höchst verpönte Fütterung bemerkte und dem Missethäter einen Verweis erteilte. Da der Bann der Stille auf diese Weise gebrochen war, fand auf einmal jeder wieder Worte, es war, als sollte das Versäumte nachgeholt werden, so viel wußte jetzt jeder vorzubringen, bis die Stimme des Försters die der drei anderen übertönte. Mit einer gewissen verdrießlichen Behaglichkeit, durch die man die versteckte Liebe zu seinem Kinde durchklingen hörte, verbreitete er sich darüber, wie er es anfangen würde, ein Bild zu malen. Das sollte derber, stämmiger werden, meinte er, als dort jenes auf der Staffelei: Natürlich müßte es von Wild wimmeln, auf allen Ästen, im Gras, überall, wie denn auch ein Jäger schlechterdings nicht fehlen dürfe, dem man selbstverständlich ein Gewehr in die Hand geben müsse, welches Gewehr denn der eigentliche Glanz- oder Mittelpunkt des Gemäldes bildete. Daß es nach neuester Konstruktion gebaut ist, versteht sich von selbst. Auch die Feder, die jener Jäger auf dem Hute trüge, sei von Wichtigkeit. Eduard nickte, anfangs ein Gähnen kaum unterdrückend, zustimmend, konnte jedoch später sich eines Gefühls der Rührung nicht erwehren, als er des alten Mannes sorgsam unterdrückte Liebe zum Waldleben aus seinen Worten herausklingen hörte, aus den Augen hervorglänzen sah. Der alte Waldmensch (wie er sich selbst nannte), fand oft für diese Empfindung der Waldlust volkstümlich poetische Wendungen, die jedem Gebildeten würden Ehre gemacht haben, durch die Rauheit seines Charakters zitterte der Stolz, der Pfleger, ja der Erbauer dieser grünen Welt sein zu dürfen und man mußte ihm, wenn er von seinen Kindern, den Bäumen zuweilen im Ton eines kleinen Herrgotts sprach, diese Selbstüberhebung verzeihen. Eduard hob absichtlich seine Unkenntnis des Waldbaues hervor, um dem Vater die Freude des Berichtigens, des Erklärens bereiten zu können. Auf seine mannigfachen Fragen antwortete der Alte alsdann mit der Würde einer Autorität und Eduard war mit allem einverstanden, da der geringste Widerspruch einen Sturm würde heraufbeschworen haben.
»Alles,« sagte der Förster, »alles sollen sie mir nehmen, nur meinen Wald mögen sie mir lassen. Ich hin darin geboren und unter dem grünen Dach sterbe ich fröhlicher, wie der Fürst unter seinem Thronhimmel.«
Dann, als schäme er sich, sein Inneres so unverhüllt gezeigt zu haben, machte er seine Frau in rauhem Ton auf Eduard aufmerksam, der sich vom Tisch erhoben und an seine Staffelei gesetzt hatte, um die Palette zu reinigen. Diese Absonderung gefiel dem Förster schlecht, da sie ihn plötzlich eines aufmerksamen Zuhörers beraubte, er verbarg jedoch seine Mißstimmung, indem er erzählte, seines Brotherrn Tochter, Gräfin Isabella, sei auf Schloß Ibstein angekommen. Je mehr sich Frau Enger für diese Neuigkeit interessirte, desto weniger durfte sie sich das anmerken lassen, sie stieß nur ein verwundertes: Ach was! heraus und versuchte vermittelst erheuchelter Gleichgültigkeit den Förster zum Weitererzählen zu bewegen.
»Wird wohl nur ein Gerücht sein,« sagte sie möglichst gleichgültig, indem sie das Tischtuch abnahm.
»Louise,« fuhr der Alte auf, »laß mir das Dreinreden. Sie ist hier! Man sagt, ihr Vater, der Graf, wolle sie zu einer Heirat bewegen, von der sie nichts wissen will. Um ihr nun andere Gedanken in den Kopf zu bringen, schickt er sie auf Reisen. Weißt Du nichts von der Sache, Eduard,« wandte er sich an seinen Sohn.
»Nein,« erwiderte dieser barsch.
»Nein?« frug der Förster, »der Hans murmelte so etwas, als habe sie Dir beim Malen über den Rücken gesehen, er will es von weitem bemerkt haben.«
»Unsinn,« murmelte Eduard kaum hörbar. Ludwig, der mit einem Farbenfläschchen gespielt, sah, sich über seines Erziehers schlechtes Gedächtnis wundernd, auf.
»Ei, eine Dame« – kam es stotternd über seine Lippen – und er würde gewiß von jener Begegnung im Wald in seiner Weise berichtet haben, wäre ihm Eduard, der sich seiner Lüge schämte, nicht errötend zuvorgekommen.
»Mag sein,« sagte der Maler, dem Knaben die Flasche hastig aus der Hand nehmend, »mag sein, daß der Hans recht hat, wenn ich beim Malen sitze, habe ich kein Auge für Gräfinnen. Doch halte nun in Frieden Deinen Mittagsschlaf, Vater,« fügte er rasch hinzu, um Ludwigs Gesprächslaune zu unterdrücken, »komm, mein Kind, wir verfügen uns in das Zimmer hier und sind recht still, damit der Papa schlafen kann.«
Vater Enger hatte seine Kaffeetasse leer geschlurft, er sann noch einige Augenblicke still vor sich hin, lehnte sich in den Sessel zurück und breitete seiner Gewohnheit gemäß ein grünes Tuch über das Gesicht, um sich vor den Mücken zu schützen, die über den Speiseresten des Tisches summten.
»Wird Arbeit geben,« murmelte er noch im Halbschlaf, »muß mich morgen im Schlosse vorstellen, sorge für die Uniform, Louise – neue Knöpfe – zu eng —«
»Der Onkel schläft,« flüsterte Ludwig und legte den Finger auf den Mund, »nicht wahr, Tante?«
»Ja, mein Kind,« lispelte diese, »sei nur hübsch still.«
»Hübsch still,« hauchte Ludwig und schlich sich heran, um sich die bei Seite gelegte, noch qualmende Pfeife anzueignen, aus welcher es ihm auch gelang, einige herzhafte Züge zu thun, während er den grüneingewickelten, jetzt laut schnarchenden »Onkel« eifrigst beobachtete. Eduard schabte mit dem Spachtel an seiner Arbeit, die Mutter schlich auf den Zehen ab und zu, das leere Geschirr des Mittagstisches hinwegzutragen; an dem Pfosten der geöffneten Thüre her strich die Hauskatze in das schwüle, noch von den Gerüchen der Mahlzeit durchduftete Gemach. Selbst Eduard wandelte lebhaftes Schlafbedürfnis an in dieser schwülen Mittagsruhe, er legte sein Werkzeug hinweg und sah träumerisch auf den sonnigen Hof. Draußen scheuerte die Magd einen Kessel am Brunnen. Der Hund schlief vor seiner Hütte, die Hühner saßen verschlafen auf dem Brunnentrog, überall auf Stein und Mauer, auf Dach und Treppe lag die blendend grelle Sonne eines warmen Septembertages, Wie einschläfernd die Physiognomie des Brunnens herüberschaute, es war ein gutmütiger alter Brunnen, dem immer ein wenig Wasser im Munde stand, der Baum neben ihm breitete wie schützend seine Äste über den kühlen Ort. Eduard ärgerte sich über jene Lüge, die er eben vorgebracht. Warum er nur in jenem Augenblick: nein! statt: ja! gesagt, Thorheit! Es ging ihm das: Ja! nicht von der Zunge. Doch schlafen wir ein wenig, dachte er, ich bin mit Allem unzufrieden, mit der Gräfin nicht zum wenigsten. Es ist recht seltsam, daß sie meines Vaters Herrin ist, freilich ist es ebenso seltsam, daß ich ich, d. h, meines Vaters Sohn bin. Da schlug näherkommender Hufschlag an sein träumendes Ohr. Eine Ahnung stieg in ihm auf, er wußte in seiner Schlaftrunkenheit selbst nicht warum, aber es war ihm, als wisse er genau, wer sich zu Roß dem Hofe nahe. Richtig, es war so selbstverständlich, da ritt sie zum Thore herein, von einem Lakaien gefolgt, die junge Gräfin Isabella. Nun muß sie auch noch kommen, dachte er und riß, als er Ludwig so gemüthlich rauchen sah, dem Jungen die Pfeife aus dem Mund. »Was machst Du,« rief er barsch, dämpfte jedoch gleich seine Stimme, als der Förster sich regte. Die Hunde schlugen an, der schlafende Förster reckte sich seufzend, während seine Frau sogleich hinausgeschlüpft war, den Gast zu bewillkommnen. Eduard erhob sich unschlüssig, was er thun sollte, da Ludwig, die Pfeife wegwerfend, in den Hof gestürzt war, die Pferde zu bewundern.
»Ich werde nicht gehen,« dachte der Künstler, »warum auch!« Hiermit setzte er sich vor seine Staffelei, um sich einzureden, die Gräfin interessiere ihn nicht, übrigens sei sie auch schwerlich seinetwegen in dem Forsthause erschienen.
Gleich darauf eilte Frau Enger aufgeregt in das Gemach zurück.
»Sie ist da, die Gräfin, Eduard, so komm doch,« sagte sie, »sprich mit ihr, oder soll ich den Vater wecken?«
»Nein,« sagte Eduard, »er ist den ganzen Tag verdrießlich, wenn man ihm den Mittagsschlaf raubt, laß ihn schlafen. Was will sie denn?«
»Die Gräfin? ich weiß nicht! Vielleicht eine Laune, vielleicht hat sie Aufträge für den Vater. Aber es muß doch jemand mit ihr reden, sieh nur, wie erstaunt sie sich in dem leeren Hof umblickt. Geh doch, geh doch!«
Eduard wollte hinausgehen.
»So wie Du da bist, willst Du mit der Gräfin reden,« frug die Mutter, »in Hemdsärmeln? Das geht nicht an. Ich will Dir Deinen Rock holen —«
Eduard ließ sich nicht irre machen, er schritt langsam auf Isabella zu, deren sehr erhitztes Gesicht erkennen ließ, wie sie heftiges Herzklopfen unterdrückte. Sie hatte einstweilen vom Pferde herab freundlich lächelnd ein Gespräch mit Ludwig angeknüpft. Wie sich die Familie befinde, wie er sich selbst befinde, ob Frau Enger zu sprechen sei, ob Herr Enger zu Hause sei; alle diese Fragen richtete sie an den blöde Dʼreinschauenden, der sie mit einem verlegʼnen; »Ich weiß nicht!« abfertigte.
»Nicht wahr, die Pferdchen gefallen Dir,« frug sie dann, welche Frage der Junge mit einem Kopfnicken bejahte.
»Möchtest Du eines davon besitzen?« frug sie weiter.
»Ja,« erwiderte der Kleine gedehnt.
»Möchtest Du ein wenig reiten?«
»Ja.«
»Nicht wahr, das gefiele Dir – nun, wir wollen es einmal versuchen, wie?«
Des Knaben Augen begannen zu leuchten, er zitterte vor Erwartung. Der Diener mußte auf den Befehl des Fräuleins absteigen und den Knaben auf den Sattel heben, was sich dieser mit glückseligem Lächeln gefallen ließ.
»Sieh,« rief der kleine Reiter, als er Eduardʼs ansichtig ward, »sieh doch, – wie schön —«
»Du wirst gleich herunterfallen,« rief Eduard, um nur irgend etwas zu sagen, worauf Ludwig aus Leibeskräften zurückschrie: »nein! nicht wahr – Du hast es mir erlaubt, Fräulein Gräfin, nicht wahr?«
Isabella lachte, um sich ihre Fassung zu erringen, länger als nötig schien, brach dann aber dies Gelächter mit nervöser Herbheit ab.
»Konrad,« redete sie den Diener an, »halte den Knaben fest.« Hierauf preßte sie die ein wenig zitternden Lippen aufeinander, indeß Eduard näher tretend den Jungen mit einem Ernst, über den er sich zu anderer Zeit lustig gemacht haben würde, frug, ob er wüßte, wie man ein gnädiges Fräulein anrede. Das: »ein gnädiges Fräulein!« klang auffallend ehrerbietig.
»Ich freue mich, daß er es nicht weiß,« entgegnete sie, ein wenig geschmeichelt. Als hierauf ein beklemmendes Stillschweigen von beiden Seiten einzutreten drohte, erinnerte sie sich daran, daß sie als Dame von Welt diesem armen Maler imponiren müsse. Sie möchte ihn gar zu gern einmal in Verlegenheit sehen, wie er sich nur dabei ausnehmen würde. Bis jetzt hatte sie immer die Verlegene spielen müssen.
»Ich wollte,« sagte sie tief Atem holend, »auf meinem Spazierritt nicht versäumen, unser altes, gutes Forsthaus zu besuchen. Ich hoffe, Ihre Eltern befinden sich wohl?«
»Gewiß, gnädiges Fräulein.« Eduard blickte von der Sonne geblendet zu ihrem von einem breiten Hutrande beschatteten Gesicht empor. Dies Gesicht war von feinen, goldgelben Sommersprossen überdeckt, die indeß, weit entfernt es häßlich zu machen, ihm einen eigentümlich kühlen, kränkelnden Reiz verliehen. Da dem Maler die Augen in dem scharfen Licht zu thränen begannen, legte er die Hand über die Stirne ob dieses Thränens, das doch mit seiner inneren, gänzlich gleichmütigen Seelenstimmung in gar keinem Zusammenhang stand, tief errötend. »Wie einfältig,« dachte er, »muß mir auch das noch passiren.« Er drückte mit den Fingern verstohlen die Thränen aus den Wimpern und versuchte zu lächeln, damit die Gräfin nicht etwa auf den absurden Gedanken verfallen möge, er weine.
Die Gräfin hatte mit ihrem unruhig gewordenen Pferde zu thun, bemerkte aber dennoch die Feuchtigkeit in des Künstlers Augen. »Endlich habe ich meinen Zweck erreicht. So also sieht er aus, wenn er verlegen ist,« dachte sie, »sie steht ihm ganz gut, diese Röte auf den blassen Wangen, auch der kindlich verwirrte Ausdruck seiner Augen ist reizend.« Sie wußte nun recht gut, daß diese Thränen lediglich der grellen Sonne ihr Dasein verdankten. Dennoch wirkte der Kampf, den der Jüngling mit seiner Schwäche kämpfte, seltsam beunruhigend auf ihr Herz. Sie wünschte ihn dieser Beklemmung überhoben zu sehen. Sie kam in eine ähnliche Verwirrung wie Eduard, der sich um alles in der Welt nicht abwandte, sondern, wie um die Festigkeit seiner Sehnerven zu prüfen, zu dem schmalen Gesichte der Reiterin emporstarrte, dem schmalen, reizend-vornehmen Gesichte. Schließlich überkam sie geradezu ein bereuendes Mitleid.
»Herr Enger,« sagte sie möglichst gleichgültig, mit der Reitgerte ihres Rosses Mähne streichelnd.
»Gnädiges Fräulein —«
»Ich habe mich müde geritten —«
»Oh, ich vergaß,« unterbrach sie der Maler, »bitte, wollen Sie nicht absteigen – warum steigen Sie nicht ab – ?«
»Nein, nein!« rief sie, »ich will mich nicht lange aufhalten, da man auf mich im Schlosse wartet. Wie viel Uhr mag es wohl sein – o, bitte, bleiben Sie nur, ich möchte Sie nur um ein Glas Milch ersuchen – Sie haben gewiß gute Milch hier – ich bin so durstig —.«
Kaum hatte die am Fenster lauschende Frau Enger dies Wort vernommen, als sie sogleich die Magd nach der gewünschten Milch in den Keller schickte
»Einen Teller, um das Glas darauf zu stellen,« befahl sie, indeß Eduard bereits in das Haus geeilt war, das Verlangte zu holen. Ludwig wurde nun wieder vom Pferde herunter gehoben, was ihn sicherlich zum Weinen gebracht haben würde, hätte nicht ein für ihn sehr interessanter Gegenstand seine Aufmerksamkeit gefesselt. Ihm fiel auf, daß der Diener einen kleinen Vogelkäfig mit zwei lebendigen Insassen in der Hand trug, und gerade als Frau Enger nebst der Magd, welche die Milch auf einem Teller trug, aus der Hausthüre traten, frug er, was das für Vögel seien.
»Ach ja, die Vögel,« rief Isabella heiter, »die vergaß ich ganz. Sehen Sie, Herr Enger,« rief sie dem jetzt wiederkehrenden Maler entgegen, »diese Vögel habe ich einem Bauernjungen abgekauft. Welchʼ dürftiger Käfig – nicht wahr? – komm, gieb ihn her, Konrad. – Aber vorsichtig, Du wirfst ja die armen Tiere an das Gitter.« Der Diener reichte ihr den rohen Holzkäfig und sie öffnete mit neugierigem Behagen die Thüre desselben.
»Sollen sie wegfliegen?« frug Ludwig.
»Gewiß, das sollen sie,« rief sie kindlich hellauflachend, »dazu habe ich sie ja gekauft. Die armen Tiere – oh! die armen Tiere. Nun will keines zuerst hinaus!«
Die beiden Amseln fürchteten sich und flogen scheu hinter dem Gitter umher. Der Diener wollte seiner Herrin den Käfig wieder abnehmen, da die Tiere in ihrer flatternden Angst den schmutzigen Inhalt ihrer Wohnung auf Isabellaʼs Kleidung schleuderten.
»O nein,« rief sie, »es bereitet mir solche Freude, sie frei zu lassen. Gieb Acht, so wird es gehen, so beruhigen sie sich.«
Hierauf hielt sie den Käfig mit einer graziösen Armbewegung weit von sich weg. Alle schwiegen erwartungsvoll, bis nach einigem Zögern mit schnurrendem Flügelschlag erst der eine, dann der andere Vogel aus dem Behälter schwirrte. Ludwig klatschte, ein freudiges Geheul anstimmend, in die Hände, Isabella sah nach den beiden Flüchtlingen. Sie saß ganz still, fast mit einem Ausdruck von Schwermut hing ihr weit offenes, weltverlorenes Auge an den beiden immer kleiner werdenden Punkten, bis sie im Blau des Himmels verschwanden. Dann atmete sie tief auf, sah sich erstaunt um, und wie aus einem Traum erwachend, errötete sie ein wenig, als sie des Malers aufmerksames Auge ernst auf sich gerichtet sah. Dieser stand neben ihrem Pferd und hielt das Glas Milch, das er der Magd abgenommen, während des ganzen Vorgangs hoch zu ihr empor. Ihr Anblick war ein künstlerischer Genuß für sein Auge gewesen. Besonders hatte sich ihm jene weichlich anmutige Armbewegung in die Seele geprägt, mit welcher das Mädchen den Käfig von sich gehalten; auch der traumverlorene Blick, den sie den Entfliehenden nachsandte, weckte seine Beobachtungsgabe und Forscherlust. An was mochte sie wohl gedacht haben? Nun kam er wieder zu sich und fühlte neben dem rein ästhetischen Genuß, den ihm diese Scene gewährt, eine Art Beschämung, als jetzt Isabella ihre kleine Hand nach dem Glase ausstreckte.
»An was, gnädiges Fräulein,« frug er lächelnd, »haben Sie wohl gedacht, als Sie den beiden Tieren nachsahen?«
»Ich – nachsah —? Davon weiß ich gar nichts —« gab sie zurück, das Glas ergreifend.
»Ja – ich habe Sie beobachtet —«
»Ich weiß wahrlich nicht, an was ich dachte,« sagte sie leise. Dann that sie einen Schluck aus dem Glase, blickte ein wenig starr über dessen Rand hinweg und sagte: »Ja, erraten Sie, an was ich dachte —«
»Wer kann die hohen Gedanken eines hochgeborenen Fräuleins erraten, wenn es hoch zu Roß sitzt?« entgegnete Eduard achselzuckend, wieder in seine sarkastische Laune verfallend. Sie jedoch überhörte diese Bemerkung.
»Ich besitze sie nicht,« sagte sie ernst, einen bedeutungsvollen Blick auf Eduard werfend, der, von diesen für ihn inhaltslosen Worten seltsam berührt, dastand, nicht wissend, was er von diesem Blick halten sollte. Was besitzt sie nicht? tönte es in ihm wieder. Er senkte den Kopf. Während er nachgrübelte, scharrte der Pferdehuf vor seinen Augen. »Was das Pferd schön gebaut ist,« fuhr es ihm durch den Sinn, dabei wehte das Rauschen von Isabellaʼs Reitkleid leise an sein Ohr und es entstand eine augenblickliche Gedankenleere in seinem Kopf. Sie trank hastig ihr Glas zur Hälfte leer, sogleich ein gezwungen heiteres Wesen annehmend, da Eduard nicht auf ihre Stimmung einging. Mit einem Ernst, der sich vergeblich bemühte als Heiterkeit zu gelten, richtete sie mehrere gleichgültige Fragen an die sich verbeugende Frau Enger, deren Antwort gar nicht abwartend, oder vielmehr dieselbe mit ihren Fragen beständig durchschneidend, was, da Frau Enger sehr redselig wurde, dem Gespräch der Beiden einen gar eigenen Charakter gab.
»So, so,« plauderte sie in die lebhaften Ausrufe der Frau hinein, »also Ihr Mann – brummig? – zuweilen – wie? – so meinen Sie? – ja – gewiß – schöner Wald – ganz wohl, gute Milch – köstlich – danke – danke – mein Durst ist gestillt – grüßen Sie mir den Förster – nein! bitte, bitte, lassen Sie ihn schlafen – um Gotteswillen den Schlaf des alten Mannes nicht stören – werde nächstens wiederkommen – gewiß – der Herr Förster soll mir einen hübschen Hund ziehen – sagen Sie ihm dies —«
»Gewiß, gewiß, gnädige Gräfin,« rief Frau Enger mit devoter Miene, »das werde ich ihm ausrichten – bleibe vom Pferd, Ludwig, Ungezogener – Du siehst, es spitzt die Ohren – es wird unruhig —«
Eduard stand noch immer sinnend, bis die Gräfin ihrem Pferde ein: »Vorwärts, Hector!« zurief, was die Mutter veranlaßte, den kleinen Ludwig am Kragen festzuhalten, bis das Thier sich in Bewegung gesetzt. Eduard ging, ohne zu wissen, was er thun solle, der Reiterin nach. Als diese an dem Hofthore angekommen war, ließ sie den Diener Konrad vorreiten. Plötzlich wandte sie dem Maler ihr Gesicht zu, das einen gleichgültigen, nichtssagenden Ausdruck angenommen.
»Sehen Sie noch einen der Vögel, Herr Enger?« frug sie nachlässig, ohne Betonung.
»Jetzt noch? Nein!« entgegnete Eduard erstaunt.
»Ich auch nicht,« sagte sie ruhig, »sie besitzen die Freiheit.« Damit sprengte sie von dannen. Eduard schlenderte nach dem Hause zurück. Er mußte über die Koketterie oder vielmehr über die kokette Natürlichkeit des Mädchens lächeln, doch schien ihm dies ihr Gebahren eigentlich zu ernst, um darüber zu lächeln. Dadurch kam er in eine Stimmung, in der er selbst nicht wußte, was er wollte, eine Stimmung, die ihn weich und zugleich verdrießlich machte.
»Merkwürdiges Frauenzimmer,« sagte er leichtfertig vor sich hin, ging pfeifend, die Hände in den Taschen auf sein Zimmerchen, das im oberen Stock des Hauses lag und lehnte sich gelangweilt in die Fensterbrüstung, die Landschaft betrachtend, über die sich allmählig Wolken zogen. Fühlte er sich wirklich gelangweilt, oder redete er sich nur ein, sich gelangweilt zu fühlen? Vielleicht hielt er die Spannung seines Geistes, die jede Erfassung eines bestimmten Gedankens unmöglich machte, für Langeweile. Als er sich so laut pfeifen hörte, schämte er sich über sich selbst, hielt inne, konnte aber dem Drang nicht widerstehen, von neuem die Lippen zum Pfeifen zu spitzen. Was ist das nur! Habe ich nichts Gescheidteres zu thun, als zum Fenster hinauszublicken, dachte er. Als er nun das Fenster schloß, bemerkte er Ludwig im Zimmer, der ihm gefolgt war.
»Nun, mein Kind, gefällt es Dir hier?« frug er so heiter als möglich.
»Sehr, sehr,« entgegnete der Knabe, »es ist hier viel schöner als in München.«
»Wir müssen aber dennoch wieder nach München zurück —«
»Wann denn?«
»Sehr bald, sehr bald, mein Kind,« sagte er, setzte sich auf sein Bett und schloß bald darauf die Augen.
»Pfui, Du willst schlafen; nein, es ist zu dumm von Dir, ich willʼs nicht,« rief Ludwig, eilte zu dem Maler heran und drückte ihm mit den kleinen Fingern die geschlossenen Augenlider auseinander.
»Du sollst nicht schlafen,« lachte er, indeß Eduard, vor sich hinbrummend, die Augenlider immer wieder zupreßte, sobald sie ihm der Knabe gewaltsam geöffnet. Nachdem dies Spiel einige Zeit gedauert, raffte sich Eduard empor.
»Laß uns in den Wald gehen, mein Lieber,« sagte er. Ludwig war gern bereit hierzu, besonders da ihm sein Freund die Aussicht eröffnete, sie würden draußen Rehe sehen. Vater Enger hatte ausgeschlafen und war schon vor einer Viertelstunde an die Arbeit gegangen. Eduard hing ein Gewehr, das er aus seines Vaters Schrank genommen, über die Schulter, nahm den Kleinen bei der Hand und eilte raschen Schrittes dem Waldeingang entgegen, dessen geheimnisvolles Dunkel er aufatmenden Herzens begrüßte.
»Willst Du ein Reh schießen?« frug Ludwig. Doch der Künstler, schweigend weiterwandelnd, überhörte, in allerlei Reflexionen vertieft, gänzlich diese Frage. Zuerst fesselte ihn wie immer, wenn er im Wald wandelte, das gedämpfte Licht, das in der Ferne durch die stolz aufragenden Stämme grünlich spielte und das ihn an das zauberhafte Wirken eines märchenhaften Smaragds erinnerte, von dem er als Kind einmal gelesen. Ja, wie märchenhaft muteten diese blauduftigen Durchblicke auf Wiesen und Bäche an, wie riefen sie längst verklungene Kindheitserinnerungen wach. Dann mußte er mit einer gewissen Wehmuth des Vaters gedenken, in dessen Heiligtum er wandelte. War diese Liebe des Vaters zum Wald nicht eine Art tierischen Instinkts? War der Vater doch im Walde geboren, die kurze Zeit, die er als Offiziersbursche beim Grafen Ibstein zugebracht, abgerechnet, hatte er immer nur im Walde gelebt. Des alten Mannes Körper war gleichsam ein Waldgewächs, das ohne die belaubten Stämme verdorren mußte. Ja, aus einer gewissen Entfernung betrachtet, nahm sich der Vater sehr gemütvoll aus, konnte man ihn schon lieben, in der Nähe änderte sich Manches. Ist er nicht seltsam so ein Lebenslauf? Wer sind die geheimen Mächte, die ihn leiten? Umgeben sie mich jetzt in der offenen Natur? Kann ich sie hier belauschen? Ich sitze als elfjähriger Junge in meines Vaters Zimmer und zeichne einen schlechten Kupferstich ab. Der Bediente des Grafen, der meinem Vater einen Befehl zu überbringen hat, sieht mich zeichnen. Er sagt dem Grafen davon, dieser verlangt meine Zeichnung zu sehen und erwirkt mir, als ich den Schulbesuch beendet, ein Stipendium. War es auch von Vorteil für ihn, daß jener Lakai den Elfjährigen zeichnen sah? Merkwürdig, daß mein Schicksal von einem alten Lakaien abhing.
Bald darauf kamen die Beiden an eine Lichtung, von der herüber Stimmen erschallten, Äxte erklangen. Näher kommend, gewahrte Eduard seinen Vater, wie er im Schweiße seines Angesichtes den Arbeitern beim Baumfällen half, sie zurecht wies oder lobte. Hier war der Vater mehr am Platze als zu Hause im Zimmer, hier hatte die Art, wie er mit seinen Leuten sprach, etwas Patriarchalisches, Ehrwürdiges, ließ ihn als einen thatkräftigen, gefürchteten Feldherrn erscheinen.
»So, Ihr Männer,« rief er voll Feuer, »er muß fallen, sägt zu und Ihr dort haltet die Stricke fest – noch nicht ziehen – Geduld —«
Der eifrige Mann war, von der Wichtigkeit des Werkes durchdrungen, überall zugleich, stets seinen kräftigen Lieblingsausdruck: »Ihr Männer!« im Munde. Die gewaltige Tanne ächzte bei jedem Zug der Säge, ins innere Mark getroffen, wie ein lebendes Wesen, und dieser trotzig klagende Ton schien den Förster in eine Art Kampfeslust zu versetzen, Obgleich er seinen Sohn in der Nähe wußte, nahm er absichtlich nicht die mindeste Notiz von dessen Gegenwart, und erst als unter vielen Schwierigkeiten, die die ganze Aufmerksamkeit des Alten in Anspruch genommen, die Tanne zu Boden schmetterte, ohne einen Unfall herbeigeführt zu haben, erst dann schritt er auf den Sohn zu.
»Ein schöner Baum, nicht wahr?« sagte er, seine Schnupftabaksdose ziehend, »gutes Holz, würde einen trefflichen Mastbaum abgeben.«
Eduard bemühte sich ein vergnügtes Gesicht zur Schau zu tragen und pries im Stillen den Vater glücklich, der so ganz in der Freude dieser körperlichen Arbeit aufging, so völlig mit sich zufrieden war.
»Darf ich Dir ein wenig helfen, Vater?« frug er dann.
Der Alte lachte in seiner gewohnten, näselnden Weise, eine Prise nehmend.
»Machʼ, daß Du fort kommst,« entgegnete er, sich den Schnurrbart von dem Schnupftabak reinigend, »helfen, solche Leute wie Du bist können wir bei der Arbeit nicht brauchen. Sieh doch nur Deinen Rock oder Deine Finger an. Du willst uns helfen; ha, ha! geh! doch! gehʼ doch!«
Dabei klopfte er ihm gutmütig auf die Schulter und sagte leise begütigend:
»Nun, nun, will Dich nicht beleidigen, kräftig genug wärst Du ja wohl, wärst auch sonst nicht mein Sohn, aber – weißt Du – hem! solche Arbeit schickt sich nicht mehr für Dich, Du bist ein feiner Herr, die mußt Du schon dem ungebildeten, alten Waldkerl überlassen.«
»Aber, lieber Vater —«
»Nur still,« fiel er ihm behaglich in die Rede, »machʼ, daß Du fortkommst, ich weiß, was Du denkst. Du weißt ja dabei doch, daß der alte Arbeiter Dein Vater war und es noch ist. Dürfte mich auch keiner ungebildet nennen, weißt Du, außer wenn ich es selbst thue. Schau meine Hände – geltʼ die sind rauh, ungehobelt? Und doch haben sie Dich so weit gebracht, als Du jetzt bist, und Du wirst noch manchmal an die Hände denken.«
Er ging ohne Gruß zur Arbeit zurück, während in Eduardʼs Erinnerung, als er dem Vater nachblickte, eine alte Kunde auftauchte. Sollte es dennoch möglich sein, was ihm die Mutter einst erzählt? Der Vater konnte so gutmütig sein, daß man ihm eine solche Handlungsweise nicht zutraute. Und dennoch neben dieser Gutmütigkeit, diese Härte. Der Vater habe von seiner ersten Frau eine Tochter gehabt, die er durch sein rauhes Benehmen so weit gebracht, daß sie Haus und Hof verlassen und dem Manne ihrer Wahl, der nicht ihres Vaters Wahl gewesen, in die Fremde gefolgt sei. Unglückliches Mädchen! Du bist begraben, Dein Name darf nie erwähnt werden.
Eduard schritt, ein dumpfes Unbehagen in der Brust, weiter, schlug sich jedoch mit aller ihm zu Gebote stehenden Kraft den Gedanken an jene Stiefschwester aus dem Sinn, auf einmal, da er sich umblickte, mit einer gewissen Befriedigung wahrnehmend, daß sich Ludwig heimlicher Weise von ihm weggeschlichen. Das laute in den Wald Hineinrufen gab seinem Grübeln eine willkommene Ablenkung. Der Aerger über das Davonlaufen des Jungen machte ihm sozusagen Spaß, er ärgerte sich mit Behagen und nährte diesen Aerger mit allem, was ihn umgab. Es ist wirklich an der Zeit, daß ich dem Jungen eine Ohrfeige versetze, er verliert allen Respekt, läßt mich da stehen, damit ich mir den Hals wund rufe. Und wenn er sich zu guterletzt verirrt. Ich bin wahrlich ein schlechter Pädagog, was kann eine Ohrfeige schaden, alle Sachverständigen sind darüber einig, daß ohne ein gewisses Maß von Prügeln ein Knabe garnicht zu erziehen ist. Und ernsthaft darüber nachdenkend, ob er in diesem Falle nicht seinen Widerwillen gegen körperliche Züchtigung überwinden müsse, kam ihm zugleich die Lust darüber nachzusinnen, was das wohl für eine Befriedigung gewähren möge, sich Vater nennen zu hören. Vater! hm! Das klingt mir so seltsam, mir wird ordentlich unheimlich, stelle ich mir vor, man dürfe mir diesen Ehrentitel beilegen. Warum nur? Tauge ich nicht zu diesem Beruf? Alle meine Freunde haben, sobald es ihre Mittel erlauben, nichts Eiligeres zu thun, als sich zum Familienvater zu entwickeln, warum wird denn mir so weh zu Mut, so als begehe ich ein Unrecht gegen die Natur, wenn ich mir vorstelle, ich vermehre die leidende Menschheit um ein neues Exemplar? Vielleicht stelle ich mir zu deutlich vor, daß es nicht zu den Annehmlichkeiten gehört geboren zu werden! Kurz, ich weiß nicht, die ganze Sache widert mich an. Er dankte Gott, daß er nicht Ludwigs Vater zu sein brauchte und wie er über sein eigentümliches Verhältnis zu dem Jungen nachdachte, trat jener Abend, an welchem er ihn auf der Straße gefunden, lebhaft vor seine Seele. Er war einst in München gegen Abend über die Isarbrücke gegangen, die Hände in der Tasche, den Kopf zur Erde gebeugt. Im Scheine einer mit dem Nebel kämpfenden Laterne, gewahrte er einen auf dem Pflaster langausgestreckten, schlafenden, sehr dürftiggekleideten Knaben von etwa acht Jahren, dessen leidende Züge ihn lebhaft an den berühmten jungen Bettler von Murillo gemahnten. Er blieb stehen. Da wäre ja ein prächtiges Modell gefunden, sagte er sich, um sein Mitleid zu unterdrücken. Der Junge öffnete verschlafen die Augen und als er einen Menschen vor sich stehen sah, streckte er die kränkliche Hand aus, eine gewohnheitsgemäße Bitte murmelnd. Der Maler half dem Durchfrorenen auf die Beine, frug wo er wohne und ging, die Blicke der Vorübergehenden ignorirend, mit dem zerlumpten Jungen nach Hause. Jetzt noch errötete er, da er an das Gesicht seiner Hauswirtin dachte, wie es so fragend auf ihn nebst seine Begleitung gerichtet war. »Und ich habe es nie bereut, mich des Kindes angenommen zu haben,« murmelte der nachdenkliche Spaziergänger vor sich hin, »einen solchen Sohn lasse ich mir gefallen, der wird einmal dankbar und hat auch Grund dazu, es zu werden.«