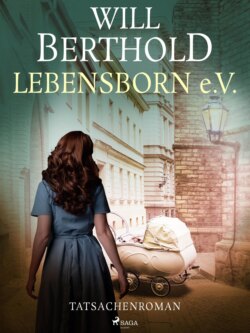Читать книгу Lebensborn e.V. - Tatsachenroman - Will Berthold - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. KAPITEL
ОглавлениеDer Mai füllte die Luft mit Frühling. Am Nachmittag hatte es geregnet. Jetzt hingen die Dampfnebel der warmen, schwellenden Nacht in den Zweigen der Bäume wie weiße Tücher, die sich verfangen hatten. Von den Blättern fielen träge Tropfen. Um die steinernen Kandelaber der schmiedeeisernen Leuchten tanzten die ersten Mücken durch die feuchte Luft.
Nur Schritte auf dem knirschenden Kies unterbrachen die Stille des Abends. In der Ferne schlug eine Turmuhr an. Doris lehnte sich leicht gegen den Mann. Sie fühlte den Druck seiner Hand auf ihrem Arm. Sie wußte, daß sie seine Hand nach der Trennung noch lange spüren würde: fester als weich und drängender als kühl . . .
»Klaus«, sagte sie leise, fast bittend.
Der Mond drehte seine Scheibe aus den Wolken. Das Licht strich über den jungen Fliegeroffizier. Er war hochgewachsen, aber schmal, sehnig, aber nicht kräftig. Seine lederne Gesichtsfarbe paßte nicht zu seinem hellen Blondhaar, so wenig wie sein Alter zu seinem Mund. Klaus Steinbach war 24 Jahre alt, und die Kerben links und rechts der Lippen stammten aus mindestens doppelt so vielen Luftkämpfen.
»Klaus«, setzte Doris zum zweitenmal an, » . . . dieser Urlaub . . . war er schön?«
Er blieb stehen. Das Lachen löschte die Falten in seinem Gesicht. Jetzt war er wieder der unbekümmerte Junge, dem die Mädchen in die Augen sahen, während sie an seinen Mund dachten. Der junge Oberleutnant sah besser als gut aus. Aber er wußte es nicht. Er war ein Idealtyp seiner Zeit. Er konnte nichts dafür. Er glaubte an dieses Leben des Jahres 1941, und er lebte in diesem Glauben . . .
»Warum willst du es hören?«
»Weil ich es wissen möchte.«
»Und warum willst du es wissen?«
»Weil ich es glauben möchte . . .«
»Ja«, erwiderte er, »es war schön . . . es ist sehr schön.«
»Und morgen mußt du wieder zurück . . .«, sagte Doris.
»Ich kann nichts daran ändern«, antwortete er härter, als er wollte.
»Du kommst wieder . . .«, entgegnete das Mädchen mit banger Sicherheit.
»Zu dir«, erwiderte er.
»Zu uns«, sagte sie. Doris hatte lange, schmale Hände. Manchmal dachte Klaus, daß sie das Schönste an ihr seien. Aber sie hatte auch lange, schlanke Beine. Und am Ende solcher Betrachtungen fand er immer alles gleich schön an ihr: die fast unnatürlich großen Blauaugen, die sich verdunkeln konnten wie der Himmel. Die unnatürlich kleinen Ohren, die in ihren Wuschelhaaren steckten wie Ornamente. Der Mund, der gleichzeitig lächelte und grübelte. Nur vor ihrer Stirn empfand Klaus Scheu. Sie war hoch und streng. Es war die Stirne eines Mädchens und einer Frau zugleich. In seinen Gedanken wenigstens oder bestimmt in seinen Träumen.
»Was denkst du?« fragte Doris.
Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, strich ihm mit flüchtiger Hand das Haar zurecht.
Er straffte sich, wie immer, wenn sie ihn berührte. Aus Wilder Erwartung, wie aus verhaltener Scheu. Aber Doris merkte es nicht. Klaus sah in ihre Augen. Sie verschwammen vor ihm mit dem Dunkelblau, das die Nacht trug. Das unwirkliche Licht des Mondes versilberte den goldenen Flaum auf ihrer Stirne unter dem Haaransatz. Er mußte an sich halten, um sie nicht in seine Arme zu reißen.
»Was hast du?« fragte sie weich.
»Nichts«, versetzte er gepreßt.
Sechzehn Tage, dachte der junge Offizier, und kein Tag, kaum eine Stunde ohne Doris. Sie hatten zusammen Tennis gespielt. Sie waren an den Fluß gefahren. Sie saßen im Kino nebeneinander. Und sie besuchten sich gegenseitig bei den Eltern. Sie gingen über ihre Gefühle wie über Brücken, die zum gleichen Ufer führten.
Und doch blieb ein Rest. Er spürte diesen Rest, wenn er Doris küßte. Er küßte sie nie anders, wie er es das erstemal als Primaner getan hatte. Es war stets, als ob die Wilde Welle, die über ihm zusammenschlug, an einer gläsernen Wand aufliefe. Aber Oberleutnant Steinbach war kein Primaner mehr. Verdammt, er wollte kein Porzellan zerschlagen. Aber er wollte diese Glaswand zertrümmern. Sooft er Doris an sich zog, fühlte er ihr sanftes Ausweichen.
Schon zu Beginn des Urlaubs. Aber heute war das Ende. Die Zeit ließ sich nicht stoppen. In diesem Moment hörte der junge Offizier im stillen Stadtpark das Dröhnen der Motoren, das Belfern der Bordkanonen, das Krachen der Bomben, das Heulen des Sturzflugs . . .
Sie gingen weiter. Einen Moment war Klaus eifersüchtig auf die Dunkelheit, die sich um den schlanken Körper des Mädchens legte. Der Kies zerbrach unter seinen Stiefeln. Seine Hände wurden heiß. Er suchte nach Worten und fand sie nicht.
»Ist etwas . . . mit uns?« fragte Doris.
»Nein«, antwortete er rauh.
Sie hakte sich bei ihm ein. Die Schwüle der Nacht hatte für sie keinen Doppelsinn. Plötzlich lachte sie leise.
»Weißt du noch«, fragte sie, während sie mit dem Arm auf den kleinen Platz neben dem Parkweg deutete. Das Brett einer Kinderwippe lag im Mondlicht. Sie hatten den Spielplatz des Parks erreicht, » . . . wie mir der Junge die Sandformen wegnehmen wollte . . . und du ihn dafür verprügelt hast?«
»Ja . . . ich glaube . . .«, entgegnete der Oberleutnant zerstreut. Dann brummelte er: »Wir können doch nicht immer im Sandkasten spielen . . .«
»Eigentlich schade«, versetzte Doris lachend. Dann erst bemerkte sie seinen Trotz. Seine Augen wandten sich vom Spielplatz ab. Er starrte verbissen geradeaus. Das Mädchen betrachtete ihn von der Seite. Klaus, dachte sie: mit sechs sah er nur mein Spielzeug, mit acht meine Zöpfe, mit zwölf meinen Nacken, mit vierzehn sah er an mir vorbei, mit sechzehn sah er mir nach, und dann begegneten sich unsere Augen allmählich, und dann immer häufiger, um einander nicht wieder loszulassen.
Sie hatten das Ende des Parks erreicht. Der Weg gabelte sich.
Sie gingen nach links, nach Hause. Doris enttäuscht, daß ihre Parkpromenade so rasch endete, Klaus mit seltsam drängenden, ziehenden Schritten.
»Du«, sagte er heiser, »kommst du . . . ich meine . . . trinken wir bei uns noch . . . etwas?«
Die Befangenheit schnitt ihm den Faden ab. Er kam sich wie ertappt vor.
Doris erwiderte schlicht:
»Gern, Klaus.«
Plötzlich begann der Ball in seiner Brust zu springen. Er redete ohne Pause. Er kürzte den Weg mit Belanglosigkeit ab. Er hatte Angst, die Freundin könnte es sich anders überlegen. Aber sie dachte nicht daran. Sie verstand so wenig von ihm wie er von ihr. Und darum betrachteten sie beide ihre Gefühle wie ein unbegreifliches Wunder . . .
Im Hause brannte kein Licht mehr. Er ging voraus. Er dämpfte unwillkürlich seinen Schritt. Doris merkte es und wunderte sich. Heimlichkeiten waren ihr peinlich. Sie gingen über den dicken Läufer, erreichten das Zimmer, das Klaus schon als Junge bewohnt hatte, ganz oben, im Dachgeschoß.
Doris besuchte ihn nicht zum erstenmal. Langsam zog er die Tür hinter sich zu. Der junge Offizier stand ein paar Sekunden als ob er Wurzeln schlagen wollte. Er starrte das Mädchen an, betrachtete ihre Lippen, die halb kindlich, halb geöffnet waren. Sein Blick strich über den gelben Flaum auf ihren nackten Armen, die sich plötzlich wie von selbst verschränkten. Er tastete sich weiter zu dem viereckigen Ausschnitt ihres leichten Sommerkleides. Doris betrachtete ihn immer noch verwundert. Er wich ihren Augen aus.
»Setz dich doch«, sagte er mit belegter Stimme.
Gleichzeitig legte er den Arm um ihre Schultern und drückte sie auf die Couch. Er stieß mit dem Kopf an, aber er spürte es nicht. Er schmiegte sein Gesicht, seinen Mund an ihren Hals.
Doris schmollte leise. Ihre Hand umklammerte sein Armgelenk. Er rang wortlos um etwas, das sich nicht erzwingen ließ. Als er es merkte, lag er ganz still, beschämt, betroffen, geschlagen.
»Ach, Klaus . . .«, sagte Doris weich. Ihre Finger spielten mit seinen Ohren, seinen Haaren. Aber ihre Augen wanderten an ihm vorbei. Sie waren blau wie ein See im Sommer. Sie waren naß. Trotzdem nahmen sie in diesem Moment jede Einzelheit des Zimmers in sich auf. Dabei kannte Doris alles: den gemusterten Teppich. Den flachen Kacheltisch. Den bunten Aschenbecher, den sie ihm selbst geschenkt hatte. Den bequemen Klubsessel, der früher unten stand, aus dem sie als Kinder immer vertrieben wurden, weil sie mit den Schuhen nicht auf dem Leder herumsteigen sollten. Das Bücherbord, über dem, stilisiert und konserviert, das Hitlerbild hing. Daneben ein abgebrochener Luftschraubenflügel, als Souvenir der ersten Bruchlandung.
In Doris’ Augen saßen Tränen. Sie fürchtete, daß sie sein Zimmer, das für sie ein Stück Heimat bedeutete, unter seinem ungestümen Drängen Verloren hatte.
»Klaus . . .«, sagte sie bittend, während er seinen Kopf an ihrer Schulter versteckte, »versteh mich doch . . . wir wollen uns das doch aufheben . . . später nach dem Krieg . . . er ist ja bald zu Ende . . .«
Der junge Offizier schwieg.
»Es wäre so«, fuhr Doris mit der Stimme eines Kindes fort, »wie es . . . alle machen . . . so billig . . .«
Er richtete sich halb auf, stützte die Hand gegen die Schläfen.
»Morgen gehst du . . . an die Front . . . und am Abend davor . . . müßt ihr mit euren Mädchen . . .« Sie stöhnte leise und drehte den Kopf zur Seite. »Es ist so billig . . .«, wiederholte sie, »es ist wie ein Programm. Und davor habe ich Angst . . .«
»Ja«, entgegnete Klaus hart, »man kann es auch so nennen.« Und nach einer Weile sagte er: »Daß ich vielleicht nicht wiederkomme, daran hast du wohl nicht gedacht . . . und daß ich . . .«
Er brach erschrocken ab, weil ihm die Ungeheuerlichkeit noch rechtzeitig bewußt wurde. Er hatte sagen wollen: Und daß ich ein Recht darauf habe, bevor ich krepiere . . . wenigstens einmal glücklich zu sein . . .
Klaus machte sich von ihr los. Er stand schwerfällig auf. Mit fahriger Bewegung suchte er den Kognak. Er schenkte sich zuerst ein, kippte das randvolle Glas mit einem Zug hinunter.
Jetzt erhob sich auch Doris, strich ihr Kleid glatt. Er brachte sie die Treppe hinunter. Er stand vor ihr, zwischen Zorn und Verlegenheit.
Doris lehnte den Kopf an seine Brust. Er merkte, daß sie zitterte. Sie versuchte, ihn zu küssen. Aber ihre Lippen waren kühl, und sein Mund blieb verschlossen.
»Komm wieder, Klaus . . .«, sagte Doris.
Dann drehte sie sich rasch um und ging hinaus.
Er starrte ihr nach.
Noch ein paarmal schlägt der Propeller der Me 109 pfeifend durch die Luft. Dann reißt das leerlaufende Dröhnen der Maschine ab. Der Motor steht. Die Bordwarte stürzen wie schwarze Termiten über die Jagdmaschine, klettern auf die Flächen, reißen das Kabinendach auf, helfen ihrem Kommodore aus den Gurten. Unteroffiziere, Mannschaften, Offiziere des Jagdgeschwaders wetzen über den E-Hafen in Nordfrankreich, um dem Chef zu gratulieren. Bevor er landete, wackelte er dreimal mit den Tragflächen. Abschuß heißt das . . .
Oberstleutnant Berendsen winkt ab, während er sich aus der Maschine schwingt.
»Gebt mir lieber ’ne Zigarre«, schnarrt er gut gelaunt.
Er betrachtet den blauen Rauch der Brasil, die man immer für ihn bereit hält . . . falls er zurückkommt. Und dann blinzelt er in die Sonne, von der er eben auf eine Spitfire herabstieß.
»Alsdann«, sagt er und tippt lässig an die Mütze.
Seine Männer bilden eine Gasse. Er geht langsam über den Platz, im Knochensack. Er ist kleiner als seine jungen Leutnants. Sein Gesicht wirkt breit und bullig, mit einem Unterkiefer wie aus Nußbaumholz. Er ist ein Offizier nach dem Geschmack seiner Männer. Er sitzt lieber in der Kiste als am Schreibtisch, er trinkt lieber Schnaps als Wein, und er küßt lieber Schwarz als Blond. Sein Leben ist verdammt einfach: ein Draufgänger in der Luft, ein Haudegen im Suff. Sein bescheidenes Rezept lautet: fliegen, schießen, sterben und sterben lassen. Der Krieg ist ihm gleichgültig, aber Luftkämpfe interessieren ihn . . .
Das Donnern der Geschwadermaschinen, die nach ihm einfliegen, verebbt hinter ihm im Korridor der Horstkommandantur. Oberstleutnant Berendsen öffnet die Türe seines Zimmers mit einem Fußtritt gegen die Klinke, wie immer.
Der Adjutant, Hauptmann Albrecht, nimmt Haltung an.
»Nu, wie sieht’s aus?« schmettert Berendsen.
Der Adjutant hat die Unterschriftenmappe schon griffbereit.
»Nein, nein . . . lassen Sie mich doch mit dem Papierkrieg in Frieden . . . Was ist mit der zweiten Staffel?«
Hauptmann Albrecht betrachtet die Schreibtischplatte. Im Rahmen der psychologischen Behandlung seines Kommodore hätte er das lieber an den Schluß seines Berichts gesetzt. Er beginnt, die Pille zu versüßen:
»Hauptmann Wernecke hat zwei schöne Abschüsse gemeldet . . .«
»Na, großartig!«
Jetzt fährt der Adjutant trübsinnig fort:
»Aber Leutnant von Bernheim wurde leider abgeschossen.«
»So . . .«
»Oberfeldwebel Rissmann bei Bruchlandung schwer verletzt . . .«
»Auch das noch . . .«
Der Chef tigert in seinem Büro auf und ab, wie immer, wenn sich bei diesen Hiobsbotschaften seine Vorstellung vom fröhlichen Jägerleben trübt. Der Krieg wird ihm erst noch das Fürchten beibringen. Jetzt im Jahre 1941 ist für ihn der Heldentod nur Ungeschicklichkeit.
»Ist das alles?« knurrt er.
»Vorläufig«, erwidert der Adjutant vorsichtig. »Die Meldung der dritten Staffel steht noch aus . . .«
Oberstleutnant Berendsen deutet unvermittelt auf die Unterschriftenmappe.
»Na, zeigen Sie schon her . . .«
Der Hauptmann referiert die Eingänge: Nachschublisten, Bestandsaufnahmen, Geschwaderbefehle, Urlaubsverordnungen, Rapport-Meldungen . . .
Der Kommodore kratzt sich im Stehen mit der Füllfeder, ohne hinzusehen. Die Gurte seiner Kombination baumeln herunter. Hauptmann Albrecht blättert um. Er hat die Papiere nach Wichtigkeit geordnet.
»Lauter Mist!« brummt Berendsen.
»Hier noch eine Anfrage der Wehrbetreuung . . . ob wir ein Fronttheater wollen . . .«
»Ach . . .«, winkt der Oberstleutnant ab, »immer noch die alten Schicksen?«
»Nein, neue, Herr Oberstleutnant.«
»Dann brauchen Sie mich doch nicht zu fragen . . .«
Der Kommodore bleibt vor seinem Schreibtisch stehen, holt eine Flasche Kognak aus dem Fach, füllt zwei Gläser.
»Noch etwas?« fragt er.
»Ja«, erwidert der Adjutant, »ein Rundschreiben von der SS . . . die haben da eine Organisation . . . werben Mitglieder . . .«
Oberstleutnant Berendsen nimmt zerstreut das geheime Schreiben in die Hand.
»Bei uns?« fragt er etwas hilflos.
»Auch«, bestätigt Hauptmann Albrecht. »Lebensborn e. V. . . . jeder Deutsche kann beitreten . . . kostet eine Mark im Monat . . .«
Der Chef pafft an seiner Zigarre.
»Was . . . Lebensborn? Klingt wie ’n Kindergarten . . . Was ist denn das schon wieder für ein arischer Schmonzes?«
Der Adjutant nimmt ihm das Schreiben aus der Hand.
»Darf ich?« fragt er.
Dann liest er leiernd:
» . . . Ein Volk, das sein höchstes Gut, seine Kinder vernachlässigt, ist reif für den Untergang . . .«
»Nicht so viel Theorie, Albrecht«, unterbricht ihn Berendsen ungeduldig, »was wollen die denn eigentlich?«
»Mitglieder«, antwortet der Adjutant lakonisch. »Das Rundschreiben ist von Himmler selbst unterzeichnet«, setzt er dann hastig hinzu, » . . . die Bewerber sollen groß und blond sein . . . nur Männer mit einwandfreiem, nordischem Aussehen . . . und überzeugte Nationalsozialisten . . .«
Das Gesicht des Kommodore bleibt undurchsichtig.
»Na ja«, brummt er. »Aber wir können nicht dauernd Fehlanzeigen melden . . . einer muß in den sauren Apfel beißen! . . . Suchen Sie einen jüngeren Offizier aus, der sich freiwillig meldet . . .«
Hauptmann Albrecht hat Falten auf der Stirn.
»Nordisch . . . nordisch . . . nordisch«, murmelt er.
»Wie wär’s mit Steinbach?« fragt der Kommodore, »der sieht doch aus, als ob er aus Walhalla entlaufen wäre . . . Nehmen Sie den . . .«, sagt er abschließend.
Dann reicht er seinem Adjutanten den Kognak.
»Sagen Sie mal, Albrecht, Sie lieben wohl den Reichsführer SS nicht besonders?«
»Nach Ihnen, Herr Oberstleutnant«, erwidert der Adjutant vorsichtig.
»Gut . . . trinken wir auf den Geschmack.«
Noch bevor das Glas geleert ist, fliegt die Tür auf. Ein Unteroffizier der Funkstelle meldet sich mit strammer Ehrenbezeigung. Berendsen betrachtet ihn irritiert.
»Was ist los?«
»Meldung von der ersten Staffel . . . Oberleutnant Steinbach . . . abgeschossen . . .«
»Abgeschossen?« wiederholt der Kommodore mechanisch. Er schluckt, geht an das Fenster.
Hauptmann Albrecht fragt bitter:
»Soll ich nun für den Lebensborn ein anderes Mitglied namhaft machen?«
Oberstleutnant Berendsen dreht sich langsam um.
»Scheiße!« sagt er.
Dann verläßt er langsam den Raum.
›Lebensborn e. V.‹ verfügte über ein Dutzend Heime, über 700 Angestellte und ein paar hunderttausend Mitglieder. Die meisten von ihnen wußten nicht viel von den eigentlichen Zielen des eingetragenen Vereins. Sie waren nur fördernde Mitglieder. In seinem ersten Befehl sprach der Reichsführer SS davon; daß man kinderreiche Mütter unterstützen müßte. Das klang beinahe vernünftig und einleuchtend. In seiner zweiten Anordnung tönte Himmler bereits, daß man auch der unehelichen Mutter den vollen Schutz der Gesellschaft geben müßte. In seinem dritten Erlaß aber befahl Heinrich Himmler mit Verhohlener Offenheit, das uneheliche Kind planmäßig zu zeugen. Wie man Autos produziert. Wie man Geflügel auf der Hühnerfarm züchtet.
Die Wände der Zentrale glichen zur Hälfte einer Kinderklinik und zur anderen einer Bildersammlung. Sie hingen im Rahmen an der Wand, waren gleich groß und gleich kitschig: der Rassechef persönlich, fahl und nicht eben nordisch. Der entlaufene Architekt Rosenberg. Der Propagandaminister Goebbels. Der Arbeitsführer Ley. Sie alle blickten mit gläsernen Augen aus hölzernen Rahmen auf ein Werk, wie es die Geschichte nicht noch einmal kennt. Auf eine Erfindung ohne Beispiel. Auf einen Frevel ohne Grenzen.
Und auf der anderen Seite hingen unschuldige Kinderköpfe in einer Reihe.
Der Nationalsozialismus hatte Gott abgeschafft, die Stukas und den Kunsthonig erfunden. Das braune Reich hatte den Heldentod in Mode gebracht. Und jetzt machte sich das System daran, Kinder am Fließband herzustellen. Mit einer am Papier errechneten Kopfform. Mit einer vorher bestimmten Augenfarbe. Mit einer Mindestkörpergröße. Gezeugt ohne Liebe. Erzogen ohne Gott. Heranwachsend ohne Mutter. Kinder, die statt beten boxen und statt lieben hassen lernen sollten. Kinder des Führers . . .
Auch SS-Sturmbannführer Westroff-Meyer sah nicht gerade aus wie das Endprodukt seines unheimlichen Werkes. Er leitete die Aktion römisch zwo, arabisch eins, Heim Z. Er war prall in den Hüften und massig im Genick. In seinem Gesicht kontrastierte das schlaffe Maul eines Karpfens mit den kleinen Augen eines Hechtes. Daneben trug er an den Wangen das Emblem des Korpsstudenten, Säbelschmisse, die aus der Zeit stammten, als der Führer noch nicht den Boxhandschuh entdeckt hatte.
Der Sturmbannführer diktierte erregt und konfus, wie immer mit erhobener, salbadernder Stimme, wenn er Ungeheuerlichkeiten schwarz auf weiß festlegte. Er hatte Jura studiert und Schiffbruch erlitten. Er war auf Medizin ausgewichen und im Physikum hängengeblieben. Seinem Vater wurde es zu dumm. Er entzog ihm den Monatswechsel. Und so verstärkte Heinz Westroff-Meyer das namenlose Heer der Abenteurer, die hinter dem Hakenkreuz herliefen.
Er aber wollte nicht namenlos bleiben.
» . . . Deshalb . . .«, diktierte er seiner Sekretärin, »sind alle Maßnahmen besonders geheimzuhalten . . . Es ist dafür zu sorgen, daß die künftigen Mütter schon vor der Geburt auf ihre Kinder verzichten. Die Säuglinge sind rechtzeitig von den Müttern zu trennen . . . Nur in Ausnahmefällen darf gestattet werden, daß die für die Aktion ausgewählten Mädchen unter einskommasiebzig groß sind. Auch verheiratete Frauen sind grundsätzlich zugelassen; So ihre Männer an der Front stehen, ist Sondergenehmigung einzuholen . . . Es besteht Veranlassung, noch einmal auf die absolute Geheimhaltung hinzuweisen. Zu gegebener Zeit wird sich der Reichsführer SS zu diesem großen Werk für Großdeutschland bekennen . . . Bis zu dieser Zeit aber ist alles zu unterlassen, was die kämpfende Bevölkerung beunruhigen könnte . . . Die Volksaufklärung wird zur rechten Zeit einen Wandel der öffentlichen Meinung herbeiführen . . .«
Der Sturmbannführer unterbrach seinen Fußmarsch.
»Haben Sie es?« fragte er seine Sekretärin.
» . . . einen Wandel der öffentlichen Meinung herbeiführen«, leierte das blasse Mädchen.
»Gut«, antwortete Westroff-Meyer, »Heil Hitler . . . das Übliche . . .«
Er ließ sich auf einen Stuhl fallen, zündete sich eine Zigarette an.
»Ich fahre selbst zur Aktion II-1, Heim Z . . . Große Sache, einmalige Sache!« setzte er hinzu. »Der Reichsführer ist ein Genie!«
Das Mädchen nickte mit willigem Nacken. Sie hieß Schmidt, und da sie kleiner als einskommasiebzig war, nannte man sie Schmidtchen. Sie hatte sich abgewöhnt, den Kopf zu schütteln. Sie glaubte an die Bewegung. Aber seitdem sie beim Lebensborn war, bewegte sich in ihrem armen Kopf zuviel . . .
1939 entstand diese seltsame Organisation mit dem unauffälligen Status eines eingetragenen Vereins, dessen Führung Himmler persönlich übernommen hatte. Er rechnete sich aus, daß im Zweiten Weltkrieg Hunderttausende, wenn nicht Millionen junger Männer fallen würden. Er zog sie von der Summe der gleichaltrigen Frauen ab, die zwangsläufig nicht mehr heiraten konnten. Die Bilanz war der Kinderverlust.
Das brachte ihn auf den Gedanken: die Toten des Zweiten Weltkriegs sollten zuerst noch ihre ›biologische Pflicht‹ erfüllen. Es sollte, nach Himmler, zumindest kein Blondschopf mehr unter dem Birkenkreuz eingegraben werden, bevor der Gefallene nicht Vater geworden war. Die Zeugung der reinen nordischen Rasse freilich blieb das Endziel des Lebensborns, der jetzt eben aus dem Stadium der Planung heraustrat.
Das SS-Rasse- und Siedlungshauptamt wollte deshalb das Notwendige mit dem Nützlichen verbinden und schickte sich an, eine Art Rassensteuerung zu betreiben. Die Versuche, die der ahnungslose Pfarrer Gregor Mendel mit Pflanzen angestellt hatte, verpflanzten die Machthaber des Dritten Reiches einfach auf Menschen. Mit allen Mitteln. Vielleicht beleuchtet nichts deutlicher die Bewegung als der Lebensborn: der Sieg der Ignoranz über die Intelligenz. Die Auflösung des Anstandes in Wahnsinn.
Für die unsauberen Ziele erfand man als Afterwissenschaft die Rassenhygiene. Ein Herr Günther wurde zum Propheten der Dummheit und lieferte die Würze zu dem braunen Plan.
Selbst in der Hilfsschule konnte man lernen, daß sich das deutsche Volk aus einem Schmelztiegel von Völkern im Laufe der Jahrhunderte gebildet hatte. Mit diesem geschichtlichen Prozeß wollten nunmehr Männer à la Westroff-Meyer kurzen Prozeß machen. Sie schickten sich an, eine ›neue Rasse‹ mit den gleichen Mitteln zu schaffen, wie man einem morschen Apfelbaum einen frischen Ast aufpfropft . . .
»So«, sagte der SS-Sturmbannführer, »fertig für heute.«
»Wo ist denn eigentlich das Heim Z?« fragte Schmidtchen.
»In Polen«, antwortete er, »vorläufig . . . wir werden es bald nach Oberbayern verlegen . . .«
»Und die Mädchen sind . . . einfach so . . . so bereit?«
»Wie meinen Sie das?« fragte Westroff-Meyer scharf.
»Na, ich denke . . . ich meine . . . die Kinder . . .«
»Die Kinder?« fragte er mit gehobenen Augenbrauen.
»Was sind das . . . für Mütter . . . die ihre Kinder . . .«
Der Sturmbannführer schwoll an. Seine fleischigen Ohrläppchen wurden rot.
»Schänden Sie nicht das Opfer dieser deutschesten aller Frauen!« brüllte er.
Er knallte die Tür zu, wuchtete über den Gang.
Wir haben noch eine harte Erziehungsarbeit vor uns, dachte er . . .