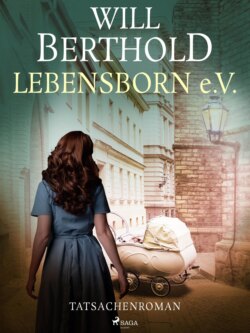Читать книгу Lebensborn e.V. - Tatsachenroman - Will Berthold - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. KAPITEL
ОглавлениеDer Herbst machte traurig und müde. Er legte sich schwer auf die Schultern. Aus dem dunklen Zelt der Nacht lösten sich Schatten, Menschen, Schicksale. Auf dem Kies knirschten Schritte. Drinnen, im weiträumigen Haus, girrte ein Mädchenlachen auf, stieg steil in die Höhe, brach plötzlich ab. Einer suchte am Radio, hastig von Station zu Station, als sollte Musik die Mauer der Befangenheit durchbrechen, als könnte Rhythmus feuchte Hände und unstete Blicke beseitigen. Denn diese erste, für 50 junge Menschen vom Lebensborn arrangierte Begegnung war banal und borniert.
Oberleutnant Klaus Steinbach ging ziellos durch den gepflegten Park, den Kopf zwischen die Schultern gezogen.
Auf einmal blieb ein Schatten vor ihm stehen. Aus der Nacht schälte sich ein dünnes, dürftiges Lächeln.
»Klaus . . .«, sagte Doris leise. Ihre Stimme klang verloren. Ihre schmale Gestalt wirkte hilflos und rührend. Ihre Arme blieben auf halbem Wege stehen, wie von Angst gelähmt.
Sie standen voreinander, reglos und fremd. Das Gesicht des jungen Offiziers war fahl, die Augen des Mädchens schimmerten feucht. Irgendwo wurde eine Tür zugeknallt. Dann klang eine rostige Stimme laut durch den Park:
»Kann denn Liebe Sünde sein . . .?«
Klaus’ Lippen zuckten mit, fast im gleichen Takt. Er hatte Doris sofort erkannt. Aber er sah sie nicht an. Etwas streifte ihn weich. Aber er gab dem Strom nicht nach. Er suchte nach einem befreienden Wort. Aber er fand nur bange Gedanken.
»Klaus . . .«, begann Doris zum zweitenmal, »bitte . . . sag doch was . . .«
Er schwankte leicht nach vorne wie ein Baum unter einem plötzlichen Windstoß. Dann sah Doris sein Gesicht fast über ihrer Stirn, nahe auf einmal, unheimlich nah. Sie erschrak.
»Das also . . .«, quetschte er zwischen den Zähnen hervor, »das also . . . hast du dir aufgespart . . . weißt du noch . . . damals . . . im Urlaub?«
Er sprach die Worte nicht. Er spuckte sie aus. In seinem Gesicht zuckten die Muskeln wie Gefühle, und über diese nachtfahle Skala zogen Verzweiflung und Not, Liebe und Haß, Enttäuschung und Hoffnung.
Das Mädchen hielt ihm den Kopf entgegen, schmal und blaß. Eine Sekunde lang wußte Klaus, daß er Doris nie schöner gesehen hatte. Ihre Lider und Lippen waren geschlossen. Aber er übersah ihr Gesicht. Er schluckte, schmeckte die Bitternis, bis es ihm weh tat.
Da ging er weiter. Mechanisch. Schritt für Schritt. Ziellos. Er hatte mit seinen weichen Knien fertig zu werden. Er ließ Doris stehen, als gäbe es sie nicht auf der Welt. Und dabei hatte seine Welt einmal nur aus Doris bestanden.
Mein Gott, dachte das Mädchen, das kann, das darf doch nicht so enden! Bei Doris war die Liebe größer als der Trotz, die Sehnsucht stärker als der Schmerz. Deshalb folgte sie ihm, über die Gartenwege hinweg, die sich in der Finsternis verloren. Zögernd zunächst, dann rascher. Schließlich holte sie ihn ein.
Sie legte die Hand auf seinen Arm. Er zuckte zusammen, zog seinen Arm krampfhaft zurück.
Doris begann zu sprechen, zu bitten. Sie wollte erklären. Es war doch alles so einfach und ohne ihr Zutun gekommen! Da stellte sie entsetzt fest, daß es keine Erklärung gab, daß das Einfache konfus und die Wahrheit verlogen wirkte. Die Sätze wurden zu Fallen.
Klaus blieb mit einem Ruck stehen. Er brach achtlos einen Zweig vom Strauch, klatschte fahrig damit gegen seine Stiefelschäfte.
»Gib dir keine Mühe«, sagte er durch die Zähne, »hast du dich . . . freiwillig hierher gemeldet . . . oder nicht?«
Doris schwieg. Gelähmt. Verwirrt. Verraten. Und allein, unendlich allein . . .
»Na also«, fuhr er mit kalter, erzwungener Ruhe fort.
Seine Worte verwehten. Doris und Klaus liefen nah und doch fern nebeneinander her. Der Dorn eines verblühten Rosenstrauches verfing sich im Rock des Mädchens. Doris riß ihn aus. Als ob sie mit ihm ihre Hemmung beseitigt hätte, verfügte sie auf einmal wieder über ihre Stimme von früher, über das Lächeln von damals, über die Sicherheit von einst.
»In unserem Park waren die Wege viel breiter«, sagte sie ruhig.
Dann betrachtete sie Klaus bang von der Seite. In seinem Gesicht gab es keine Erinnerung. Oder doch? Konnte die Zeit, in der ein Blick, ein Händedruck, ein Lächeln genügt hatten, um sich zu verstehen, jemals vergessen sein?
Und du, Klaus, dachte Doris, wie kommst du hierher . . .? Siehst du . . . du kannst es mir sowenig erklären wie ich dir. Aber Doris sprach es nicht aus. Ihre Liebe war so klar wie ihre Stirn, und sie weigerte sich, sie durch einen schmutzigen Verdacht von der Höhe in die Niederungen zu zerren. Doris senkte den Kopf.
»Wohin sind wir . . . geraten, Klaus?« fragte sie.
Sie hatten die Wegbiegung auf dem freien Rasenplatz erreicht, in dessen Mitte die ›Adolf-Hitler-Eiche‹ stand, ein mickriges Bäumchen, gepflanzt zu Ehren des Führers, begossen in dem Wahn, daß die Bäume des Nationalsozialismus in den Himmel wachsen könnten.
Da blieb Klaus Steinbach zum zweitenmal stehen. Umständlich zog er ein Zigarettenpäckchen aus der Tasche, als wollte er Zeit gewinnen. Er wußte gar nicht, daß er in diesen Sekunden nach einer Brücke über seinen Stolz, nach einer Furt durch die Tiefe suchte. Aber er fand nichts, nur ein Streichholz, das in seiner Hand flackerte.
»Was willst du eigentlich noch?« fragte er rauh.
Sie bewegte die Lippen so lautlos und verzweifelt, daß es ihm weh tat. Aber er könnte nicht aufhören, Doris und sich zu verletzen.
Sie stand neben ihm wie ein ausgesetztes Kind. Ihre Augen flehten. Es gelang ihr nicht, ihm zu sagen, daß sie heim wollte . . . heim zu ihm, und heim zur weißen Villa am Stadtrand, heim in den Park, in dem sie als Kind mit Klaus gespielt, in dem sie ihn als Mädchen geküßt hatte. Zurück in ein Paradies, in dem es den Sturmbannführer Westroff-Meyer nicht gab. Zurück, nur ein halbes Jahr, um noch einmal anzufangen, um alles anders zu machen.
»Klaus . . .«, sagte sie schlicht, »ich hab’ dich lieb . . .« Ein schmales, blasses Lächeln huschte über ihr Gesicht.
Jetzt sah Klaus sie an, spürte Hitze und Kälte. Seine Augen brannten in den Höhlen. Seine Zunge lag trocken im Mund. In diesem Moment haßte er sich und den Heimleiter. In diesem Augenblick roch der Herbst nach Fäulnis, und er wünschte, er könnte diesen Geruch mit dem der Pulvergase seiner Bordkanone vertauschen. Jetzt wollte er starten, fliegen, kämpfen und fallen.
»Und ich . . .«, stieß er mit fremder, harter Stimme hervor, »ich . . . will dich nie . . . nie mehr sehen . . . hörst du!«
Doris rührte sich nicht.
»Geh!« zischte er.
Jetzt tat sie es.
Als sie sich mit zögernden Füßen von ihm entfernte, hoffte Klaus, daß sie bleiben würde. Der Fliegeroffizier trat mit dem Stiefel gegen Adolf Hitlers schäbige Eiche. Doris, dachte er, verloren, verraten, verdammt. Er preßte die Hände an die Rinde.
Und auf einmal drehte sich der Baum mit ihm, flachtrudelnd wie ein Flugzeug, das in den Abgrund stürzt . . .
Der Abend gibt sich zwanglos, unpolitisch und unbiologisch. Sturmbannführer Westroff-Meyer läßt kalte Platten zum Pfefferminztee reichen. »So, Kinder . . .«, sagt er jovial, als er die starre Tischordnung aufhebt, »nun beriecht euch erst mal . . .«
Jetzt geht der Heimleiter mit schnellem Schritt durch den unteren Speisesaal auf eine Gruppe von RAD-Führerinnen zu, die unter dem Spruchband ›Heilig sei uns jede Mutter guten Blutes!‹ ihre Schinkenbrötchen verzehren und ihren Pfefferminztee trinken.
»Na, wie fühlt ihr euch?« fragt er.
»Danke, gut, Sturmbannführer«, antworten sie im Chor.
»Ihr sollt euch hier richtig einleben«, erwidert Westroff-Meyer, »am Tag werden wir härt arbeiten . . . aber am Abend wollen wir gesellig sein . . .« Er nickt und schnarrt: »Weitermachen!«
Dann geht er auf die andere Seite, auf zwei alleinsitzende SS-Unterführer zu, die aufspringen wollen, was er mit einer Handbewegung verhindert.
»Wir sind hier nicht so förmlich«, stellt er güt gelaunt fest. »Gefällt’s euch?«
Er wartet das obligate »Jawohl!« nicht ab, sondern setzt gleich hinzu:
»Sitzt doch hier nicht ’rum wie die Holzblöcke . . . los, laßt die Mädchen da drüben nicht allein!« Seine kleinen Hechtaugen streifen den anderen Tisch. »Die beißen euch schon nicht.«
Die Maiden beobachten ängstlich und neugierig das Gespräch. Wenn sie über die Köpfe der beiden Soldaten hinwegsehen, lesen sie an der Wand:
›Dem Sieg der Waffen muß der Sieg des Kindes folgen!‹ Und darunter steht, um den letzten Zweifel auszuschließen, als Verfasser dieses Kernspruchs: Heinrich Himmler.
In der Tür dreht sich Westroff-Meyer noch einmal zurück, um zu verfolgen, wie sein Befehl von den SS-Führern ausgeführt wird.
Die beiden SS-Leute sehen es und stehen auf. Sie gehen eckig auf den anderen Tisch zu, während die Maiden geflissentlich an ihnen vorbeisehen. Der vordere überspielt seine Verlegenheit.
»Na«, sagt er, »was macht ihr denn hier?« Dabei nimmt er einen Stuhl und setzt sich umständlich.
»Ihr seid wohl taubstumm?« fragt der zweite.
»Nein«, erwidert eines der Mädchen, »ihr seid ja auch nicht sehr gesprächig.«
»Kommt schon noch«, beteuert der erste, bevor er schweigt. Er dreht sich nach seinem Kameraden um und flucht halblaut: »Herrgott . . . zum Trinken müßte man was haben!«
Zufriedener ist der Heimleiter schon mit dem Musiksaal, dessen verstimmtem Klavier ein junger Leutnant markige Weisen abgewinnt, angefeuert von dem angetrunkenen Hauptsturmführer Kempe, der immer bei allem vorangehen muß. Dieser Raum reißt die erste Bresche in die lähmende Atmosphäre des Lebensborn-Heimes. Hier finden die ersten zusammen, weil sie primitiv oder kaltschnäuzig, angetrunken oder gleichgültig sind, oder weil sie ganz einfach die Befangenheit zu Paaren treibt. Hier stehen die Männer und Mädchen bereits in bunter Reihe um das Instrument. In einem improvisierten Wunschkonzert, für das das Repertoire des Pianisten nicht ausreicht.
»Los!« ruft Kempe mit dröhnendem Baß dem Klavierspieler zu. Er fuchtelt mit den Armen den Rhythmus mit und grölt:
»Oh . . . du schö-ö-öner Westerwald . . .« Beim Wort ›schön‹ fährt seine Stimme Schiffschaukel.
Ein Mädchen lacht hell. Zwei Männer singen mit. Ein Untersturmführer legt die pralle Hand auf die Schulter einer üppigen Blondine. Sie kichert und zeigt neckische Gegenwehr.
» . . . pfeift der Wind so kalt . . .«, tobt Hauptsturmführer Kempe.
Dann sieht er den Heimleiter und bricht ab.
»Weitermachen!« befiehlt der Sturmbannführer zum zweitenmal. Er klopft dem Klavierspieler auf die Schulter. »Bringen Sie nur etwas Leben in die Bude, Mann . . .« Bevor er den Raum verläßt, setzt er überflüssig hinzu:
»Herrschaften, morgen um zehn, im Lehrsaal eins . . . Heil Hitler!«
»Heil Hitler!« rufen sie zurück.
Dann marschiert der Westerwald wieder. Kempe hebt den oberen Deckel des Klaviers auf und starrt auf die Saiten. Wenn er Bier zur Hand hätte, würde er es hineinschütten, wie in Polen oder sonst irgendwo, wo man erobern und zerstören konnte.
Dabei mögen die Mädchen ihn. Er ist nicht unsympathisch, und man merkt ihm gleich an, was er will, im Guten wie im Bösen. Der Hauptsturmführer hätte Gelegenheit, nach der Schönsten zu sehen, aber er pflegt immer nach der nächsten zu greifen.
Heute nach Lotte, der gläubigen RAD-Führerin, die sich gerade in ihrem Zimmer umzieht, weil ihr die Weltanschauung doch noch etwas Platz zur Eitelkeit läßt.
Der Spaß mit dem Klavier wird Kempe zu langweilig. Er klappt den Deckel zu. Bier kann er doch nicht hineingießen, und im übrigen hat er noch Schnaps auf der Bude, der in diesem Hause so verpönt wie notwendig ist.
Auf dem Gang trifft er Klaus Steinbach, der sich nach dem Zusammenstoß mit Doris vom Garten in das Haus stiehlt.
»Na, Kamerad«, sagt er, »heben wir wieder einen?«
»Laß mich.«
»Ja, weeß schon . . . det tolle Ding mit deiner Braut . . .«
Klaus geht weiter. Der Hauptsturmführer läuft hinter ihm her.
»Laß doch den Kopp nich hängen, Mann . . . hier jibt’s doch ville Bräute . . .« Er lacht breit und behaglich, »ick hab’ schon eene . . . sehr schön is se nich, verstehste . . . aber sonst . . .«
Klaus geht in sein Zimmer, knallt die Türe zu und dreht sofort den Schlüssel herum.
Der Hauptsturmführer schüttelt erschrocken den Kopf und geht zurück.
Lotte trägt einen hellen Pullover zu einem grauen Flanellrock.
»Na, Mädchen . . . da biste ja . . .«, begrüßt sie der SS-Offizier. »Gehen wir noch ein bißchen bummeln . . . frische Luft . . .«
»Ja«, antwortet die RAD-Führerin kleinlaut.
Sie gehen durch den Park. Er legt automatisch seine Hand um ihre Schulter, zieht Lotte an sich. Es ist vielleicht das erste Mal, daß sie in ihrem bescheidenen Leben die noch bescheidenere Zärtlichkeit eines Mannes streift und sie so stark durchpulst wie der Glaube an den Führer.
»Na, nu biste ja janz manierlich . . .« Der Mann mit dem einen Meter 88 großen Selbstbewußtsein streichelt ihr Kinn. Dann kämpft Schnapsdunst mit Nachtluft.
»Schon viel erlebt?« fragt er.
»Wie meinen Sie das?«
»Mensch, Lotte, wir sagen doch du zueinander . . .«
»Ja«, erwidert sie. Sie hebt zuerst den Kopf, dann die Augen. »Ich hab’ noch nichts erlebt . . .«, antwortet sie dann leise, »und ich möchte auch nichts erleben . . . so nicht . . . ich will . . .«
»So, nischt . . . und da kommste hierher?«
Er betrachtet Lotte, die verwirrt auf den Boden sieht. Er zieht die Schultern hoch.
»Na . . . mir soll’s recht sein . . .«, brummt er. Er läßt die Zügel seiner Gedanken schießen. Schließlich sagt er mit trunkenem Trübsinn:
»Alles Mist . . . dieser Quatsch!«
Dann bleibt er stehen und zieht Lotte unvermittelt an sich. Sie macht sich steif wie eine Puppe. Sie zittert. Aber ihre Lippen sind kalt. Sie denkt an das Opfer, das sie bringen will und beißt die Zähne aufeinander. So schwer ist das, überlegt sie. Aber ich tue es ja nicht für mich . . . für die anderen, für die Bewegung, die mich dafür ausgewählt hat, und die das Volk durch Nacht zum Licht führt.
»Komm«, sagt Kempe leise, »wir gehen nach oben . . .«
Die RAD-Führerin nickt schwerfällig und mechanisch mit dem Kopf. Ihr Nacken ist steif. Ihre Augen wirken starr. Sie hat Angst. Vor dem Opfer, das jetzt kommen muß . . .
Doris weinte tränenlos. Sie lag wach. Die Verzweiflung schüttelte sie wie ein Krampf. Sie hörte seine Worte wie von einer Geisterstimme wiederholt. Immer den gleichen Satz, denselben Sinn:
»Ich will dich nie wiedersehen, hörst du, nie wieder . . .«
Gut, dachte Doris, ich will es dir leicht machen, Klaus, ganz leicht . . .
Sie hörte Schritte vor der Tür und richtete sich auf. Sie hoffte, daß er doch noch zu ihr finden würde, und sie fürchtete, daß ein anderer Zugang suchen konnte. Stand da nicht jemand vor der Tür?
Von unten kam wieder Lachen, Gesprächsfetzen. Türen wurden zugeschlagen. Entfernte Schritte trampelten über die Gänge. Wieder drehte einer am Radio. Was macht Klaus jetzt, überlegte Doris, denkt er wenigstens an mich? Und warum das alles? Was ist das für ein System, das junge Mädchen so erniedrigt? Wer hat das Recht, so in ihre natürlichen Empfindungen, in ihr persönliches Leben einzugreifen? Wer darf sie so versachlichen? Wer stellt die ungeheuerliche Forderung an sie, ihre Kinder so dem Staat zu opfern, wie man einst im alten Babylon die Erstgeborenen in den glühenden Rachen des Götzen Baal schleuderte?
Ein leiser Trost streichelte sie in diesem Moment. Ich versteh’ dich ja, Klaus, dachte sie, daß du damit nichts zu tun haben willst. Ich würde dich sonst nicht lieben können . . .
Doris war ein junges, natürliches Mädchen, das eine junge, natürliche Mutter werden wollte, deren Hände ihr Kind zärtlich streicheln, deren Ohren verzückt hören, wie es zum erstenmal das Wort Mutter ausspricht. Und dieses Kind sollte von Klaus sein, dem Nachbarssohn, den sie von klein auf liebte; von demselben Oberleutnant Klaus Steinbach, der sie jetzt haßte, erniedrigte und beleidigte, weil die Zeit sie wie ein Strudel in den Abgrund gerissen hatte . . . die Bewegung, an die sie immer noch glauben wollte, obwohl sie sie nicht mehr verstand . . .
Wieder hörte Doris Schritte, fuhr entsetzt hoch. Die Tür ging auf. Klaus . . . hoffte, dachte sie einen Augenblick. Dann flämmte Licht auf. Und sie sah enttäuscht und doch erleichtert, daß Erika, die Stubenkameradin aus dem RAD-Führerlager, vor ihr stand.
»Was machst du denn hier?« sprudelte sie los, »ich such’ dich schon die ganze Zeit . . . ist ganz lustig unten . . .«
Erika setzte sich auf Doris’ Bett.
»Los, keine Müdigkeit vorschützen! Zieh dich an, Mädchen!«
Doris wandte fast ruckartig das Gesicht von ihr ab.
Da faßte sie Erika am Kinn und fragte betroffen:
»Was hast du denn?«
»Ach . . . nichts . . .«
»Ärger gehabt?«
»Nein.«
»Doris . . . du wirst den Unsinn hier doch nicht ernst nehmen . . .?« Sie redete sich in Zorn, der rasch wieder abflaute: »diesen aufgeblasenen Quatsch . . . diese nordisch-fälische Mischpoke . . . Was passiert?«
»Es ist . . . etwas anderes . . .«
»Versteh’ich nicht . . .«
»Hör mal«, sagte Doris. Sie lächelte blaß und matt. »Ich halt’s hier nicht mehr aus . . . ich muß weg. Morgen schon! Ich kann hier keinen Tag mehr bleiben . . .«
»Aber das geht doch nicht«, versetzte Erika betroffen. »Mach keine Dummheiten, Mädchen . . . ist doch alles halb so schlimm . . . Wir schlagen uns hier schon durch. Meinst du, ich habe Angst? . . . Führerkinder . . . Mensch, bei denen piept’s wohl!«
Erika stand auf. Mit den Gedanken war sie bereits wieder im Aufenthaltsraum, wo gelacht und geflirtet wurde.
»Willst du mir nicht doch . . . sagen . . .«
»Ich . . . ich kann nicht . . .«
»Also, mach keinen Quatsch, Mädchen . . .«, sagte Erika abschließend, löschte das Licht, schloß die Tür und hatte es eilig. Sie schüttelte die Sorge um Doris ab, nicht, weil sie herzlos war, sondern weil sie die Verzweiflung der Freundin nicht richtig erkannt hatte.
Erst zu spät, am nächsten Vormittag um zehn Uhr, würde Erika ihre Oberflächlichkeit verwünschen . . .
Von dem Moment an, da das Mädchen Lotte und der SS-Hauptsturmführer Kempe die Schwelle des Zimmers überschritten haben, kommen sie sich wie auf Kommando nackt vor. Der Raum ist einfach, fast spartanisch eingerichtet. Die Möbel sind hell, aber kalt. Das ölgemalte Hitlerbild, der Führer mit hochgeschlagenem Mantelkragen, ist in jedem Raum dieses Heims zu Hause.
Lotte steht am Fenster, soweit wie möglich vom Lichtkegel entfernt. Sie schämt sich. Aber dieses heiße Gefühl reicht noch nicht aus, um ihr Weltbild einzureißen. Morgen, denkt sie, oder übermorgen . . . Aber heute noch nicht . . . So darf es nicht sein! Ich kenne ihn doch kaum! Freilich, er gehört zur Auslese wie ich. Aber er sieht mich ja gar nicht richtig an. Er weicht mir aus. Er grinst, wenn ich ihn etwas frage. Und er riecht nach Alkohol.
Kempe deutet auf seine Aktentasche.
»Marschgepäck«, sagt er lakonisch.
Er setzt sich auf das Bett, schlägt die Tasche auf wie ein Zauberer, der die weiße Taube flattern läßt.
Es ist Wodka. Und nicht einmal die Gläser hat der Offizier vergessen. Er nimmt die Flasche, als ob er ihr den Hals abdrehen wollte, zieht den lockeren Korken heraus, schenkt zwei Gläser voll.
»Prost!« sagt er, »setz dich doch . . . machen wa’s uns jemütlich, Mädchen . . .«
Lotte wird von der Peinlichkeit gewürgt. In ihrem blassen Gesicht sind rote Flecken. Sie sieht sich um, betrachtet die Tür, als ob sie gleich fliehen möchte. Wenn er nur etwas sagen würde . . . eine herzliche Geste oder eine dienstliche Parole, ja, auch das . . . schließlich will Lotte bewußt erleben, was man von ihr verlangt . . .
»Keinen Durst?« fragt Kempe. »Prima Ware . . . meine Kompanie hat davon schon ganze Fässer ausgesoffen . . .«
»Ich mag das nicht«, erwidert Lotte.
»Den Wodka?«
»Daß du so trinkst . . .«
»Probier’s mal«, entgegnet der Hauptsturmführer. »Ach . . .« setzt er hinzu, »weeß schon . . . das dämliche Licht . . .« Er geht an das Waschbecken, nimmt das Handtuch und legt es über den grünen Lampenschirm.
»So . . .«, sagt er grinsend, »und jetzt jute Nacht.«
»Ich versteh’ dich nicht«, versetzte Lotte. Sie spürt die Gänsehaut auf ihren Armen und ist auf einmal grenzenlos enttäuscht und ernüchtert.
»Wat vastehste nich?«
» Wir sind doch hier . . . zu einem . . . ernsten Zweck . . .«
»Sicher . . . aber der Ernst kann doch auch jemütlich sein, nich?«
»Wir tun hier, was das Volk von uns erwartet . . .«
»Knorke«, erwidert der SS-Offizier feixend. Dann spült er das zweite Glas hinunter.
Lotte geht mit den schleppenden Schritten eines gefangenen Tieres auf die andere Seite. Sie steht unter dem Hitler-Bild, streift es einen Moment mit den Augen, als ob der Führer sie schützen könnte.
»Det is unsa Adolf . . .«, sagt Kempe, »kenn’ wa . . .«
Er füllt das nächste Glas, hebt es:
»Prost, Alter!«
Dann dreht er sich nach Lotte um.
»Haste schon mal den Führer erlebt?«
»Nein«, erwidert das verwirrte Mädchen.
»Aber ick . . . ick hab’ ihm schon die Hand jedrückt . . .« Er nickt sich ernst und stolz zu. Sein Nationalsozialismus ist mehr praktischer Art. Er ist jederzeit bereit, die Feinde der Bewegung totzuschlagen, aber die braune Theorie zu glauben – nein, das kann kein Mensch von ihm verlangen.
»Seid ihr alle so?« fragt Lotte.
»Wie?«
»So . . . so respektlos . . . und betrunken . . . und . . .«, Lotte sucht nach dem Wort, findet es: »verantwortungslos . . .«
»Hör zu, Mädchen . . . wir kämpfen, wir sterben, und wir lassen sterben . . . und alles für den Führer . . . so . . . und jetzt biste dran . . .«
Kempe verschüttet das Glas, betrachtet trübsinnig den verlorenen Wodka, schenkt sich nach, beobachtet die noch immer unter dem Hitler-Bild stehende RAD-Führerin, die nie echter war als jetzt in ihrer Hilflosigkeit.
»Weiß schon«, knurrte er, »der Führer raucht nicht, trinkt nicht, schläft nicht, fällt nicht . . .«
Das Mädchen schüttelt sich unter seinen Worten wie unter einem Regenguß.
»Und vegetarisch lebt er ooch noch . . . So, Lotte, und jetzt lassen wa die Faxen, und jetzt zwitscherste mal einen . . .«
»Geh«, sagt sie lauter, als sie will, »geh sofort weg . . . mit dir . . . mit euch . . . will ich nichts zu tun haben . . . ihr seid wie . . .
»Hör mal, Kleene . . . langsam wer’ ick ärgerlich . . . det kann ick dir varaten.«
»Ich rufe den Heimleiter.«
»Quatsch«, sagt er. Dann geht er auf Lotte zu, legt die Arme um sie, preßt sie an sich, ohne Überzeugung eigentlich, nur auf Befehl.
Kempe spürt ihren Widerstand. Er liest den Ekel aus ihrem Gesicht. Da läßt er sie los. Geht wieder an seine Aktentasche, korkt die fast leere Wodkaflasche zu, nimmt das Handtuch von der Lampe, sieht im kräftigen Lichtstrahl das weinende Mädchen, nickt.
»Weeßte wat«, sagt er jetzt doch ärgerlich, »rutsch mir den Buckel ’runter, du dämliche RAD-Zicke!«
Er knallt die Tür zu, schüttelt sich und geht wieder nach unten, schon versöhnt und bereit, nach der nächsten zu greifen . . .
Am nächsten Tag, Punkt zehn Uhr, beginnt die Schulung. Der Speiseraum wird zum Lehrsaal. Die Tische stehen an der Wand, die Stühle in Marschkolonne. Vorne, an der Schmalseite des Raums, hat der Sturmbannführer Westroff-Meyer Kartenbilder entrollt und aufgehängt, auf die er mit dem Zeigestock deutet wie in der Schule. Seine Stimme klingt ölig. Er agiert, als hätte er sein Leben lang davon geträumt, Zuhörer zu finden. Jetzt hat er es geschafft. Nach einem erfolglosen Versuch in Juristerei und Medizin sattelt er auf ein anderes Pferd um. Auf das Paradepferd der Bewegung. Auf die Rassenhygiene.
Die Kartenbilder sind mit Blumen, mit Erbsen und Kastanien bemalt. Wirre Linien zeigen auf, wie man sie kreuzte. Aus roten Blüten werden weiße, aus runden Erbsen kantige, aus stacheligen Kastanienschalen glatte. Mit seiner Auffassung von Biologie beginnt der Heimleiter von der Pike auf . . .
»Diese botanischen Erkenntnisse können wir ohne weiteres auf den Menschen übertragen«, ruft der Heimleiter seinen Schülern zu, die weder Erbsen noch Kastanien, sondern Menschen sind, die gleichgültig vor sich hinstarren, zum Fenster hinausschauen, oder an seinen Lippen hängen.
Erika, die Praktische, denkt an das Gemüse, das sie beim Arbeitsdienst geputzt hat. Und dann erschrickt sie. Wo ist Doris? Sie fehlt! Erika will aufstehen und im Zimmer der Freundin nachsehen, aber sie wagt es nicht. Mein Gott, denkt sie, wenn Doris tatsächlich geflüchtet ist, ohne Marschbefehl, ohne Abmeldung, ohne Urlaubsschein . . .
Ganz in ihrer Nähe sitzt Klaus, der nicht mehr über Doris nachdenken will und doch muß, der sie mit den Augen sucht und sich fragt, wo sie sein könnte. Und dann die Frage wieder wegwischt, und mit aufgeworfenen Lippen den rassereinen Mischmasch über sich ergehen läßt.
Auch das gehört zum Lebensborn, wie die Säuglingsheime, wie die blitzblanken Säle, wie der biedere Standartenführer in der Verwaltungszentrale, der seine Lebensborn-Heime so ordentlich leitet, daß Jahre später der Nürnberger Gerichtshof ihn ausdrücklich freisprechen wird. Auch beim Lebensborn gilt: was die Rechte tut, braucht die Linke nicht zu wissen. Die Bewegung freilich ist Linkshänder. Während man nach außen hin einen beinahe idyllischen Rahmen wahrt, während der Rassechef persönlich beteuert, daß die Erziehung eines Kindes im Schoß der Familie durch nichts ersetzt werden kann, hatte er in einem Erlaß vom 28. Oktober 1939 schon die Zeugung des außerehelichen Kindes auf dem Verwaltungswege angeordnet. Er macht das größte Wunder der Natur, die Geburt, zum SS-Befehl! Geburt um jeden Preis! Mit allen Mitteln! Planmäßig gesteuert, überwacht vom SS-Rasse- und Siedlungshauptamt, das alles das in Bewegung bringt, was später unter dem Sammelbegriff Lebensborn bekannt werden soll.
Der Sturmbannführer doziert weiter, kunterbunt durcheinander; Binsenwahrheiten, Halbwahrheiten; Parolen und Irrtümer. Er hat seinen Himmler im Kopf und seine Leute im Blick. Und während er spricht, wandern seine Augen mechanisch durch die Reihen, registrieren genau und taxieren rücksichtlos . . .
Auf einmal stockt der Heimleiter. Wo ist die Schwierige? Das Mädchen aus dem RAD-Lager, das nicht mitmachen und ausscheren wollte?
Sein Zeigestab sinkt nach unten. Seine Adern treten an der Stirne hervor.
»Eine Teilnehmerin fehlt«, ruft er in den Saal. »Ich bitte mir aus, daß mir die Vollzähligkeit künftig richtig gemeldet wird . . . Los«, sagt er zu Erika, »holen Sie Doris her!«
»Das . . . das geht nicht«, antwortet sie zögernd.
»Was soll das heißen?« brüllt Westroff-Meyer.
»Doris ist . . . ist abgereist.«
»Abgereist?« wiederholt der Heimleiter gefährlich leise.
Dann brüllt er los: »Das ist Fahnenflucht . . .! Desertion! Fahnenflucht«, schreit er noch einmal erbost in den Saal.
Jetzt erst begreift Oberleutnant Klaus Steinbach ganz und erschrickt. Fahnenflucht, dröhnt es in seinen Ohren nach.
Er weiß nur zu gut, was das bedeutet . . .