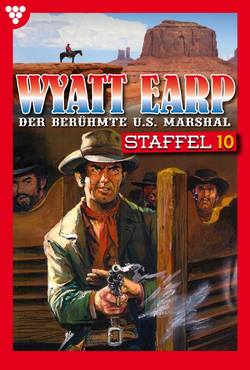Читать книгу Wyatt Earp Staffel 10 – Western - William Mark D. - Страница 9
ОглавлениеMit harten Augen blickte der Reiter in die Talsenke auf die wenigen Rinder, die am Creek weideten.
Roger Elliot war dreiundzwanzig. Er hatte eine mittlere Figur, schlanke Hüften und lange, schlaksige Beine. Niemals hatte ihn jemand ohne seidene Krawatte und weißes Hemd gesehen. Er kehrte den Sohn des wohlhabenden Ranchers heraus. So hatte er sich eigens aus Arizona eine echte Jacarilladecke kommen lassen und sie unter den mit dem Brandzeichen der Ranch verzierten Sattel gelegt. Sein Fuchshengst war hochbeinig und von edler Rasse. Alles an dem jungen Elliot wirkte aufgeputzt und gewollt.
Roger wurde von jedermann im County gefürchtet. Außer von den Barrings.
John Barring war im gleichen Jahr, ja, im gleichen Monat wie der Rancher James Elliot, Rogers Vater, in das Land zwischen dem Red Rock und dem Black Trail im Beaverhed County in der südwestlichen Ecke Montanas gekommen.
Anfangs waren die beiden Männer miteinander befreundet. Jeder baute seine kleine Ranch auf. Sieben Meilen nur trennten ihre Höfe voneinander.
Da lernten sie eines Tages in Dillon, der einzigen Stadt weit und breit, June Halloway kennen. Die hübsche Mayortochter tanzte mit beiden auf dem Fest, das Mayor Gallard zu seinem fünfundsechzigsten Geburtstag gegeben hatte.
Und dann wußten beide, daß sie das Mädchen liebten. Aber June konnte nur einen erhören – und nahm den stilleren, besonneren Mann, den Schotten Barring.
Von diesem Tag an war die Freundschaft der beiden Männer zu Ende. Die hübsche junge June Barring war sehr unglücklich darüber.
Aus Zorn heiratete Elliot Junes Freundin Mary.
Schon nach einem knappen Jahr hatte der Rancher Elliot einen Sohn. Im nächsten Jahr schenkte ihm Mary den zweiten. Darauf waren es Zwillinge und danach kam wieder ein Junge.
Fünf Jungen waren auf dem Hof des Ranchers Eliot und wuchsen heran, als June Barring ihrem Mann eine Tochter schenkte.
Zum erstenmal in seinem Leben haderte der Schotte mit seinem Geschick. Eine Tochter!
Was tat ein Rancher mit einer Tochter?
Zwei Tage lang kam er nicht nach Hause, stand in Dillon an der Theke des Montana Saloons und trank einen Whisky nach dem anderen. So etwas hatte er niemals zuvor getan.
Barring konnte sich bald etwas trösten, denn die kleine Ann wurde ein bildhübsches Mädchen.
Die fünf Jungen jedoch ersetzten drüben auf der Elliot Ranch eine Cowboy-Mannschaft und konnten dem Vater helfen, den Hof auszubauen, die Rinderzahl zu verdoppeln und immer mehr Land dazu zu nehmen.
Bei den Barrings indessen stand es schlecht. Der Schotte schuftete sich halb tot. Frau und Tochter vermochten ihm nicht einen einzigen Cowboy zu ersetzen, so sehr sie sich auch abmühten.
Barring hatte es schwer. Die Ranch kam nicht vorwärts, im Gegenteil. Barring mußte Rinder verkaufen, um den Hof überhaupt halten zu können.
Barring sah oft voller Neid die fünf jungen Elliots über die Prärie reiten, die große Herde zusammenhalten und überall nach dem Rechten sehen.
Sie hatten im Westen den großen Red Rock, von dem sie einige Wassergräben abgeleitet hatten, um sie durch die Weide zu führen. Das gab dem Gras neue Kraft.
Selbst wenn Barring ein paar Leute gehabt hätte, wäre es ihm nicht möglich gewesen, etwas Ähnliches zu versuchen, da der Black Trail viel zu weit im Osten lag.
Und der kleine Creek, der durch seine Weide rann, der reichte kaum aus, die nächste Umgegend halbwegs frisch zu halten.
Als der Schotte hierher gekommen war, war er einem Indianer begegnet, der ihm geraten hatte, in der Nähe des Creeks zu bleiben, da er wertvoll sei. Aber Barring vermochte nichts von diesem Wert zu entdecken.
Und in den darauffolgenden Jahren hatte John Barring den Roten noch einmal getroffen.
Der hatte weise gelächelt und erklärt: »Du hast keine Geduld, weißer Mann; es ist ein wertvoller goldener Creek, der Silver Creek…«
Well, für die Indianer mochte er wohl ein heiliger Creek sein, aber dem Rancher Barring brachte er nur wenig Nutzen. Und die Vermutung, der Rote habe vielleicht andeuten wollen, es sei Gold im Creek, bestätigte sich nach Barrings Prüfung nicht.
Die Jahre gingen dahin.
Sie waren beide mit fünfunddreißig gekommen, Barring und Elliot, und jetzt waren sie fast sechzig. Beide noch gesund und stark – aber Barring weit mehr verarbeitet und älter wirkend als der wohlhabende James Elliot.
Da schlug das Schicksal zu.
Zuerst bei Barring. Die Ranch brannte nieder.
Der Schotte baute sie mit einer Verbissenheit ohnegleichen wieder auf.
Dann wurde ihm Vieh gestohlen.
Er hatte keine Leute, es wieder einzutreiben. In Cowboytracht jagte seine Tochter über die Prärie, und es gelang ihr tatsächlich, versprengte Rinder, die den Rustlern nicht gefolgt waren, wieder zurückzutreiben.
Aber der Verlust war doch spürbar. Verzweifelt stand der Schotte auf dem Hof und starrte in die Weite der Savanne.
Weshalb war er so vom Unglück verfolgt?
»Nichts, gar nichts ist mir gelungen!« knurrte er vor sich hin.
Daß es ihm gelungen war, die schöne Frau zu erringen, um die sich der Nachbar vergebens bemüht hatte, das hatte der Schotte längst vergessen.
Da schlug das Schicksal bei den Elliots zu.
So furchtbar, daß selbst die Barrings den Atem anhielten.
Es war an einem glutheißen Julinachmittag in Dillon. Die fünf Elliot- Brothers waren in der Stadt. Sie hatten vier Pferde mit, und Martin, der jüngste, erst sechzehnjährige, lenkte den großen Wagen, auf den der Strohschneider geladen werden sollte, der an der Station abzuholen war.
Die Maschine war so leicht zu handhaben, daß nur ein Mann das Stroh in die Bahn zu schieben brauchte und ein zweiter das Rad betätigen mußte. Früher waren zum Strohschneiden wenigstens vier Mann nötig gewesen. Der Rancher hatte die Maschine im vergangenen Frühjahr auf seinem Ritt nach Kansas auf einer Ranch gesehen und sich gleich eine bestellt.
An diesem Julitag waren die fünf Elliot-Brüder aufgebrochen, um die Maschine mit vereinten Kräften von der Eisenbahnrampe auf den Wagen zu bringen.
Sie brauchten nie fremde Hilfskräfte, da sie ja Hände genug hatten, die Elliots.
Es war eine schwere Arbeit, aber die fünf kräftigen jungen Männer schafften sie in einer Stunde.
Die neue Strohschneidemaschine stand auf dem Wagen, wurde mit Stricken befestigt, so daß sie auf dem Weg von neun Meilen bis zur Ranch nicht verwackeln konnte, und Martin stieg wieder auf den Kutschbock.
Jonny, der älteste, ritt voran. Roger, der zweitälteste ritt ein Stück hinter ihm.
Dann kam der Wagen. Ted und Willie bildeten den Schluß.
Sie hatten die Mitte der Mainstreet erreicht, als Roger vor dem Montana Saloon sieben Pferde stehen sah.
»He, Jonny, die Hacatts sind da!« rief er dem Bruder zu.
»Na und? Laß sie. Was gehen sie uns an!«
Roger nahm die Zügelleine zurück und hielt seinen Fuchs an.
»Na, hör mal, neulich hast du aber ganz anders gesprochen.«
»Well, das war neulich. Jetzt haben wir keine Zeit.«
»Keine Zeit für einen Drink? Nach einer solchen Schufterei?«
»Du kannst ja einen Whisky trinken«, wich der älteste Bruder aus, »wir andern reiten inzwischen langsam weiter.«
»Ein schöner Unsinn ist das! Ich wette, daß Ted und Willie auch nichts gegen einen Drink einzuwenden haben.«
»Sicher nicht, wenn du sie erst darauf aufmerksam machst«, versetzte Jonny steif und blickte angestrengt nach vorn, um sich den Gedanken zu vertreiben, wie gut ein kühler Schluck in die heiße Kehle ihm täte.
Ganz sicher wäre auch er in den Saloon gegangen, wenn nicht ausgerechnet die Hacatts in der Stadt gewesen wären.
Ralph Hacatt hatte vor einem Jahr mit Roger Elliot Streit bekommen, und seit diesem Tag gab es immer wieder Reibereien zwischen den Söhnen der Hacatt Ranch, die im Norden der Stadt lag, und den Elliot Boys, die im Süden Dillons lebten.
Besonders war es Roger, der sich keine Gelegenheit entgehen ließ, die Hacatts anzugreifen. Er haßte sie einfach, die »Briten«, wie er sie nannte, die sich weiß der Teufel was auf die dürre Ranch ihres halbblinden Vaters einbildeten!
»Neulich hast du selbst gesagt: Man sollte es diesen Schuften stecken«, krächzte Roger ärgerlich.
»Stimmt«, gab Jonny kühl zurück, »weil Brian Hacatt das Maul wieder mal sehr voll genommen hatte. Aber das ist vergessen, und wir haben jetzt wichtigere Arbeit, als uns mit diesen Burschen herumzustreiten.«
Roger knurrte etwas vor sich hin, ließ den Wagen vorbei und rief Ted zu: »He, ich nehme einen Drink!«
Ted blickte Willie, seinen Zwillingsbruder an.
Der nickte.
»Weshalb nicht? Wir kommen mit.«
Die beiden Twins wandten die Köpfe und sahen jetzt erst die Pferde der Hacatt Ranch.
Ted hielt und zog die Stirn kraus.
»Was meint denn Jonny?« wollte er wissen.
»Der hat offenbar Angst«, hetzte Roger.
»Angst? Das kann doch nicht wahr sein! Er will höchstens seine Cents sparen.«
Willie stieg vom Pferd. Ted folgte ihm.
Roger brüllte hinter dem Wagen her: »Wartet, wir nehmen hier einen Drink.«
Da hielt auch Jonny sein Pferd an und blickte sich finster um.
Die drei anderen gingen schon auf die Schenke zu.
Jonny gab dem kleinen Martin einen Wink. »Halt an.«
Nacheinander betraten sie den Saloon.
Martin, der als letzter kam, hatte die Hacatt-Pferde erst bemerkt, als er schon an der Pendeltür war. Mit beklommenem Herzen folgte er den Brüdern.
Er war ein sonderbarer Mensch, der sechzehnjährige Bursche. Zwar arbeitete er genauso hart wie die Brüder auf der Ranch, aber er liebte dieses Leben nicht.
Seine Welt war Musik.
Der Vater hatte es bereits früh mit Sorge bemerkt.
Martin spielte schon mit sieben Jahren Gitarre so gut, daß Besucher der Ranch Mund und Augen vor Verwunderung aufsperrten. Dann, als er eines Tages das Pianoforte in der Montana-Bar entdeckte, versuchte er sich auch darauf, klimperte bald so melodiös darauf herum, daß die Gäste ihm Beifall klatschten.
Er war ein Naturtalent – das aber hier in diesem Land fehl am Platz war. Der etwas verträumte Bursche zog sich mehr und mehr in sich zurück, stahl sich immer wieder zu seiner Gitarre, zu der Flöte, die ihm der Vater aus St. Louis mitgebracht hatte, zu der Geige und all den anderen Instrumenten, deren er hatte habhaft werden können.
Immer lag nach Feierabend der Hauch irgendwelcher weicher Musiktöne über der Ranch. Aber eine Erfüllung, eine Zukunft gab es nicht für ihn.
An der Theke standen sechs Männer:
Hal, Ralph, Owen, Kid, Brian und Charlie Hacatt.
An einem der grünbezogenen Spieltische hockte der semmelblonde Mervil, ein leidenschaftlicher Pokerspieler. Ähnlich wie Martin Elliot war auch er ein Sonderling, der wenig mit seinen rauhen Brüdern gemein hatte.
Roger Elliot schob sich dicht neben Hal Hacatt an die Theke.
»Fünfmal goldbraun!« rief er dem mürrisch dreinblickenden Wirt zu, dessen Gesicht von scharfen Falten zerfurcht war und eine grünliche Färbung aufwies.
Er schenkte fünf Gläser zu einem Drittel voll und warf einen forschenden Blick zu den Hacatts hinüber.
Hal Hacatt blickte nicht zur Seite, als er sagte: »Hast du keine Milch da, Ferry?«
Der Salooner bekam plötzlich einen puterroten Schädel.
»Laß doch den Unsinn, Hal«, versetzte er brummig.
Hal Hacatt warf den Kopf hoch.
»Was heißt hier Unsinn, he? Ich werde dich verdammten Giftmischer doch noch fragen können, ob du Milch hast.«
Es war Roger Elliot, der glaubte, die Sache abkürzen zu müssen.
»Wenn du nämlich Milch hättest, Ferry, könntest du diesen Boys je ein Glas einschenken.«
Da fuhr Hal Hacatt herum.
»Was hast du gesagt, Dreckskerl?«
Roger schlug sofort zu. Er war stark und schnell.
Hal Hacatt lag von einem krachenden Rechtshänder schwer getroffen am Boden.
Sofort warf sich Owen Hacatt dem zweiten der Elliots entgegen, um diesen Schlag zu rächen.
Da stand plötzlich der Rancher Barring in der Tür; eine riesige, bärenstarke Gestalt.
»Aufhören!« brüllte er mit Donnerstimme.
Weil niemand auf ihn hörte, stürzte er sich in das Getümmel, bekam Charlie Hacatt zu packen, schleuderte ihn krachend gegen die Theke, faßte Ted Elliot, stieß ihn neben Charlie, wirbelte Willie zur Seite und brachte Mervil Hacatt, dessen Bruder Ralph, Kid und Jonny Elliot auseinander.
Da gab es Ruhe.
Keuchend standen und knieten die feindlichen Gruppen da. Barring verharrte wie ein Fels im Meer zwischen ihnen.
»Schämt ihr euch nicht, ihr Strolche!« knurrte er.
»Cowboys wollt ihr sein? Wißt ihr, was ihr seid? Feldmäuse! Unreife Kerle. Nichts weiter. Blamiert nur die Stadt und das County!«
»Lassen Sie uns zufrieden!« fauchte Roger von der Stirnkante der Theke her.
»Halt den Rand, Rog!« mahnte ihn sein Bruder Jonny. »Mister Barring hat recht. Stimmt’s, Hal?«
Der älteste Elliot hatte sich an den ältesten Hacatt gewandt.
Und der nickte dumpf.
»Natürlich hat der Rancher recht. Wir sind Idioten!«
Hal schlenderte zur Theke.
»Glotz mich nicht so dämlich an, Ferry. Schenk ein!«
Barring rief dem Wirt dröhnend zu: »Zwölf Gläser, alte Schlafmütze. Für fünf Elliots, sechs Hacatts und einen alten Mann!«
Es sah ganz nach Frieden aus.
Und das war der Erfolg des klugen, vernünftigen Mannes aus dem fernen Schottland.
Sie nahmen zwar mit verbissenen Mienen den Drink hoch, aber sie kippten ihn dennoch. Die Gefahr schien vorüber zu sein.
Aber sie hatte erst begonnen.
Barring, der arme Mann, der Mühe hatte, seinen Hof aufrechtzuerhalten, warf die zwölf Drinks für die »Boys«, die sich nicht benehmen konnten.
Als er bezahlt hatte und gegangen war, meinte Jonny Elliot: »Wir hätten das nicht von ihm annehmen dürfen.«
Hal Hacatt, der nur drei Zoll von ihm getrennt an der Theke lehnte und sein anschwellendes Auge mit einem nassen Halstuch kühlte, brummte: »Nein, hätten wir nicht.«
Damit schien der Friede ernsthaft besiegelt zu sein.
Aber der Satan hatte es anders beschlossen und gab dem unseligen Roger Elliot die Worte ein: »Ihr seid zu sechs Leuten. Für euch Geizhälse hat er ja das meiste ausgegeben!«
Da wichen die Hacatts zurück und stellten sich von der Theke ab in den Gang hinein wie eine Wand.
Die Elliots formierten sich augenblicklich vor ihnen.
»Verdammte Bande!« krächzte Charlie Hacatt.
»Ausrotten müßte man so was«, fügte sein Bruder Ralph hinzu und winkelte seinen rechten Arm gefährlich an. Dicht hing seine Hand über dem Revolverkolben.
Der junge Martin Elliot dachte: Welch ein Irrsinn! Gleich wird einer den Colt ziehen, und dann schießen wir einander nieder. Ich werde vielleicht Mervil treffen, der so wenig Lust zu dieser Sache hat wie ich. Oder vielleicht treffe ich Kid, der mir nie etwas getan hat, oder den dicken Owen. Furchtbar wäre es, wenn ich Hal träfe – er ist der Stolz seines Vaters und eigentlich ein ganz vernünftiger Bursche…
Da stieß Roger heiser durch die Zähne: »Das werden wir uns von diesen Hungerleidern nicht bieten lassen. Wir gehen auf die Straße!«
Sie gingen auf die Straße.
Sie standen sich gegenüber und blickten einander in die Augen wie Raubtiere. Der Starrsinn beherrschte beide Parteien.
Martin Elliot dachte verzweifelt an seine Mutter.
Wenn er doch jetzt daheim säße, hinten im Stall auf der Futterkiste, mit seiner Gitarre. Manchmal hatte die Mutter vor ihm auf einem Schemel gesessen und ihm zugehört.
Jonny Elliot blickte in die Augen Hal Hacatts. Und beide hatten Angst.
Angst wie Ted und Willie Elliot. Wie Owen, Charlie, Ralph, Kid, Brian und Mervil Hacatt.
Wie war es mit Roger? Hatte er etwa keine Angst?
Doch, aber niemand hätte sie ihm anmerken können, und er gab sie nicht einmal sich selbst zu.
Und keiner fand ein rettendes Wort.
»Wir werden es ausschießen!« stieß Roger durch die Zähne. »Von solchem Rattenpack lassen wir Elliots uns nicht beleidigen!«
In diesem Augenblick trat John Barring aus dem Generalstore, wo er Nägel für seinen Corral und die Stalltür gekauft hatte.
Mit einem Blick überschaute er die Situation.
Rogers Ruf: »Zieht!« mischte sich in den Schrei des Ranchers: »Halt, Boys, halt, das ist doch Wahn…!«
Da knatterten schon die Schüsse über die Mainstreet von Dillon.
Charlie Hacatt fiel zuerst.
Dann sein Bruder Ralph.
Der kleine Martin Elliot hatte den Colt zwar auch in der Faust, aber er vermochte nicht abzudrücken. Er starrte in Mervils Augen, in denen er es plötzlich feucht schimmern sah.
Neben Martin sackte Willie in sich zusammen.
Auch Ted Elliot stürzte nieder.
Dann sah Martin, ohne den Kopf zu bewegen, daß Jonny in die Knie brach.
Es war eine grauenhafte Minute.
Starr vor Entsetzen hatten die Menschen auf den Stepwalks gestanden.
Und nur ein Mann, der Rancher Barring, stürzte auf die Straße, riß den Colt hoch, schlug Owen Hacatt damit nieder, stürzte sich auf Roger und fegte ihn von den Beinen.
Da drückte Mervil Hacatt ab. Vielleicht wollte er es gar nicht. Seine Kugel traf den kleinen Martin Elliot genau in die Herzspitze.
Entgeistert stand der Schotte vor Martin und sah ihn mit wachsbleichem Gesicht umsinken.
Barring wirbelte herum, holte gleichzeitig mit der Linken aus und warf Mervil mit einer gewaltigen Ohrfeige von den Beinen.
Brian, der Willie Elliot niedergeschossen hatte, stand noch mit rauchendem Colt neben dem stürzenden Mervil, als ihn der Revolverlauf des Ranchers traf.
Dann war der Schotte vor Hal. Der stierte ihm in die Augen. Und auf einmal warf Hal dem Rancher seinen Colt vor die Füße.
Barring bebte am ganzen Leib.
»Das war dein Glück, Junge! Dich hätte ich nämlich nicht geschlagen.«
Hals Stimme zitterte, als er zurückgab: »Sie wollen… mir doch nicht die Schuld geben, Mister Barring?«
»Doch, Hal, dir, dir und Jonny El…« Er brach jäh ab und sah den ältesten Elliot-Bruder am Boden liegen.
Tot.
Tot wie Martin.
Barring beugte sich über Willie, der auf dem Gesicht lag.
Auch er war tot.
Entsetzten schüttelte den Rancher, als er sich nach Ted umwandte.
Ted lebte noch. Aber die Kugel steckte in seiner linken Brust.
Da hob ihn der Schotte auf und schleppte ihn über die Straße in das Haus des Arztes.
Der greise Doc Williams stand mit bleichem Gesicht in der Tür und stotterte: »Das… war doch… Wahnsinn! Ich verstehe das alles nicht…«
»Kommen Sie, Doc! Er wäre der vierte Elliot. Vielleicht können Sie ihn dem Tod von der Schaufel reißen.«
Auch die Hacatts hatten einen Toten im Gunfight gelassen: den grünäugigen Charlie.
Ihren besten Schützen.
Hal hatte eine blutende linke Wange.
Owen kauerte noch am Boden, so schwer hatte ihn Barrings Revolverlauf getroffen. Noch ahnte er nicht, daß ihm dieser Hieb vielleicht das Leben gerettet hatte.
Brian war an der Hüfte leicht verletzt, und Kid hatte einen bösen Streifschuß am linken Arm.
Sie hatten die Revolver früher oben gehabt, die Hacatts. Nur diesem Umstand verdankten sie den Ausgang, dieses fürchterlichen Gunfights.
Vier Tote auf der Mainstreet von Dillon!
Und drüben bei Doc Williams rang Ted Elliot noch mit dem Tod.
Barrings Hut war in den Staub gefallen.
Brian, dem der Schädel noch schmerzte, bückte sich und hob ihn auf.
Der Rancher beachtete es gar nicht. Er stierte aus leeren Augen auf den toten Elliot.
Da lag er nun, der kräftige Bursche, der erste Sohn seines einstigen Freundes, den er dem Rancher Elliot so geneidet hatte.
Roger kniete neben dem toten Bruder und wagte nicht, den Blick zu Willie und dem kleinen Martin zu wenden.
Mervil Hacatt hatte sich auf den Knien hochgerichtet, als ihn der Blick seines ältesten Bruders Hal traf.
Ein Blick voller Vorwurf.
Da sank Mervils Kopf auf die Brust nieder. Plötzlich ging ein Zucken durch seinen Körper. Schluchzend stieß er hervor: »Ich habe ihn doch gar nicht töten wollen! Ich… Es war ein Unglück! Ich schwöre es! Ich hatte Angst. Und ich weiß gar nicht, weshalb ich abgedrückt habe! Er sah so traurig aus… und hätte nie geschossen! Ich… weiß es…« Er schluchzte so herzzerreißend, daß es den Menschen auf der Straße ins Mark drang.
Barring nickte.
»So muß es kommen. Weinen müßt ihr, alle, alle!«
Er kniete neben Jonny Elliot nieder, hob ihn auf, stieß Roger rauh beiseite und schleppte den Toten zu seinem Wagen.
Roger sah, wie der Rancher den Wagen wendete und langsam aus der Stadt fuhr.
Da taumelte Roger zu den Pferden hinüber, sah die fünf Tiere dastehen, machte betroffen kehrt, kam auf die Straße zurück, blieb neben dem toten Willie stehen – und vermochte doch nicht den Blick auf Martins Körper zu werfen.
Seine Hände zitterten, als er Willies Tabakdose im Straßenstaub liegen sah, als er sie aufhob und sinnlos öffnete, um sie wieder zu schließen.
»Nein! Das muß doch ein böser Traum sein! Sie können doch nicht alle tot sein!« stammelte er tonlos. »Jonny, Willie, Martin! Und vielleicht auch Ted!«
Und da lag Charlie mit wächsernem Gesicht vor seinen verletzten und völlig verstörten Brüdern.
Da kam ein brünettes Mädchen auf die Straße und blieb vor dem toten Willie Elliot stehen.
Roger stand neben ihr.
»Ruth, es… ist doch nicht wahr«, stotterte der Cowboy. »Sie können doch nicht alle tot sein.… Was… soll ich denn meinem Vater sagen, wenn er mich fragt, wo Jonny ist… und Martin. Und Ted… und…«
Er war ein Bild des Jammers, der Cowboy Roger Elliot, der noch vor Minuten wie ein Rachegott auf der Straße gestanden hatte, voller Trotz, voller Starrsinn und Übermut. Er schien völlig gebrochen zu sein.
Das hatte er doch nicht gewollt. Natürlich nicht!
Aber was hatte er gewollt?
Er wußte es selber nicht. Jetzt nicht mehr. Jetzt, wo Jonny tot war und er und die anderen nicht mehr mit ihm reiten konnten.
Er stürmte auf das Arzthaus zu.
Die Frau des Doktors hielt ihn im Flur auf.
»Warten Sie, Roger, Sie können jetzt nicht hinein.«
Er mußte warten. Erst nach einer Viertelstunde kam der Arzt aus einem der Zimmer.
Roger blickte ihn aus weit offenen Augen entgegen.
»Wie steht es mit Ted, Doc? Bitte, sagen Sie es mir, weil ich… es ja wissen muß. Wegen dem Vater. Weil ich ihm…« Er brach ab und wandte sich um.
Hinter ihm stand Ruth. Willies Freundin.
Er ging an dem Mädchen vorbei auf die Straße und blieb vor Hal Hacatt stehen.
Der hatte ein Gesicht wie Felsstein.
»Was ist mit… Ted?« brach es brüchig über Hals Lippen.
Roger schüttelte den Kopf.
»Ich weiß es nicht. Der Arzt sagt es mir nicht.«
»Wenn er auch tot ist«, preßte Owen durch die Zähne, »dann brauchen wir nicht mehr nach Hause zu gehen. Charlie und vier Elliots! Unser Vater schlägt uns tot.«
Sie dachten alle das gleiche. Da sog Hal die Luft tief ein und wischte sich das Blut vom Gesicht. Er bückte sich nach seinem toten Bruder Charlie.
Brian wollte helfen, aber er taumelte an Ralph vorbei.
Da bückte sich Roger und half Hal und Kid, den toten Charlie auf den Gehsteig zu schleppen, wo sie ihn im Schatten niederlegten.
Zwei Männer kamen auf die Straße und trugen Willie weg.
Nur der kleine Martin lag noch da. Mervil Hacatt stand vor ihm und starrte ihn an.
Als ihn zwei ältere Männer zur Seite schoben, um den toten Burschen aufzuheben, schleuderte Mervil seinen Revolver unter einen Vorbau und riß sich den Waffengurt vom Leib. Langsam ging er hinüber zu seinem Pferd.
Der Cowboy zog sich in den Sattel und ritt nach Südosten aus der Stadt.
Niemand hat den drittjüngsten Sohn des Ranchers Hacatt jemals wieder im County gesehen. Wie ein reitender Ahasver zog er durch den Westen, Tag und Nacht verfolgt von dem Bild, das er selbst geschaffen hatte, das Bild des zusammenbrechenden kleinen blonden Cowboys Martin Elliot.
Es gab keinen Sheriff, der Mervil Hacatt verfolgte, denn es war ja alles nach dem Gesetz gegangen. Es war ein Gunfight gewesen. Ein Duell, das nicht verboten war.
Und daß die Elliots langsamer gezogen hatten, war ihr Pech.
*
Roger hatte Willie und Martin auf den Wagen neben die Strohschneidemaschine gelegt.
Ruth half ihm die Pferde der Brüder auf den Wagen zu koppeln.
Dann ging er mit gesenktem Kopf und bleischweren Beinen hinüber auf den Saloon zu.
Ferry Cardrup, der Wirt, stand vor seiner Tür.
»Die Drinks, die ersten fünf, muß ich bezahlen«, krächzte Roger.
Cardrup schüttelte den Kopf und entgegnete.
»Nein, Sie haben bezahlt, Roger Elliot. Genug bezahlt…«
Der Cowboy blickte in das zerfurchte Gesicht des Keepers und wandte sich ab.
Ruth stand neben dem Wagen.
»Kommst du… mal wieder?« fragte sie leise. »Ich meine, wenn es dir schlechtgeht…« Sie wollte mit ihm über Willie sprechen, den sie geliebt hatte und der ihr versprochen hatte, sie zu heiraten.
Roger gab keine Antwort. Ihre Worte gingen an ihm vorbei wie der Wind, der jetzt aufkam und glühendheiß durch sein schmerzendes Gesicht strich.
Als er den Ranchhof erreichte, war Barring, der langsamer gefahren war, gerade angekommen.
Frau Mary hatte den Nachbar sofort erkannt und stürzte von einer düsteren Ahnung getroffen, hinaus.
Sie brauchte den Vorbau gar nicht zu verlassen. Ein heiserer Schrei brach von ihren Lippen: »James!«
Der Rancher kam aus dem Stall. Groß, gutaussehend, elegant gekleidet.
Er sah seine Frau wachsbleich an einem Terrassenpfeiler lehnen.
Und auf dem Kutschbock des fremden Wagens erblickte er John Barring!
Er kam heran, und als er auf den Wagen sehen konnte, stockte sein Fuß.
Neben der Nagelkiste lag sein ältester Sohn Jonny! Mit verzerrtem Gesicht. Tot!
Für den Viehzüchter brach eine Welt zusammen.
Er wischte sich durchs Gesicht und nahm den breiten Melbahut vom Kopf.
Barring schien es gar nicht zu bemerken.
»Das… das muß doch ein Irrtum sein.«
Jetzt hob er den Kopf.
»John…, du bringst meinen Jungen?« Es war keine Frage.
Barring stieg vom Kutschbock.
»Ja, James. Einen von ihnen.«
Da folgte der Rancher dem Blick des einstigen Freundes und sah den Ranchwagen. Roger hockte mit gesenktem Kopf auf dem Kutschbock.
James Elliot schluckte schwer und drehte sich hart um.
»John…, ist noch einer von ihnen…«
»Noch zwei, James.«
»Martin?« entfuhr es dem Viehzüchter. Er hauchte den Namen nur, damit ihn die Frau oben auf der Veranda nicht hören sollte.
Aber die Mutter hatte den strohblonden Schopf ihres Lieblingssohnes schon gesehen und sank lautlos in sich zusammen.
Barring eilte ihr zu Hilfe und schleppte sie auf die grüngestrichene Bank an der Hauswand, die warm von der Sonne war.
Mitten im Hof stand der Rancher. Taub vor Schmerz. Nichts begreifend.
Drüben beim Tor hielt der Wagen.
Und Roger stieg nicht ab.
Barring kam in den Hof zurück, zog einen Eimer Wasser hoch und wollte damit zu der Frau auf den Vorbau gehen.
Da streckte James Elliot den linken Arm vor und stammelte: »Sie sind doch nicht etwa alle… tot?«
Barring schüttelte den Kopf.
»Roger ist ja da.«
»Und Willie?«
»Liegt auf dem Wagen: er ist leider tot.«
»Und Ted… Mein…« Plötzlich schrie er, daß es über den ganzen Hof gellte: »Nein! Nein!«
Barring sagte rauh: »Ted liegt noch beim Arzt. Aber es steht nicht gut um ihn.«
Dann ging er weiter und stellte den Eimer neben die Frau.
Die schwarze Köchin war auf zitternden Beinen neben ihre Herrin getreten.
»Was gaffen Sie denn?« herrschte Barring, dem die Fassung jetzt auch zu schwinden drohte, sie an. »Nehmen Sie ihr das Halstuch ab und tränken Sie es im kühlen Wasser. Auf die Stirn und die Schläfen, den Hals und in den Nacken.«
Während er es sagte, blickte er bereits voller Mitleid auf den einstigen Freund, der plötzlich ein alter Mann geworden zu sein schien. Der Schotte vermochte zu ermessen, was der Mann da verloren hatte.
»Roger!« Der Schrei des Vaters brach sich an den Wänden der Scheunen und Strohhäuser.
Der Cowboy rührte sich jedoch nicht.
»Roger, komm her!«
Da erst stieg der Bursche vom Wagen und kam langsam und mit gesenktem Kopf näher. Fünf Yard vor dem Vater blieb er stehen.
Der blickte ihn nicht an.
»Was hast du mir zu sagen?«
»Es war meine Schuld, alles…«, stammelte der Bursche leichenblaß.
»Wer hat Jonny getötet und Martin? Und Willie…?«
»Charlie ist auch tot. Und die anderen sind verwundet.«
»Wer ist Charlie? Welche anderen meinst du?«
»Die Hacatts.«
Da wandte sich James Elliot ab.
»Mein Pferd!«
»Vater, es ist doch… ein Gunfight gewesen. Da kannst du gar nichts machen.«
»Mein Pferd, habe ich gesagt!« beharrte der Rancher.
»Aber, Vater, ich bitte dich! Wir haben alle gleichzeitig geschossen. Charlie Hacatt ist ja auch tot.«
Da wandte sich der Rancher zum Corral hinüber und holte das Pferd des Vaters.
Der Rancher wartete mitten im Hof.
Seine Frau war inzwischen zu sich gekommen und starrte mit kreidebleichem Gesicht auf ihren Mann.
»James, bitte, bleib hier!«
Roger brachte das Pferd.
»Vater…«
»Halt den Mund.«
Elliot zog sich in den Sattel und riß die Zügelleinen hoch.
»James!« John Barring hatte es gesagt.
Und ein hartes metallisches Klicken folgte seinem Wort.
Elliot hielt an und drehte sich um. Er starrte in die Mündung eines Revolvers.
»Was soll das, John?« stieß er düster hervor.
»Steig ab!« Barring hatte es sehr ruhig gesagt.
Da stieg der Rancher vom Pferd und ging auf den Schotten zu.
»John!«
»Du mußt hierbleiben, James. Es reicht, wenn drei oder gar vier Elliots tot sind. Die Ranch braucht dich.«
Das sagte er, der seit einem Vierteljahrhundert kein gutes Wort mehr von dem Nachbarn gehört hatte.
Elliot brauste auf: »Was willst du überhaupt hier? Was geht dich das alles an? Du mußt dich doch freuen! Hast du mich doch endlich geschlagen. Vier meiner Söhne tot!«
John Barring maß den Rivalen mit einem verächtlichen Blick, stieg auf den Bock seines Wagens und fuhr aus dem Hof.
Roger Elliot fand auch jetzt kein Wort. Keine Erklärung, mit der er wenigstens dem Vater hätte von der Tat des Schotten berichten können, daß es noch schlimmer, viel schlimmer ohne John Barring geworden wäre. Denn er selbst lebte ja! Und er hatte den Revolver gerade auf Hal Hacatt gerichtet gehabt, um ihn, der in dieser Sekunde gar nicht auf ihn achtete, niederzuschießen.
Aber was lag dem niedergeschmetterten Vater jetzt an Hal Hacatt?
Er hätte in dieser Stunde nicht begriffen, was der Schotte getan hatte, wie er sich eingesetzt hatte, um die Boys von ihrem verblendeten Vorhaben abzubringen.
Er hat mir den toten Sohn gebracht, meinen Jonny, um den er mich seit mehr als vierundzwanzig Jahren beneidete! Jetzt bin ich arm. Arm fast wie er.
Roger – ja, Roger lebte. Aber das war eben auch nur ein Trost.
Als Barrings Wagengeräusch vom Hof nicht mehr zu vernehmen war, zog sich der Rancher müde in den Sattel.
Da stand oben auf der Veranda seine Frau auf.
»James.«
Es war kein Ruf, kein Schrei…, nur die Bitte einer gequälten Mutter.
Der Mann blickte sich um.
»James, bleib hier.«
»Ich… ich muß zum Sheriff.«
»Nein.«
»Ich muß, Mary. Es ist meine Pflicht. Vielleicht war es Mord und…«
»Es war kein Mord«, krächzte Roger.
»Mord nicht!« fuhr ihn da der Rancher grimmig an, »aber Wahnsinn war es. Blutiger, tödlicher Wahnsinn. Und es sollte mich wirklich wundern, wenn du nicht ein Teil Schuld an diesem Unglück trägst.«
Da brach es zerknirscht aus dem Burschen hervor: »Doch, Vater, ein Großteil – wenn nicht die ganze Schuld.«
Fassungslos blickte ihn der Rancher an.
»Sprich, sprich doch endlich! Ich muß es doch wissen!«
»Ich habe die andern verleitet, in den Montana Saloon zu gehen. Jonny wollte nicht. Er ritt sogar weiter, und Martin folgte ihm mit dem Wagen.«
»Und die Zwillinge?«
»Sie hatten nichts gegen einen Drink.«
»Kann ich mir denken. Aber die Hacatts waren da. Und du wußtest es.«
»Ja, ich habe es genau bemerkt, daß Willie stockte, als er die Pferde sah. Und Ted blieb sogar stehen.«
»Aber sie wollten keine Angst haben, stimmt’s? Die unseligen Boys wollten nicht hinter dir zurückstehen.«
»Ja, so war es, Vater, genauso.«
Und nun berichtete der Cowboy dem Vater alles, was er noch wußte. Die Schuld, die er sich dabei in übertriebener Art zumaß, war größer als in Wirklichkeit. Sie war schon groß – und sie lag doch nicht einzig bei ihm. Die anderen Brüder und auch die sieben Hacatts hatten ihren freien Willen und hätten nicht zu kämpfen brauchen, wenn sie besserer Einsicht gewesen wären.
Aber Roger Elliot hatte doch den gefährlichen Anstoß gegeben, sogar zweimal in zwei entscheidenden Minuten. Daran gab es nichts zu rütteln.
Stumm und mit gesenktem Kopf stand er vor dem Vater, in der Erwartung mit dröhnender Donnerstimme für alle Zeiten vom Hof verwiesen zu werden.
Aber es geschah etwas Sonderbares, etwas, das der junge Mann nie und nimmer erwartet hätte.
Der Alte taumelte benommen zum nahen Brunnen, ließ sich auf dessen holzgefaßten Rand nieder, und sein Kopf sank auf die Brust. Ein konvulsivisches Zucken lief durch seinen Körper.
Weinte der Vater?
Das nicht! Nein, nur das nicht! Das wäre fürchterlich!
Aber James Elliot stand wieder auf und kam auf den völlig niedergeschlagenen Burschen zu.
»Roger«, brach es heiser hervor, »wir werden jetzt sehr stark sein müssen, um dies alles zu vergessen. Weil wir arbeiten müssen, für alle die mit, die es nicht mehr können.«
Wieder stieg er auf sein Pferd.
Roger spannte die anderen Tiere hinten vom Wagen und führte sie in den Corral.
Dann nahm er seinen Fuchs und folgte dem Vater.
Wortlos ritten sie hintereinander über die schmale alte Overlandstraße nach Dillon.
Die Stadt war noch erschüttert von den Schüssen, die um die Mittagsstunde durch die Mainstreet gehallt waren.
Drüben vorm Sheriffs Office stand der Buggy des halbblinden Ranchers Hacatt.
Und daneben die sieben Pferde seiner Söhne. Eines trug keinen Sattel mehr.
Die Hacatt Brothers standen auf dem Vorbau.
Hal machte ein paar verzweifelte Schritte auf die Straße und starrte den alten Elliot schluckend an.
Da öffnete sich oben die Tür des Sheriffs Bureau, und der alte Hacatt kam mit dem Sheriff heraus.
Owen stieß den Vater leicht an.
»Mister Elliot ist da, Vater«, preßte er durch die Zähne.
»Du wagst mich auch noch anzureden!« schrie der hünenhafte Mann seinen Sohn an. »Du, der einzige, von dem ich außer Hal und Mervil Vernunft erwartet hätte? Was stehst du hier herum? Weshalb lungert ihr überhaupt hier auf dem Vorbau? Was wollt ihr, ihr Strolche? Verschwindet! Vorwärts!«
Kid, Brian und Ralph gingen zu ihren Pferden. Hal und Owen blieben.
Hal sah den Vater an.
»Vater, da steht Mister Elliot.«
»Ich habe ihn gesehen. Sei unbesorgt, so gut sind meine Augen noch. Und du bist es, Halman, der mich zu diesem schwersten Weg meines Lebens gezwungen hat. Du warst für deine Brüder verantwortlich. Hast du mir nicht kürzlich gesagt, Jonny Elliot sei eigentlich gar kein so übler Bursche, und Willie und Ted, und der kleine Roger auch?«
»Ja, Vater, das habe ich gesagt. Und ich weiß auch nicht, wie das alles passiert…«
Da stieß ihn der Alte an.
»Verschwinde, du elender Bandit! Aus meinen Augen! Und den da, deinen Bruder Owen, den nimmst du mit. Er, der die Bibel immer liest, sie immer in seiner Satteltasche trägt. Oder hattest du sie heute nicht bei dir, Owen?«
»Doch, Vater«, preßte der Cowboy durch die Zähne.
»Du hattest sie also bei dir und trotzdem auf deine Mitmenschen geschossen! Weil du klüger bist als deine Brüder, hättest du diesen Irrsinn verhindern müssen. Merkt es euch: nie, nie wieder will ich euch sehen!«
Da machte Owen Hacatt vier Schritte an dem Vater vorbei und blieb vor dem Rancher Elliot stehen.
»Mister Elliot, wenn Sie einen Cowboy brauchen, der für den halben Lohn arbeitet, dann bitte ich Sie, an mich zu denken.«
Elliot starrte ihn fassungslos an.
Da folgte Hal dem Bruder.
»Und an mich auch, Mister Elliot. Sie haben gehört, daß wir keinen Vater, keine Ranch, keinen Job und kein Dach mehr über dem Kopf haben…«
»Was ihr selbst verschuldet habt!« rief der Vater ihnen nach.
Stumm standen die beiden Cowboys da.
Elliot wandte sich ab und ging auf das Arzthaus zu.
»James!« rief ihm der alte Hacatt nach.
Elliot blieb stehen.
Der Halbblinde erreichte ihn und ergriff ihn am Arm. Langsam zog er ihn herum, und die Menschen sahen, daß seine Lippen bebten.
»James Elliot! Hören Sie mich an. Ein alter, vernichteter Mann muß zu Ihnen sprechen. Ich… ich…« Seine braunen, verarbeiteten Hände, die an den Armseiten Elliots lagen, fielen plötzlich herunter. Mit der Linken griff er nach dem Herzen und wankte zurück.
Blitzschnell fing Elliot ihn auf.
»Hal!« rief er dem Davongehenden nach.
Der wandte sich um. »Owen, schnell, es ist etwas mit Vater!«
Sie rannten zurück und trugen gemeinsam mit dem Vater all jener Jungen, die sie getötet hatten, ihren Vater zum Arzthaus.
Doc Williams kam auf den Vorbau gerannt, mit einem Fläschchen in der Hand. Er öffnete das verblichene blaue Hemd des Ranchers Hacatt und massierte etwas von der Flüssigkeit auf seine linke Brustseite.
Hacatt kam erst nach Minuten zu sich.
Er sah das Gesicht des Doktors über sich, daneben das versteinerte Gesicht jenes Mannes, dem die Hacatts so unendliches Leid zugefügt hatten. Und hinter dessen Schultern erkannte er die Gesichter von Hal und Owen.
Da richtete er sich mit einem Ruck auf.
»Hal, was habe ich befohlen! Owen, du elender Strolch! Was habe ich befohlen!«
»Mister Hacatt«, versuchte ihn der Arzt zu beruhigen.
»Sie dürfen sich nicht so aufregen, Ihr Herz…«
»Hal«, keuchte der Rancher, »verschwinde! Und nimm den Bibelbruder mit! Vielleicht kann er für euch mit all seiner Klugheit irgendwo etwas ausrichten. Und wenn ihr Mervil findet, so sagt ihn, daß ich auch ihn nie wieder auf der Ranch sehen will.«
Schweigend stand James Elliot dabei.
Hacatts Augen streiften sein Gesicht.
»James, ich wollte… Sie… um Verzeihung bitten. Aber das wäre ein Hohn! Verzeihung für vier tote Söhne?«
Elliot zuckte zusammen, als habe ihn ein Brandeisen über dem Herzen berührt.
Vier! So war Ted also auch gestorben? Der vierte Junge!
Doc Williams sah das totenblasse Gesicht des Viehzüchters.
»Nein, bis jetzt sind es drei, und das ist furchtbar genug. Ich habe seit einer halben Stunde Hoffnung, daß wir Theodore durchbringen können. Gesund, richtig gesund allerdings wird er nie wieder werden. Er wird ein Krüppel sein.«
Der Rancher schluckte.
Das war ein Schlag, aber lieber brachte er der schmerzverstörten Frau draußen auf der Ranch einen Krüppel zurück als einen vierten Toten.
Er konnte Ted aber nicht mitnehmen.
Mit kalkigem Gesicht lag der Bursche auf seinem Lager in einem verdunkelten Zimmer.
Der Rancher stand am Fußende seines Bettes. Hinter ihm der Arzt.
Rancher Hacatt war den beiden gefolgt.
Da schlug Ted die Augen auf.
»Vater… ich sehe dich… Wo ist Willie?«
Immer war seine erste Frage nach Willie gewesen. Damals, als er von dem Vater aus dem Red Rock gezogen worden war – als er einmal im Schnee versunken war – als er von dem Mustang gestürzt war – und als er bei einer Keilerei ein Stuhlbein an den Kopf bekommen hatte.
Der Arzt nickte.
»Alles ist gut.«
»Nein… Vater soll es sagen, Doc! Sonst… ist es nicht gut«, stammelte der Schwerverletzte.
James Elliot sog die Luft tief ein und erklärte mit brüchiger Stimme: »Nein, Teddy, es ist nicht gut. Willie ist tot.«
»W… Willie…?« Ted schloß die Augen.
Doc Williams nahm die beiden Rancher an den Armen
»Wir müssen ihn ruhen lassen. Noch ist er keineswegs über die Krise hinweg. Die Kugel steckte dicht beim Herzen. Es war meine schwerste Operation.«
Da tauchten Hal und Owen hinter Eliot auf.
Ted, der die Augen aufschlug, sah nur Hal.
»Hal…, du lebst! Ich hatte auf… Owen gezo… auf Owen…« Er brach jäh ab, weil er Owens rundlichen Schädel jetzt auch erkannt hatte.
»Owen!« Hektische Flecken brannten auf seinen Wangen. »Owen, ich habe dich nicht getroffen?«
Owen schluckte. »Doch, Ted, aber es ist nicht schlimm; ich bin im letzten Moment ausgewichen.«
Da fuhr der alte Hacatt herum und blickte seine Söhne an.
»Was wollt ihr hier?« keuchte er leise. »Ich habe gesagt, ihr sollt verschwinden! Sofort!«
Da trotteten die Cowboys hinaus.
Elliot blickte auf seinen Sohn, der die Augen jetzt wieder geschlossen hatte.
»Ich hole dich, Ted, wenn es dir bessergeht. Ich muß jetzt heim, um deiner Mutter zu sagen, daß du lebst.«
Roger stand draußen im Flur.
Sein Vater hatte ihn nicht verjagt, wie es der alte Hacatt mit Hal und Owen getan hatte.
Er durfte bleiben, und diese beiden Jungen waren vom eigenen Vater der Ranch und des Countys verwiesen worden.
»Hal…«
Halman Hacatt blieb sehen.
Roger krächzte: »Wenn ihr keine Arbeit findet, dann kommt zu uns.«
Owen, der auch stehengeblieben war, schüttelte den Kopf.
»Wir haben deinen Vater ja gefragt, Roger; er will uns nicht. Und niemand kann es ihm verdenken.«
»Er hat nicht gesagt, daß er euch nicht will, Owen.«
»Wir können nicht hierbleiben«, sagte Hal rauh. »Komm, Owen.«
Sie gingen hinaus.
Roger sah ihre breiten wuchtigen Gestalten als schwarze Konturen auf dem Vorbau gegen das gleißende Gesicht der Straße.
Bald darauf hörte er den Hufschlag ihrer Pferde.
»Auch das habe ich verschuldet. Alles kommt auf mein Gewissen!« flüsterte der Cowboy Roger Elliot vor sich hin.
Als der alte Elliot aus dem Arzthaus kam, war Roger verschwunden.
Er hatte die Stadt nach Südosten hin verlassen.
Erst spät in der Nacht kehrte er heim, holte sich zwei frische Hemden und ritt wieder weg.
Wochenlang sah man ihn nicht mehr.
Auf der Elliot Ranch arbeiteten längst andere Männer; vier Cowboys und drei Stalljungen. James Elliot hatte keine Söhne mehr, die für ihn reiten konnten.
Im Lehnstuhl drüben im Schatten des Wagendaches saß der Krüppel, dessen Leben zerstört worden war, ehe es recht begonnen hatte, der Erbe dieser großen Ranch, Theodore Elliot.
Niemand auf dem Hof fragte nach Roger.
Er hatte die Ranch verlassen, obwohl er doch nicht dazu aufgefordert worden war.
Er ritt gerade an jenem Vormittag über die Hügelkuppe und blickte in die kleine Senke hinunter auf die wenigen Rinder, die dem Schotten John Barring gehörten.
War der nicht eigentlich an allem schuld, dieser verdammte Schotte? blitzte es durch den Schädel des Cowboys. Hatte nicht der Haß der Elliots seit eh und je nur ihm gegolten? War man nicht nur deshalb an die Hacatts geraten, weil man diesem hölzernen Schotten aus dem Weg gehen wollte und deshalb immer den Umweg an der Hacatt-Weide vorbei genommen hatte?
Und bei dem Gunfight, an jenem schwarzen Tag oben in der Stadt, war Barring ja auch plötzlich aufgetaucht und hatte sich eingemischt!
War es vielleicht ein Zufall, daß drei Elliots tot waren, ein vierter ein Krüppel – und nur einer der sieben Hacatts gefallen war?
Hatte der Alte da nicht vielleicht eine Hand im Spiel gehabt?
Je länger der Cowboy darüber nachgrübelte, desto wahrscheinlicher erschien ihm seine absurde Vermutung.
Barring hat meine Brüder sterben lassen und war noch kaltherzig genug, den toten Jonny mit seinem Wagen heimzubringen, um den Vater zu kränken!
Daß dem Schotten das Ungück in seiner ganzen Schwere schon aufgegangen war, ehe es einer der Beteiligten voll begriffen hatte, und daß er Jonny, den Erben der Ranch, aus namenlosem Mitleid heimgeführt hatte zu dem Vater, das hätte der ungebärdige und charakterschwache Bursche niemals für möglich gehalten.
Er hat meine Brüder sterben lassen! Dieser knorrige, kaltstirnige Mensch! Dafür werde ich mich an ihm rächen…
Rogers Racheplan war schnell gefaßt: Er würde dem Schotten das Wasser abgraben. Wenn der Creek trocken lag, waren Barrings Rinder, die am Ostufer weideten, erledigt.
Das war der empfindlichste Schlag, den er dem Rancher versetzen konnte.
Nichts leichter als das. Er brauchte ja nur weit genug zu reiten, bis hinauf in die Berge, wo der kleine Silver Creek herkam. Da würde es nicht allzu schwer sein, irgendwo an einer versteckten Stelle einen so starken Abzweig einzubauen, daß der Creek hier unten auf dem Plateau so gut wie versiegte.
Der verbohrte Cowboy ritt hinauf in die Berge, dem Monida-Paß entgegen, von wo der Silver Creek kam.
Zwei Stunden nur benötigte er für seine Arbeit. Dann war es geschafft. Der Abzweig in dem kleinen Gebirgsrinnsal war so kräftig gebaut, daß er das Bächlein fast voll nach Südwesten dem Rock entgegenführte.
Nur dürftig rannen ein paar spärliche Wasserfäden an dem Abzweig vorbei in das alte Bett hinunter nach Norden auf die Weide des verhaßten Schotten zu.
Wohlgefällig betrachtete Roger Elliot sein Werk.
Da er sich nach wie vor in der Gegend herumtrieb, konnte er beobachten, daß die Gräser in der Sonnenglut sehr bald verdorrten. Die geringe Wassermenge des Silver Creek hatte doch eine ganze Menge ausgemacht. Das sah man erst jetzt deutlich, nachdem auch das Gebiet rechts und links von seinen Ufern verdorrte und die Rinder Barrings in das fast ausgetrocknete Bachbett stiegen.
Aber der Cowboy mußte feststellen, daß am nächsten Nachmittag das Wasser wieder silberhell und glasklar durch das Bachbett rann.
Er ritt auf einem Umweg in die Berge hinauf und sah da zu seinem Schrecken, daß der Abzweig aus dem Bachbett gerissen worden war, so daß die Wasser des Silver Creek wieder ihren natürlichen Lauf nehmen konnten.
So dumm also war der alte Schotte gar nicht!
Da Roger einmal hier oben war, baute er unter größten Anstrengungen in fliegender Hast einen neuen Abzweig.
Aber schon am übernächsten Tag sah er, daß der Creek wieder Wasser hatte.
John Barrings war also da nicht zu verwunden.
Aber er könnte nicht überall sein…
Ein Präriebrand im Norden zum Beispiel mußte ihn doch empfindlich treffen!
Der unselige Mann schreckte nicht davor zurück, das pulvertrockene Präriegras anzuzünden.
Aber zu seiner Verblüffung kam ausgerechnet in dieser Stunde Wind auf und trieb den Brand nach Westen hinüber auf die Weide der Elliot Ranch!
In panischer Hast flüchtete der Brandstifter.
Aber das Schicksal vertuschte auch diese seine heillose Tat. Kaum anderthalb Stunden nach Entstehen des Brandes fiel Regen, schwerer Platzregen, aus plötzlich auftauchenden schwarzen Wolken. Dadurch wurde der Brandfraß zwar nicht gleich völlig gelöscht, aber doch soweit erstickt, daß er nur noch schwach weiterglomm.
Der Regen hielt bis Mitternacht an und ließ am anderen Morgen nur eine häßliche schwarze Brandnarbe in der Weide der Elliot Ranch zurück.
Die Cowboys und der Boß der Elliot Ranch glaubten nichts anderes, als daß die Prärie sich selbst entzündet hatte, was andernorts schon geschehen war.
Doch John Barring glaubte nicht, daß sich der heimtückische Abzweig oben in dem Bachbett des Silver Creek selbst errichtet hatte!
Da war ein Feind am Werk…
Als er am Morgen nach der Brandnacht sah, wo die Flammen zuerst das Gras zernagt hatten, erschrak er: Auf meinem Land! Und als er bedachte, wie es gekommen wäre, wenn der Wind und der Regen nicht eingegriffen hätten, da faßte ihn ein Grauen.
Wer wollte ihn so treffen?
Der Schotte ritt oft nächtelang über seine Weide, aber er vermochte keine Spur seines Gegners zu entdecken.
Wer auch sollte sich hier in dieses einsame Land zwischen den beiden Flüssen verirren, das so weit ab von der großen Fahrstraße lag? Wer sollte sich die unbegreifliche Mühe machen, so etwas zu tun?
Und dennoch mußte es einen oder gar mehrere Menschen geben, die zweimal den Abzweig oben im Quellgebiet des Silver Creek gesetzt hatten, die versucht hatten, einen Präriebrand über seine Weide zu schicken. Daran konnte es keinen Zweifel geben.
Der Gedanke an diesen unheimlichen Feind versetzte den Rancher in größere Unruhe, als er sich bei seiner Familie daheim anmerken ließ.
Es war an einem schwülen Nachmittag.
John Barring hatte mehrere Stunden damit verbracht, ein paar versprengte Rinder zurückzutreiben. Da stutzte er plötzlich mitten im Ritt und starrte auf den Reiter, der vor ihm aus einer Bodensenke aufgetaucht war.
Roger Elliot!
Der Schotte erkannte ihn sofort. Glich der Cowboy doch seinen Brüdern so sehr, daß man nicht hätte sagen können, wer von den Elliots es war, wenn die anderen nicht tot und Ted ein hilfloser Krüppel wäre.
Roger Elliot!
Im Hirn des Ranchers arbeitete es. Wo kam der Bursche her? Was suchte er hier?
Einen Herzschlag lang suchte ein düsterer Gedanke das Herz des Schotten heim, verschwand aber wieder daraus, da Barring ihn geradezu für absurd hielt.
Was sollte diesen Jungen dazu veranlassen, ihn so zu schädigen? Nein, der Gedanke war Wahnsinn. Wohin einen Verzweiflung und Sorge führen konnten!
Dann ritt Barring auf den jungen Mann zu.
»Hallo, Mister Barring!« grüßte ihn Roger scheinheilig.
Der Rancher tippte an den Hutrand.
Er hatte neulich in Dillon erfahren, daß Roger nicht mehr zu Hause war. War er etwa gerade auf dem Heimweg? Wo kam er her?
Der Cowboy blickte ihn nachdenklich an. Er glaubte sich auf einem seiner Streifzüge über Barrings Land von dem Rancher überrascht, mühte sich aber jetzt, seinen Schrecken zu verbergen.
Eine neue Idee fraß sich in sein dumpfes Hirn.
»Wie steht’s, Mister Barring«, sagte er rasch, »brauchen Sie keinen Cowboy?«
»Schon, Roger, aber mir scheint, Ihr Vater braucht einen oder vielleicht zwei fremde Cowboys weniger, wenn der einzige ihm mit gesunden Gliedern verbliebene Sohn auf dem Hof geblieben wäre.«
Rogers Gesicht wurde rot.
»Ich gehe nicht nach Hause.«
Hätte er vielleicht sagen sollen: Ich habe Angst vor dem Zorn meines Vaters und den Augen meiner Mutter! Und auch vor Teds Blick habe ich Angst. Nein, das hätte er nie über die Lippen gebracht.
Vielleicht wußte er selbst nicht genau, was er eigentlich wollte, der Cowboy Elliot.
Ja, wenn der Vater tot wäre und die Mutter, dann würde er wieder zurückkehren. Und Ted hätte sich dann nach ihm zu richten. Was war schließlich ein Krüppel? Ein Nichts! Ein störendes Wesen auf einer Ranch, die nur gesunde zupackende Hände gebrauchen konnte?
Nicht ohne Grund verschwanden oft alte Menschen von den Ranches, wo sie nicht mehr arbeiten konnten, zogen streunend durchs Land, bis sie irgendwo wie ein Wild verendet auf der Strecke blieben. Nur, weil sie zu stolz waren, auf dem Hof, den sie einst mit hochgebracht hatten, das Gnadenbrot hinzunehmen.
Ob es doch Streit zwischen dem Burschen und seinem Vater gegeben hatte? überlegte Barring.
»Wie steht’s nun?« unterbrach Roger die Gedanken des Schotten.
»Sie glauben doch nicht im Ernst, Roger, daß ich das Ihrem Vater antun könnte?«
»Was tun Sie ihm an? Ich könnte mir denken, daß es ihm sehr viel lieber wäre, mich bei seinem Nachbarn zu wissen, als gar nicht zu wissen, wo ich stecke.«
»Oder auch nicht. Vielleicht wüßte er sie überall lieber als gerade bei John Barring.«
Der Cowboy schüttelte den Kopf. Er dachte fieberhaft nach, was er noch vorbringen konnte, um den Schotten umzustimmen.
In seinem unbegründeten, ja, verbohrten Haß auf den Rancher hatte er beschlossen, diesem Mann einen Schlag zu versetzen, wie man ihn einem Menschen schlimmer und vernichtender nicht geben kann.
Plötzlich, als er die blauen Augen des Schotten sah, hatte er an das Mädchen gedacht, das die gleichen blauen Augen hatte.
An Ann Barring, die bildhübsche Tochter des Ranchers, die aber so unnahbar war, daß es die Boys bald aufgegeben hatten, sie anzusprechen, wenn sie sie in der Stadt sahen.
Ann hatte ihre Besuche in der Stadt auf ein Mindestmaß beschränkt. Und wer fand schon einen Vorwand, die Barring Ranch aufzusuchen, wenn er Ann sehen wollte?
Sie war fast vergessen, die schöne Ann Barring. Und doch gab es sie ja.
Roger Elliot hatte sie plötzlich für sich neu entdeckt. War sie doch daheim auf dem Hof dieses Mannes da, den er so sehr haßte!
Er mußte auf diesen Hof kommen, ein Recht haben, dort zu sein. Dann war er in ihrer Nähe. Und dann sollte es ihm nicht schwerfallen, dem unbewachten Mädchen den Kopf zu verdrehen. Der Rancher und seine Frau hatten nicht Zeit genug, sich ständig um Ann zu kümmern. Zuviel Arbeit gab es auch auf dieser Ranch, die groß war und keine Cowboys hatte.
»Ich würde gern bei Ihnen arbeiten, Mister Barring. Und ich bin sicher, daß Sie einen Cowboy gebrauchen können.«
Der Rancher legte den Kopf ein wenig auf die Seite und musterte den Jungen forschend.
War er wirklich ein guter Cowboy, der Elliotsohn? Ja, sie waren alle ausnahmslos echte Cowboys gewesen, die Burschen von drüben. Und dieser Roger machte da gewiß keine Ausnahme. Er wäre schon eine enorme Hilfe auf der Ranch.
Aber konnte er das dem alten Mann drüben antun? War es nicht eine Gemeinheit, ihm den Sohn wegzunehmen?
Andererseits: War es nicht letztlich einerlei, wo der Bursche arbeitete, wenn er doch nicht daheim sein wollte? Roger war schließlich alt genug, um zu wissen, was er zu tun und zu lassen hatte. Wenn er schon anderwärts arbeitete, weshalb nicht bei ihm? Was hatte er, Barring, denn noch mit James Elliot zu schaffen? Der alte Zwist war von seiner Seite aus längst begraben.
Daß Elliot an jenem schwarzen Tag kränkende Worte hervorgestoßen hatte, konnte ihm der Schotte längst nicht mehr nachtragen. Zu groß war das Leid gewesen, das den Vater der drei Burschen damals getroffen hatte.
Barring nahm seinen zerfledderten Stetson ab und wischte sich mit einem grauen Tuch über den kahlen Schädel.
»Well, Roger, vielleicht könnten wir einig werden, wenn Sie nicht zuviel fordern. Ich bin schließlich kein reicher Mann.«
Roger hatte Mühe, seine Befriedigung über den Fortgang der Dinge zu unterdrücken.
»Ich verlange nicht viel, Mister Barring. Sie werden es für verrückt halten, aber für zwanzig Bucks bin ich Ihr Mann.«
Barring schüttelte den Kopf.
»Nein, das wäre Ausnutzung. Fünfunddreißig sind einfach üblich, und für einen guten Mann muß jeder Rancher vierzig zahlen. Aber ich muß mich überall einschränken, deshalb habe ich niemals daran gedacht, mir einen Mann zu nehmen. Ich werde Ihnen dreißig geben, Roger Elliot.«
Der Bursche beharrte auf zwanzig. Kopfschüttelnd wandte Barring sein Pferd. Nach einigen Schritten hielt er den Grauen an und winkte dem Cowboy. »Sagen wir fünfundzwanzig.«
Wortlos ritten sie zur Ranch zurück.
Eine Überraschung wartete auf sie.
Drüben vor dem Stall saßen zwei Männer auf einer Wagendeichsel.
Roger sah sofort, daß es Hal und Owen Hacatt waren.
Aber diese beiden Männer waren im Gegensatz zu Roger Elliot durch die furchtbare Stunde geläutert worden. Sowohl Hal, der ältere, als Owen, der jüngere, hatten diese Wahnsinnstat längst bitter bereut und verzweifelt versucht, den Vater doch noch umzustimmen.
Aber nachdem er sie dreimal wieder abgewiesen hatte, gaben sie es endgültig auf.
Brian war jetzt der älteste Sohn für Hacatt, und Kid und Ralph hatten so wenig auf der Ranch zu lachen wie er.
Da hatten sich die beiden älteren entschlossen, anderwärts um Arbeit nachzukommen.
Bei Elliot? Nein, der Weg dorthin war denn doch zu schwer, da der Rancher sie mit keiner Silbe dazu ermutigt hatte.
Dann kam im County als nächster Barring.
Und das war schon der Schluß. Alles andere waren nur kleine Farmen, die keinen Mann einstellen konnten.
Barring hatte Land und Rinder. Und wenn er zwei Leute einstellte, könnte er mehr Land hinzunehmen und auch mehr Rinder. Dann lohnten sich zwei Cowboys schon. So hatten die beiden verstoßenen Hacatts gedacht.
Als die beiden den Rancher erkannten, erhoben sie sich und gingen ohne große Zuversicht auf ihn zu.
Hal sah, wie Owen den Hut abnahm und folgte dem Beispiel des Bruders.
Dann stieß Owen den älteren an. Hal mußte sprechen, auch wenn es ihm schwerer fiel als Owen.
»Mister Barring. Vielleicht erinnern Sie sich unserer noch…«
Dümmer hätte Hal kaum beginnen können.
Der Rancher zog die Stirn in düstere Falten.
»Doch, leider erinnere ich mich eurer Gesichter noch. Es scheint überhaupt heute ein sonderbarer Tag zu sein. Auch dieser Cowboy da hinter mir kam heute in meinen Weg, und hat mich dadurch an einen Tag erinnert, an den ich ganz sicher nicht gern erinnert werden wollte.«
Da fiel Owen rasch ein: »Mister Barring! Es geht darum, ob Sie uns nicht einstellen könnten.«
»Einstellen?« Barring zog die Brauen zusammen. »Euch beide? Euer Vater hat selbst eine große Ranch und wird euch brauchen.«
»Nein, er will uns nicht mehr. Heute morgen hat er es uns zum drittenmal gesagt. Wir brauchen ihn nicht mehr zu bitten. Und deshalb sind wir hier.«
»Weshalb gerade hier?«
Owen warf einen Blick auf Roger.
»Weil sein Vater uns auch nicht haben will.«
»Kann ich verstehen«, meinte Barring.
»Wir arbeiten für den halben Lohn, Rancher«, sagte Owen schnell.
John Barring sah sich nach Roger Elliot um und nahm dann den Stetson ab, um sich erneut den Schädel zu wischen.
»Das hat dieser Mann mir vor anderthalb Stunden auch angeboten, als ich ihn unten am Silver Creek traf.«
Die beiden Hacatts maßen den Elliotsohn mit schrägen Blicken.
»Der?« fragte Hal heiser. »Weshalb denn? Sein Vater kann doch nicht auf ihn verzichten.«
»Das dachte ich auch«, stimmte Barring zu.
Da preßte Owen heiser durch die Zähne: »Er kann nicht so billig sein wie wir, Boß! Wir arbeiten jeder für fünfzehn. Von morgens um vier bis zum Umfallen.«
»Ich auch!« In Rogers Augen blitzte es auf.
Sie standen einander plötzlich wieder gegenüber. Und wieder waren die Hacatts in der Überzahl. Und wieder war es der greise Barring, der zwischen sie trat.
»Ich habe kein Geld, drei Cowboys zu beschäftigen!«
»Aber gebrauchen könnten Sie zehn!« sagte Owen rauh.
»Natürlich, aber ohne Geld geht es nicht.«
»Ich war zuerst da!« rief Roger.
»Wir sitzen seit dem frühen Morgen hier und haben auch schon mit Miß Ann gesprochen.«
Ann! Wie ein Blitzstrahl zuckte es durch Rogers Hirn. Um keinen Preis durfte er den so mühsam errungenen Sieg wieder preisgeben.
Da erklärte Hal Hacatt heiser: »Wir arbeiten nur fürs Essen, Boß!«
Der Rancher wurde rot vor Ärger.
»Nein, nein, nein!«
Und dann sah er die drei Burschen der Reihe nach an. Sie waren jung, stark und gesund. Und alle drei gute Cowboys, um die sich jeder Rancher selbst bei fünfunddreißig Dollar Lohn gerissen hätte.
Drei solche Männer mit ihm als Boß bildeten schon eine kleine starke Crew. Man könnte die Rinder sofort verdreifachen, neues Land auf Schuldkonto nehmen, und man konnte vielleicht sogar ein paar Pferde züchten. Bei Gibbons in Dillon bekam er sie sicher auf Kredit. Mit drei solchen Burschen hätte die Ranch in einem Vierteljahr das Geld fünffach wieder eingebracht, das er an sie zahlen mußte, wenn er es mit fünfundzwanzig Bucks versuchen würde.
Ehe Roger oder einer der anderen noch etwas sagen konnte, hob der Rancher die Hand.
»Stellt euch zunächst einmal nebeneinander. Ich will euch nie mehr gegeneinander sehen. Sonst schmeiße ich euch raus!«
»Soll das etwa heißen, daß Sie uns einstellen?« rief Owen heiser.
»Ruhe, jetzt rede ich! Hal ist der älteste. Er ist der Vormann, und ihr beide tut, was er sagt. Und er tut, was ich sage. Ist das klar?«
Sofort stellten sich die drei Cowboys nebeneinander. Sie nickten stumm. Mit einem Glücksgefühl im Herzen die beiden Heimatlosen der Hacatt Ranch, und mit einem Dorn in der Seele der ruhelose Sohn von der Elliot Ranch.
Da erschien das Mädchen in der Tür des Wohnhauses.
»Vater, das Essen!«
»Ich komme, Ann. Und zwar in einer halben Stunde, wenn du auch das Essen für meine drei Männer fertig hast. Für Hal Hacatt, den Vormann, für Roger Elliot und Owen Hacatt, die Cowboys.«
Aus weiten Augen musterte das Mädchen die drei Männer.
Es gab im Hause Barrings keinen Widerspruch gegen das, was der Rancher anordnete. Er mußte wissen, was er entschied.
Und schon in den nächsten Tagen sah es so aus, als ob er richtig entschieden hätte.
Die kleine Ranchmannschaft schaffte mit der Verbissenheit Ausgestoßener für den fremden Boß.
Der Rancher brauchte so gut wie nichts anzuordnen, und auch der Vormann brauchte so gut wie nichts zu sagen. Sie waren Klasse-Cowboys, jeder für sich. So wie Hal die Arbeit eingeteilt hatte, schafften sie wie die Berserker.
Nach vierzehn Tagen hatte sich die alte Barring-Ranch völlig verändert.
Der Schotte hatte Rinder auf Kredit bestellt und Pferde. Er hatte ein weites Stück Weideland hinzugenommen. Die Zahl seiner Hühner war verfünffacht, da sich die Frauen jetzt viel mehr um das Federvieh kümmern konnten.
Ann fuhr die Eier in die Stadt zum Generalstore, dessen Eigentümer sie ihr für den geforderten Preis direkt aus der Hand riß.
Owen Hacatt hatte dem Rancher diesen niedrigen Preis vorgeschlagen. »Damit sind wir konkurrenzlos, Boß…«
Überhaupt hatte der kluge Bursche manchen guten Gedanken gehabt, um den ihn Roger Elliot heiß beneidete.
Aber sie arbeiteten gleich gut und waren in ihrem Eifer geradezu bewundernswert, die Barring Cowboys.
Nach einem Monat stand der Rancher abends, als die drei seinem Vorschlag, endlich einmal in die Stadt zu reiten, nachgekommen waren, allein auf dem Hof, ging zum Corral hinüber und sah sich überall um.
Was doch drei Männer im Verein mit ihm und den Frauen schaffen konnten! Es war unfaßlich.
Wie hatte er nur so ängstlich sein können und keinen Menschen einstellen wollen?
Well, er durfte nicht vergessen, daß sie für einen geringen Lohn arbeiteten.
Noch wußte offenbar niemand im County von den Veränderungen bei Barring.
Jack Gibbons, der ihm die Pferde verschafft hatte, mußte etwas geahnt haben. Aber da niemand auf dem Hof zu sehen war außer der Rancherstochter, als die Pferde gebracht waren, wußte auch er nichts Genaues.
Und die Rinder hatte Jonny Teckbridge mit seinen Leuten direkt auf die Weide gebracht. Barring und seine Tochter hatten die Tiere übernommen und gezählt.
Noch wußte niemand wirklich, was sich auf der Barring-Ranch tat.
Bis zu diesem Tage.
Die drei Cowboys ritten in die Mainstreet ein – und die Leute blieben auf der Straße stehen.
Der Rancher hatte sie absichtlich schon so sehr früh beurlaubt, damit sie die Stores noch offen fanden und sich vielleicht noch dieses oder jenes kaufen konnten; denn schließlich brauchte jeder Mensch einmal ein paar private Dinge.
Das war ein Bild, das sich Dillon nie hätte träumen lassen. Hal und Owen Hacatt, und in ihrer Nähe der Elliotsohn!
Sie hielten vor dem Montana-Saloon, banden ihre Pferde an und betraten die Schenke.
Wieder lehnten sie wie damals nebeneinander.
Mit düsteren Blicken musterte sie der Wirt.
»Gents, ich habe…«, stammelte er. Dann rief er: »Susan! Hol sofort den Sheriff! Sag ihm, die Hacatts und die Elliots wären wieder in der Stadt!«
Da richtete sich Roger auf.
»Die Elliots? Sie sind blind, Cardrup! Es gibt nur noch einen Elliot. Und der gehört wie diese beiden Hacatts zur Barring Ranch. Es wäre gut für Sie, wenn Sie sich das merken würden. Sorgen Sie dafür, daß uns der Sheriff mit seiner sauren Miene nicht den Whisky vergiftet. Sonst gibt’s kein heiles Glas mehr auf Ihren Borden hier, wenn wir dem Laden good bye sagen.«
Was war das? Was hatte dieser Mann da gesagt?
Ferry Cardrup begriff es schneller, als man es ihm zugetraut hätte. Es war dem alten Barring also gelungen, diese Kerle unter einen Hut zu bringen! Und gleich am richtigen Ort, nämlich auf seiner Ranch.
Damned! Das war eine Sensation allerersten Ranges.
Daher also hatte sich der Schotte neue Rinder kaufen können, Pferde und Wagen. Mochte der Teufel wissen, was sonst noch! Deshalb auch gab’s plötzlich so billige Eier bei Jenkins.
Die drei tranken ihren Whisky, bezahlten ihn – und als sie sich umwandten, um zu gehen, wurde vorn die Pendeltür aufgestoßen.
Brian Hacatt stand vor ihnen. Gefolgt von Ralph, Kid und zwei fremden Burschen.
Brian starrte die Brüder entgeistert an.
»He, was ist denn das?«
Hal wollte an ihm vorbei.
Da machte Brian den Fehler, ihn aufhalten zu wollen.
»Laß mich los«, knurrte Hal ihn an.
»Hal, was macht ihr denn hier? Damned, wenn Vater es erfährt, ist der Teufel los. Ihr wolltet doch aus dem County reiten!«
Die beiden Hacatts wollten hinaus. Aber Roger, der unselige Roger Elliot blieb stehen.
»Das laßt ihr euch gefallen! Hal, Owen! Von diesen Halunken?«
Sofort sprang Brian ihn an.
Roger warf ihn mit einem linken Haken zurück.
Da waren Kid und Ralph und machten ihm das Leben schwer.
Owen stand noch auf dem Vorbau.
»Hal, verdammt noch mal, wir können nicht gehen. Wir müssen ihm helfen!«
»Weshalb läßt sich dieser Idiot denn mit ihnen ein?«
Sie machten kehrt – und innerhalb von zehn Minuten gab es im Montana Saloon kein unversehrtes Stück mehr.
Der Sheriff ließ sich wohlweislich nicht sehen. Aber dafür kam John Barring.
Hatte er es doch geahnt! War die Warnung und die Mahnung seiner Frau doch nicht grundlos gewesen!
»By gosh!« fluchte er, »Ihr elenden Halunken! Was habe ich euch denn gesagt? Damned! Schert euch zum Teufel! Aber sofort.«
Hal blieb vor dem Rancher stehen und hielt mit der Rechten seinen aus den Nähten gerissenen Hemdsärmel fest.
»Sie müssen zugeben, Boß, daß wir nicht zusehen konnten, wie Roger hier zerschlagen wurde.«
»So, das muß ich zugeben? Verrückt seid ihr! Ein allerletztes Mal: hinaus! Und zurück auf die Ranch! Sofort!«
Feixend schoben die drei Barring-Reiter davon.
Brian und die anderen blickten dumm drein.
Barring stampfte auf Brian zu.
»Und Sie sollten sich auch daran halten: solche Zusammenstöße führen zu nichts Gutem. Klar, daß der Schaden hier gerecht aufgeteilt wird. Ihre Kerle die Hälfte, ich die andere Hälfte.«
»Sie?« stammelte Brian verblüfft.
»Ja, es waren schließlich meine Cowboys!«
»Ihre…!«
Barring ging auf die Theke zu.
»Sie lassen mich wissen, wie hoch unser Anteil ist, Cardrup. Ich verlasse mich auf Sie.«
Der Salooner, der auch etwas abbekommen hatte, preßte ein Taschentuch auf eine Gesichtsschramme.
»All right, Mister Barring.«
Dann stampfte der Rancher hinaus, um sich davon zu überzeugen, daß seine Männer auch tatsächlich die Stadt verließen.
Der Zwischenfall wurde von den Beteiligten bald vergessen, aber im County wurde noch lange darüber geredet.
Sowohl auf der Hacatt Ranch als auch bei Elliot schlug die Nachricht wie ein Blitzschlag ein.
Und als Elliot heimlich die Rinderzahl seines wieder stark gewordenen Nachbarn schätzen ließ, erschrak er regelrecht.
So etwas konnte doch nicht mit rechten Dingen zugehen! Sollten Haß und Verzweiflung soviel erreichen können?
Er wußte ja nicht, daß Barring noch schwer verschuldet war und einen harten Kampf begonnen hatte.
Da erschien eines Vormittags ein Reiter auf der Ranch des Schotten.
Es war ein hagerer Mann mit fahlem, scharfem Gesicht und grauen Augen.
Er ritt einen abgetriebenen Braunen und machte selbst auch keinen sonderlich frischen Eindruck.
Ann Barring kam auf die Veranda und fragte, was er wünsche.
»Etwas Wasser, Miß«, meinte der Fremde im texanischen Slang.
»Bitte, da ist der Brunnen. Ein Becher hängt dabei. Und für Ihr Pferd ist eine kühle Tränke neben dem Stallhaus.«
Der Fremde hörte gar nicht auf die Worte der Frau – er verschlang sie mit seinen Blicken.
Zounds! Welch eine Rose in dieser einsamen Prärie!
Er stellte einen Fuß auf die Treppe und stützte sich aufs Knie.
»Sagen Sie, Miß, gibt’s bei Ihnen keine Arbeit für mich?«
»Nein, ich glaube nicht…«
Aber Ric Skinner ritt nicht weiter, obgleich er seinen Durst gestillt hatte und sein Pferd auch schon wieder die Ohren aufstellte.
Er hockte drüben im Schatten des Wagendaches und starrte reglos vor sich hin.
»Was will er nur noch?« fragte Ann die Mutter besorgt.
»Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er müde – oder hungrig. Bring ihm ein Stück Speck, etwas Käse und einen Kanten Brot.«
Ann ging mit diesen Dingen wieder hinaus.
Da grinste ihr der hagere Mann entgegen.
»Keine schlechte Idee, Miß.«
»Mein Name ist Barring.«
»Well, Miß Barring. Aber nehmen Sie die Sachen nur wieder mit. Ich warte hier.«
»Auf wen?«
»Auf Mister Barring. Ihren… Mann?«
»Er ist mein Vater.«
»Um so besser!« Er grinste unangenehm und bleckte ein gelbes, ungepflegtes Gebiß.
*
Um diese Stunde plagten sich die vier Männer draußen auf der Weide mit dem Brennen der Rinder.
Owen Hacatt meinte, als sie endlich schweißgebadet für heute Schluß machten: »Yeah, Boß, da wäre ein weiterer Mann gut. Und auch demnächst beim Trail zur Station. Und für die Bereitung des Winterfutters. Wenn jetzt das Holz gemacht werden muß. Und Bäume wollten wir auch noch fällen und schälen und zur Station bringen. Damit haben wir immer eine schöne Stange Dollars hereingeholt, die man im Winter bitter notwendig brauchen kann.«
Bäume? An so etwas hatte Barring seit vielen Jahren nicht mehr gedacht, obgleich er ein ordentliches Stück Wald hatte, das ungenutzt im Süden an den Bergen lag.
Holz brachte Geld, wenn es gefällt und geschält war und zur Sägemühle gleich neben der Station geschleppt wurde. Aber mit vier Leuten konnte man nicht auch noch diese Arbeit schaffen.
In diese Situation hinein war Ric Skinner gekommen.
Er erhob sich erst, als der Rancher sein Pferd vor ihm anhielt.
»Sie sind Barring?« fragte er, legte den Kopf auf die Seite und fixierte den Schotten, wobei er seine Beine gespreizt hielt, auf den Zehenspitzen wippte und die Daumen hinter den Waffengurt hakte.
Zwei schwere fünfundvierziger Revolver steckten in dem abgegriffenen Halfter.
Roger Elliot zog die Brauen zusammen und antwortete, ehe Barring auf die Unverschämtheit etwas erwidern konnte: »No, Boy, das ist nicht Barring. Es ist Mister Barring, der Rancher, für jedermann. Und wer das nicht glaubt, dem bläuen wir es gern ein.«
Skinner durchforschte Elliots Gesicht und grinste breit, wobei er seine Zähne sehen ließ.
»Du bist der Vormann?«
Da stiegen die drei Barring-Reiter ab und machten drohende Gesichter.
Der Rancher rutschte ebenfalls aus dem Sattel und meinte gutmütig: »Sie haben ziemlich sonderbare Gewohnheiten, Mann. Schätze, Sie kommen aus Texas?«
Ein Schatten flog über Skinners Gesicht.
»Haben Sie etwas gegen Texas, Mister?«
»Sicher nicht, wenn die Leute, die von dorther kommen, mir keinen Grund zum Ärger geben. – Was wollen Sie?«
»Ich suche einen Job.«
Dabei lehnte sich Ric gegen den schweren Stützpfeiler des Wagendaches, schlug die Beine übereinander und schob die Hände in die Taschen. So bot er alles andere als das Bild eines Mannes, den man gern in Lohn und Brot nehmen möchte.
Aber Barring dachte an die Notwendigkeit, wenigstens noch einen weiteren Mann in die Crew zu nehmen, und mühte sich, das ungehobelte Benehmen dieses Fremden zu übersehen.
»Einen Job – als was?«
Da richtete sich Skinner auf und krächzte: »Ich bin Texaner – also Cowboy. Wenn Sie einen guten Vormann brauchen…«
»Ich habe einen guten Vormann, Mister…«
»Skinner, Ric Skinner.«
Skinner? Der Name drang den vier Männern unangenehm in die Ohren.
Lautete so nicht der Name eines berüchtigten Verbrechers, der jahrelang das mittlere Texas, ja, sogar die Gegend bis an die Grenze Oklahomas hinauf tyrannisiert hatte?
Skinner feixte.
»Daß Ihnen mein Name nicht gefällt, kann ich verstehen. Ed Skinner war mein Bruder.«
Ed Skinner! Richtig, Eddie Skinner, so hatte der Bandit geheißen.
Und dieser Bursche da erklärte ohne jede Scheu und Hemmung, daß er ein Bruder dieses berüchtigten Verbrechers sei!
»Eddie Skinner war wirklich Ihr Bruder?« fragte der Rancher rauh.
»Ja, und er wäre es noch, hätte es diesen Marshal nicht gegeben, den ich eines Tages noch abfahren lassen werde.«
Owen Hacatt platzte in die darauffolgende Stille hinein: »Hat Wyatt Earp ihn nicht gestellt?«
»Ja, Wyatt Earp!« Es schien den Männern, als habe der Texaner diesen Namen nicht ausgesprochen, sondern gezischt, wie eine Klapperschlange zischte.
Wyatt Earp! Richtig, der berühmte Marshal von Dodge City, hatte nach wochenlanger, mörderischer Hetzjagd durch ganz Texas diesen brutalen und eiskalten Verbrecher zur Strecke gebracht. Damals sprach der ganze Westen monatelang davon.
Und dieser Mann wollte der Bruder dieses vielfachen Mörders sein! Gedachte dieser Fremde etwa, sich mit einer solchen Behauptung brüsten zu können?
Der ganze Auftritt war so verblüffend, daß es eine ganze Weile dauerte, ehe selbst der kluge Owen Hacatt zu einer weiteren Frage fand: »Und Sie – hatten nie etwas mit den Machenschaften Ihres Bruders zu tun?«
Skinner zog die hellen, unschön wirkenden Brauen zu einem schmalen Strich zusammen.
»Nie etwas zu tun? Was soll diese verrückte Frage? Mein Bruder war mein bester Kamerad. Ich habe ihn bewundert.«
»Er muß doch erheblich älter gewesen sein als Sie?« fragte der Rancher.
»Erheblich nicht«, entgegnete Skinner.
»Fünf Jahre.«
Wahrscheinlich hätten sie sich längst nicht mehr mit ihm unterhalten und die drei Cowboys hätten den widerborstigen Burschen zum Tor hinausbefördert – hätte nicht dieser Richard Skinner sie auf eine seltsame Art fasziniert.
War es ein Fluidum des Düster-Geheimnisvollen, das ihn umgab? Wollte er sich bewußt damit umgeben? Wollte er sich mit schwarzen, finsteren Dingen interessant machen?
John Barring hatte das Gefühl, daß dieser Mann nicht log – daß er sich aber mit der grausigen Verwandtschaft doch auch interessant zu machen suchte.
Fürchtete er vielleicht, ohne dies auf fremde Menschen wirken zu können? Glaubte er, dieses Fluidum zu brauchen, um überhaupt angehört zu werden?
Das wäre ein schrecklicher Irrtum seinerseits gewesen.
Denn wenn man auch mit Gruseln und Schauergefühl seine Worte anhörte und ihn deshalb schärfer beobachtete – Red Skinner gewann nicht dadurch.
»Sie werden doch nicht etwa wegen ähnlicher Dinge von der Polizei gesucht, Skinner?« fragte Barring schroff.
Skinners Gesicht hatte auf einmal etwas Maskenhaftes, Starres.
»Mein Bruder war ein Freiheitskämpfer, Mister. Und…«
»Die Story kenne ich«, unterbrach der Rancher ihn rauh.
»Beantworten Sie gefälligst meine Frage!«
Das schien ein Ton zu sein, der bei dem Texaner besser fruchtete. Er nahm die Hände aus den Taschen.
»Nein, ich werde von keinem Sheriff gesucht!«
»Das will ich Ihnen raten, Skinner. Denn falls Sie hier einen Unterschlupf gesucht haben sollten, sitzt Sie im falschen Sattel.«
Das Lachen des Texaners war so blechern und kalt, daß es selbst Roger Elliot bis unter die Haut drang.
»Well«, entschloß sich der Rancher, »wenn Sie also ein unbescholtener Mann sind und arbeiten wollen, wenn Sie nicht aufsässig sind und meine Leute nicht stören, wenn Sie keinen großen Lohn verlangen, dann können wir über die Sache reden.«
»Ist das nicht ziemlich viel auf einmal verlangt?« meinte Skinner unverschämt.
»Boß«, entgegnete Hal, »der Bursche gefällt mir nicht.«
Skinners Kopf flog herum. Seine Augen waren plötzlich eng und schmal.
»Wer ist dieser Mann, Rancher?«
»Mein Vormann, Hal Hacatt!«
»Ah, der Vormann.« Skinner wiegte sich auf seinen Zehenspitzen, schob die Hände wieder in die Taschen und hatte plötzlich ein dünnes Lachen auf seinem Gesicht.
Owen Hacatt meinte: »Müssen wir noch hier herumstehen wegen dem da, Boß?«
»Nein, bringt die Pferde weg, und dann ist für heute Feierabend.«
Skinner wollte noch etwas sagen, aber Barring gebot ihm mit einer energischen Handbewegung Schweigen.
»Wenn Sie sich wirklich hier um Arbeit bemühen wollen, Skinner, dann haben Sie sich einzufügen in die Crew. Genau wie es auch bei Ihnen in Texas üblich ist. Und noch etwas: Sie scheinen einen seltsamen Gefallen an der scheußlichen Sache mit Ihrem Bruder gefunden zu haben. Sonst…«
»Was soll das heißen?« fauchte Skinner dazwischen.
»Lassen Sie den Boß ausreden, Mann!« knurrte ihn Hal an.
»Sonst würden Sie höchstwahrscheinlich froh sein, wenn niemand etwas davon erfährt. Andererseits ist es nicht ausgeschlossen, daß Sie sich sagen: ich will nichts verheimlichen, damit es nichts zu entlarven gibt…«
»Entlarven? Was soll dieser Ausdruck! Rancher, ich bin ein…«
»Sie sollen den Boß nicht unterbrechen, Skinner!« knurrte Hal erneut. »Tun Sie es noch einmal, dann kracht’s. Was glauben Sie wohl, wieviel Zeit wir hier mit der Einstellung oder Abweisung irgendeines Cowboys namens Skinner zu vergeuden haben?«
Da war wieder der richtige Ton, und der Texaner grinste unsicher.
»Also«, fuhr Barring fort, »um es kurz zu machen: Für uns ist weder Ihr Bruder, noch sonst ein Mensch, der sich hart gegen das Gesetz vergeht, ein Gegenstand der Bewunderung. Im Gegenteil, wir verurteilen jedes Verbrechen! Ich wünsche nicht, daß Sie Ihre düstere Story als mein Cowboy weiterverbreiten.«
»Dann bin ich nicht Ihr Mann!« Skinner griff nach dem Zügel seines Pferdes.
Barring blickte ihm mit harten Augen nach. Es kostete ihn Mühe, den Mann nicht zurückzurufen, den er bestimmt gut bei den kommenden Arbeiten auf der Ranch und im Holz gebrauchen konnte.
Da krächzte Roger Elliot: »Wo willst du denn hin, Skinner? Träumst du vielleicht, daß auf den drei Ranches, die es hier auf hundert Meilen im Geviert gibt, ein Boß anderer Ansicht ist? Für mich bist du ein Idiot.«
Richard Skinner ließ sein Pferd los und kam zurück. Er blieb vor Roger stehen.
»Wo willst du liegen, Junge?«
Roger kniff ein Auge ein.
»Das wollte ich dich gerade fragen.«
Schon schlug Elliot zu.
Schwer hatte der linke Haken den Texaner getroffen. Aber er warf ihn nicht von den Beinen.
Skinner kam zurück mit hängenden Armen.
»Come on, Boy! Schlag noch mal zu, dann reiße ich dir den Arm aus dem Gelenk.«
Ein wilder Kampf begann.
Richard Skinner erwies sich als eisenharter Mann.
Dennoch gelang es dem gewandten Boxer Elliot immer wieder, ihn mit besser placierten Schlägen auf Distanz zu halten.
John Barring machte dem wilden Kampf ein Ende.
»Schluß! Wir haben wichtigere Dinge zu tun, als uns herumzuprügeln. – Skinner, werden Sie von den erwähnten Dingen in Zukunft schweigen oder nicht?«
»Ist das ein Ultimatum?«
»Ja.«
»Well, dann bin ich eben gezwungen worden, meinen Bruder zu verleugnen.«
War das nur Texanerstolz? War es Starrsinn oder nichts weiter als ein raffinierter Bluff?
Immerhin, dieser Ric Skinner war keine Alltagserscheinung, und die Leute auf der Barring Ranch hatten noch keinen Menschen gesehen, der ihm ähnelte.
Skinner wurde eingestellt.
Er hatte gefragt: »Was kriegt der Vormann?«
»Geht Sie einen Dreck an«, hatte ihm der Boß geantwortet.
»Well, und die andern?«
»Wir kriegen fünfundzwanzig«, sagte Owen der Wahrheit gemäß.
Skinner lachte blechern auf.
»Entweder seid ihr verrückt, oder ihr lebt hinter dem Mond. Bei uns in Texas gibt’s dreißig.«
»Wären Sie doch in Texas geblieben!« konterte Owen.
»Ich bin jetzt hier«, gab sich Skinner scheinbar zufrieden. »Und es bleibt mir ja nichts anderes übrig, als die fünfundzwanzig zu nehmen.«
»Dafür ist der Whisky hier oben besser«, tröstete ihn Elliot, der sich noch vor Minuten mit ihm geschlagen hatte.
Skinner warf ihm einen scheelen Blick zu.
Das Mädchen Ann, das die ganzen Vorgänge hinter der Küchengardine hatte beobachten können, schüttelte stumm den Kopf.
Da hörte Ann ihre Mutter hinter sich sagen: »Ist es nicht gräßlich, daß man solche Leute einstellen muß? Der Mann ist doch widerlich. Schon sein Lachen, ganz zu schweigen von seinen Reden.«
»Vater braucht ihn.«
»Leider…«
So blieb der texanische Cowboy Skinner und machte sich gleich an die Arbeit, an die der Vormann ihn schickte.
»Der Verschluß vom Corralgitter ist nicht in Ordnung. Muß ein neuer Holzriegel angebracht werden.«
Skinner nickte, ließ sich den Werkzeugschrank im Geräteschuppen zeigen, und bald hörte man den Neuen hämmern, sägen und verbissen am Gatter herumhantieren.
Es war verhältnismäßig saubere Arbeit, die er geliefert hatte.
Drei Tage später wußten die Menschen auf der Barring Ranch, daß dieser Skinner zwar menschlich kein Gewinn, aber ein recht guter und brauchbarer und zäher Cowboy war.
Dennoch, es gab kaum jemanden auf der Ranch, der ihn nicht gern hätte wieder davonreiten sehen. Dieser unangenehme Bursche verdarb die ganze Luft auf der Ranch.
*
Elliot, der sich in seinen geheimen Plänen erneut gestört sah, brachte dem Texaner offene Feindschaft entgegen. Denn er hatte sich mit der Gegenwart der beiden Hacatts bereits abgefunden.
Sie würden ihn nicht stören. Keiner der beiden hatte ein Auge auf Ann geworfen. Das wußte er bereits nach vierzehn Tagen.
Die beiden Burschen hätten es gar nicht gewagt, sich so hoch zu versteigen. Sie waren froh, bei Barring untergekommen zu sein und hegten keinerlei Hintergedanken.
Und niemand wäre auf die Idee gekommen, daß Roger Elliot planen konnte, das Herz der schönen Ann zu gewinnen, um das Mädchen dann, wenn es ihm verfallen war, von sich zu stoßen.
John Barring hatte ihm niemals irgendeinen Schaden zugefügt. Aber Elliot hatte sich so in den Gedanken verbohrt, daß das ganze Unglück, der Tod seiner Brüder und die Tatsache, daß er dem Vater nun nicht mehr in die Augen blicken konnte, diesem Schotten zuzuschreiben war.
Und nun kam dieser Skinner…!
Er legte sich abends nicht so früh hin wie die beiden Hacatts.
Er trieb sich auf dem Hof herum, und eines Abends gegen zehn Uhr entdeckte Roger ihn unter dem Fenster des Mädchens.
Ann wollte gerade das Fenster schließen, als Skinner ein Stück Holz dazwischenschob.
Ann wich entsetzt zurück.
»Ich bin’s, Ann«, hörte Roger den Tex.
»Gehen Sie!«
»Aber, aber, mein Täubchen, wer wird denn so garstig sein! Sie dürfen mich nicht mit diesen verstaubten Cowpunchern hier vergleichen. Ich bin schließlich…«
»Was bist du?«
Wie aus der Erde gewachsen tauchte Roger vor dem Texaner auf.
Der riß einen Faustschlag nach vorn und traf Roger am Hals.
Roger schlug zurück! Einmal, und dann zog er unter einem rechten Schwinger des Texaners einen steifangewinkelten linken Haken zum Kinn Skinners, dem er sofort eine Rechte an die andere Kante folgen ließ.
Damit war der Fight beendet. Skinner torkelte zurück und ging davon.
Ann stand am Fenster.
»Danke, Mister Elliot.«
»Bitte.«
Sie dachte nicht darüber nach, wo der Sohn des Ranchers Elliot plötzlich hergekommen war. Sie glaubte nur, ihm danken zu müssen.
»Miß Ann…«
»Ja.«
»Ich wollte Ihnen schon lange etwas sagen.«
Das Mädchen, das längst das Interesse des schmucken Mannes an ihr bemerkt hatte, stammelte: »Bitte nicht, meine Eltern schlafen noch nicht.«
Da sah sie seine Zähne in der Dunkelheit schimmern.
»Aber, Ann! Ich wollte Ihnen doch nur sagen, wie dankbar ich Ihrem Vater bin, daß er mich angenommen hat. So bin ich doch wenigstens in der Nähe meiner Heimat. Ich bin sehr glücklich. Und auch Ihrer Mutter und Ihnen möchte ich danken.«
Er streckte ihr die Hand entgegen und spürte eine eiskalte Mädchenhand in der seinen.
Und wußte genau, daß er mit diesen heuchlerischen Worten mehr bei dem unerfahrenen Ding erreicht hatte, als wenn er sie mit heißen Liebesschwüren bestürmt und erschreckt hätte.
Ann Barring hatte sich in den Sohn des Ranchers Elliot, der wegen des schrecklichen Gunfights damals nicht mehr nach Hause reiten wollte, verliebt.
Und sie sagte es nach einiger Zeit den Eltern.
Der Vater nahm es nicht ohne Sorge auf, da ihm die düstere Stunde in Dillon noch zu deutlich im Gedächtnis stand. Er dachte an das harte, kalte Gesicht gerade dieses jungen Mannes, der vor dem Fight am wenigsten Furcht und Bedenken gezeigt hatte.
Sonst allerdings hatte er nichts mehr gegen den jungen Elliot einzuwenden. Eigentlich, wenn man es recht bedachte, konnte es weit und breit keinen besseren Mann für seine Tochter geben. Und vielleicht – wer weiß – vielleicht würde eines Tages ein Wunder geschehen und James Elliot hier auftauchen, um dem Sohn die Hand zur Versöhnung zu reichen.
Man mußte vergessen können in diesem Land, wie in jedem anderen Land auch.
So beschlossen denn Barring und seine Frau, die Dinge noch ein wenig zu beobachten, ehe sie ihren Segen zu dem Wunsche ihrer einzigen Tochter gäben.
Aber Ann behielt ihr Geheimnis sonst für sich. Nur die Eltern waren eingeweiht. Roger selbst wußte noch nichts.
Eines Abends, als er wieder in der Nähe ihres Fensters wartete, tauchte eine Gestalt vor ihm auf.
Skinner!
Roger schnellte von dem Stein, auf dem er gesessen hatte, hoch.
»Was willst du?«
»Das gleiche, was du willst. Wir haben drei Möglichkeiten: Entweder wir würfeln, oder wir schießen, oder wir fragen Ann.«
Roger Elliot wandte sich ab.
»Du bist verrückt.«
»Keine Beleidigung, Boß. Du kennst mich noch nicht!«
»Es reicht mir.«
»Hör zu, ich habe den Eindruck, daß du etwas planst…«
Roger wirbelte herum. In seinen Augen funkelte es, und plötzlich sah sich Ric Skinner einer Revolvermündung gegenüber.
Damit hatte sich Roger Elliot selbst verraten. Und war jetzt auch nicht klug genug, sich geschickt aus dem Loch herauszureißen.
Skinner lachte leise in sich hinein.
»Du bist von der Nachbarranch, Brother. Ich weiß Bescheid, in der Stadt gibt’s flinke Mäuler. Ich habe da eine Menge gehört. Schon dein Alter hatte einen Gang mit Barring…«
Jetzt erst hatte Roger sich gefangen.
»Du bist schlecht informiert, Ric.«
»Glaube ich nicht. Du hast was vor, Boy. Und ich weiß auch was. Aber ich mache dir einen Vorschlag. Seien wir Partner. Ich bin auch nicht zufällig hier!«
Es klingelte noch immer nicht Alarm im Hirn Elliots.
»Was willst du von mir?«
»Ich die Frau, und du alles übrige.«
Roger begriff nicht.
»Was…«
»Stell dich nicht einfältiger, als du bist. Den beiden Hacatts glaube ich, daß sie treuherzig genug sind, aus Verzweiflung über die Verstoßung und den Fluch ihres Vaters hier für einen Schandlohn zu schuften…!«
»Barring kann gar nicht mehr zahlen. Die Ranch war noch vor zwei Monaten ganz unten…«
»Red nicht. Du schuftest hier nicht für fünfundzwanzig Bucks. Du hast einen Plan. Und ich kenne ihn längst!«
Roger dachte nicht daran, daß Skinner ja auch für fünfundzwanzig Bucks arbeitete.
Skinner hatte keinen festen Plan, als er kam – nur schlechte Vorsätze. Wie er sie überall gehabt hatte, wo er bisher seinen Fuß hingesetzt hatte. Hier ging es zwar rauh und derb zu, aber es winkte Gewinn.
Und dieser Roger liebte das Mädchen gar nicht. Er hatte zu haßerfüllte Augen.
Der Menschenkenner Skinner wußte es seit dem Tage, da er in der Stadt von der Fehde erfahren hatte, die seit einem Vierteljahrhundert zwischen den beiden Ranchhöfen schwelte.
»Du bist nicht schlau genug, Tex«, suchte Roger, der sich durchschaut fühlte, sich herauszuwinden.
Aber der Bandit hielt seinen Fisch fest.
»Mach mir nichts vor, Elliot, du bist durchschaut, und du wirst nur etwas, wenn wir teilen.«
»Was… teilen?«
»Du bist hier, um den Mann, der deinen Vater um ein Mädchen gebracht hat, zu vernichten. Für mich wird dabei eine Kleinigkeit abfallen, die Frau, die hübsche kleine Ann, mit dem, was übrigbleibt.«
»Wie stellst du dir das vor?«
»Laß es nur meine Sorge sein…«
So wurden die beiden ungleichen Männer Partner, ohne daß Roger Elliot es eigentlich gewünscht hatte.
Schon am nächsten Tag gab Skinner vor, nach Dillon zum Arzt zu müssen, da er Stiche links in der Brust habe. Er ritt aber statt dessen zur Eliott Ranch hinüber, wo er verlangte, sofort den Rancher zu sprechen.
James Elliot hörte den seltsamsten Monolog seines Lebens an.
»Ihr Sohn ist drüben bei uns. Er ist mein Partner, seit langem. Ich bin Ed Skinners Bruder. Wir haben Barrings Machenschaften erkannt und werden sie verhindern. Er plant Ihre völlige Vernichtung. Wenn Sie Augen im Kopf hätten, wüßten Sie es…«
Ric redete eine volle Stunde auf den verstörten Mann ein.
Elliot schüttelte immer wieder den Kopf.
Aber dann hatte sich der Angelhaken doch verfangen, und er ging den hinterhältigen Reden des Banditen auf den Leim.
Deshalb also Barrings Aufstieg! Er plante seine Vernichtung. Der alte Rivale mußte verrückt geworden sein.
»Na, ich werde ihn zurückwerfen, in seinen kleinen armseligen Creek hinein…«
Der Haß war geschürt.
Ric Skinner hätte nie gedacht, daß es so leicht sein würde.
Wäre Roger Elliot nur einmal auf den Gedanken gekommen, sein Pferd zu satteln, um heimzureiten, dann wäre alles noch verhindert worden.
Wie sich Skinner das ganze eigentlich vorgestellt hatte, wußte niemand. Er war übrigens nicht der Bruder des toten Desperados, der hatte gar keinen Bruder gehabt. Skinner, der zufällig den gleichen Namen trug wie der von Wyatt Earp gestellte Mörder, hatte sich die Story nur einfallen lassen, um einen schwarzen geheimnisvollen Nimbus um sich zu schaffen. Daß es ein negativer Nimbus war, störte ihn nicht. Bisher hatte er herausgefunden, daß ein negativer Nimbus größeren Wind machte als ein positiver.
Er war ganz einfach ein Bandit, ein Tramp. Mehrfach schon hatte er solche Machenschaften versucht, aber hier schien ihm der Boden besonders günstig dafür zu sein.
Wie Ric das Mädchen gewinnen wollte, wenn Elliot Barring niederrang, war Roger nicht klar, der nur erfahren hatte, daß der Texaner den Rancher Elliot getroffen und ihm erzählt hatte, daß Barring böse Reden über die Elliots im County in Umlauf gesetzt habe. Elliot habe darauf erklärt, daß er dies nicht schweigend hinnehmen werde.
Skinner gedachte im allerletzten Augenblick, wenn die beiden Titanen aufeinander losschlugen, den Beschützer des Mädchens zu spielen. Barring mußte bei diesem Streit fallen, und er wollte die Erbschaft des toten Ranchers antreten.
Ein düsterer, wahnwitziger Plan.
Roger Elliot wußte nicht wirklich, welche Rolle er dabei eigentlich spielte. Er merkte gar nicht, daß der Texaner die Führung in dem Spiel an sich gerissen hatte.
Er hatte sich an Barring rächen wollen. Und nun erfuhr Roger Elliot von Skinner, daß Barring größenwahnsinnig geworden sei. Überall im County ließe er Hetzreden gegen die Elliot Ranch los, die er »auffressen« wolle.
Wie konnte sich ein junger Mensch wie Roger Elliot nur so einnebeln lassen? Wie konnte er nur der Partner eines solchen Satans werden?
Der Kampf begann schneller, als alle Beteiligten es vermutet hätten.
Eines Nachts brannte die große Strohscheune der Barring Ranch nieder.
Roger war als erster draußen, da er gerade von einer Schwatzstunde unterm Fenster Anns zurückkam.
Zu seinem eisigen Entsetzen erkannte er in dem Reiter, der noch im Feuerschein hielt – den Vater.
Seinen eigenen Vater!
James Elliot ein Brandstifter!
Die Elliot Ranch war nicht mehr das, was sie noch zu Lebzeiten der drei anderen Söhne des Ranchers war. Elliot hatte viel Pech mit seinen Cowboys gehabt seitdem, Verlust beim Rinderverkauf, verstopfte Wassergräben und andere Dinge mehr, reine Zufälle, die er seit Skinners Besuch auf Barring zurückführte.
So war er auf die Nachbarranch gekommen, um allem ein Ende zu bereiten, ehe es erst begann.
Der Brand wurde gelöscht. Nur mit Mühe konnten die Barring-Leute verhindern, daß das Feuer auf die übrigen Holzbauten übergriff.
Skinner war es, der dem Rancher in einer Stallecke mitteilte: »Es waren die Leute von der Elliot Ranch. Ich habe zwei von ihnen, die ich häufig in der Stadt im Saloon gesehen habe, sofort im Feuerschein erkannt. Es ist Elliot, der Ihnen den Auftrieb nicht gönnt, der Sie lieber wieder im Elend sitzen sähe. Und er haßt Sie doppelt, weil Roger bei Ihnen arbeitet.«
Barring hatte zwar den Kopf geschüttelt, aber auch in seiner Seele saß der Stachel.
Als er dann am gleichen Tag in der Stadt James Elliot begegnete und der vor ihm ausspie, schien Barring alles glasklar zu sein. Nun glaubte er auch zu wissen, wer ihm den Abzweig in den Creek gebaut und damals den Präriebrand gelegt hatte.
Daß es Roger war, hätte er nie geglaubt.
Und nun begann der Kampf.
Roger sah mit düsteren Gefühlen den Dingen zu.
Bis eines Tages Ann auf ihn zutrat.
»Roger, was geschieht hier? Bitte, sagen Sie es mir. Weshalb bekämpft uns Ihr Vater? Wir haben ihm nichts getan!«
Der Cowboy sah Skinner auf sich zukommen, wollte nicht als Feigling gelten und wandte sich ab.
Das Mädchen sah ihm erschrocken nach. Sie dachte, er sei in Gewissensqualen wegen der Schandtaten seines Vaters.
Da erschien völlig unerwartet eines Morgens der halbblinde alte Hacatt auf dem Hof.
Bestürzt blickten ihm Hal und Owen entgegen.
Er ritt bis vor sie hin und sagte mit rauher Stimme: »Es war eure Sache, wohin ihr gegangen seid. Ich hatte euch verstoßen. Und ihr habt euch sauber gehalten, wie ich hörte. Aber wenn ihr Strolche jetzt gegen den Mann kämpfen wollt, dessen Söhne ihr fast ausgerottet habt, dann schieße ich euch vorher nieder.«
Betreten standen die beiden Cowboys da.
»Antwortet!« schrie Hacatt.
»Vater«, entgegnete Hal halblaut, »wir haben kein Recht, hier auf diesem Ranchhof zu brüllen. Es ist weder unser Hof noch die Mainstreet von Dillon.«
»Was… fällt dir ein!«
»Hal hat recht, Vater!« sagte Owen schroff.
»So, er hat recht. Ihr wollt also gegen Elliot kämpfen.«
»Wir wollen überhaupt nicht kämpfen, Vater. Aber Mister Barring ist unser Boß. Und wenn er von jemandem angegriffen wird, so ist es nur unsere Pflicht, für ihn zu kämpfen, wie es die Pflicht jedes Cowboys seinem Boß gegenüber ist. Wenn der Gegner jetzt unglücklicherweise Elliot heißt, ist das ein neuer Kampf, der mit dem Unsinn auf der Mainstreet in Dillon damals nichts zu tun hat.«
»Unglücklicherweise…, Unsinn…, nichts zu tun…, well! Ich werde euch etwas sagen. Ihr sagt euren Job auf und kommt mit.«
Es war Hal, der ältere, der jetzt den Kopf schüttelte und entschieden erklärte: »Nein, Vater, ein Cowboy ist kein Kalb, das man verkaufen und kein Sägebock, den man willkürlich hin und her schieben kann. Wir haben hier Lohn und Brot bekommen, der Rancher ist gut zu uns, und wir können ihn nicht mitten in der schwersten Arbeit verlassen.«
Hacatt senkte den Kopf. Er wäre kein Rancher gewesen, wenn er die Wahrheit dieser Worte nicht eingesehen hätte.
Mit finsterer Miene ritt er vom Hof.
James Barring hatte die Auseinandersetzung mit anhören müssen.
Er kam auf die beiden zu.
»Wir machen es kurz, Männer: Eure Zeit ist um. Ich brauche euch nicht mehr. Ihr bekommt den vollen Lohn für den Monat und reitet sofort. Euer Vater hat selbst Arbeit. Vorwärts.«
Hal schüttelte den Kopf.
Aber Barring blieb hart.
So ritten denn die beiden eine Stunde später mit ausdruckslosen Gesichtern davon.
Barring stand am Hoftor. Er sah sich um.
»Wo ist Roger?«
Der Cowboy war auf der Weide.
Als er am Abend kam, erklärte ihm Barring kurz: »Roger, Sie werden die Ranch verlassen. Es geht nicht, daß Sie auf einem Hof arbeiten, gegen den Ihr Vater glaubt kämpfen zu müssen…«
Auch Roger Elliot vermochte nichts gegen den Entschluß des Ranchers auszurichten. Mit verkniffenem Gesicht ritt er vom Hof.
Da sah der Rancher sich nach Skinner um.
»Und jetzt reiten Sie!«
»Ich…!« tat der Texaner erstaunt.
»Ja, Sie! Und zwar sofort.«
Der Ranchhof des Schotten James Barring lag wieder still und verlassen da.
Ein verzweifelter alter Mann hockte auf den Stufen zur Veranda und stierte vor sich hin.
»Ich wußte es: Ich habe kein Glück! Und jetzt geht es dem endgültigen Untergang entgegen…«
Barring meinte, daß er nicht noch einmal die Kraft haben würde, neu zu beginnen.
Es war aus.
Ein verblendeter Mann, der nur ein paar Meilen von ihm entfernt lebte, hatte ihm die Wahl der Frau, um die sie beide geworben, nach mehr als einem Vierteljahrhundert noch nicht vergeben können. So wenigstens glaubte Barring.
Daß der Verbrecher Richard Skinner diese teuflische Glut geschürt hatte, wußte er nicht.
*
Der Reiter hatte ein tiefgebräuntes Gesicht, harte blaue Augen und perlschwarzes Haar. Da er im Schatten einer Bergkiefernlichtung ritt, hatte er den Hut, einen schwarzen Stetson, abgenommen und übers Sattelhorn gestülpt.
Es war schwül an diesem Tag.
Der Reiter trug ein graues Kattunhemd, das oben am Hals offen stand und trotz seines nicht eben hochmodischen Schnittes die breitschultrige, kraftvolle Gestalt des Mannes nicht zu verbergen vermochte. Über der schwarzen Hose saß der Waffengurt aus starkem Büffelleder, der an jeder Seite einen schweren fünfundvierziger Revolver hielt.
Das Pferd, das er ritt, war ein hochbeiniger Schwarzfalbe von edelstem Blut.
Der Mann kam aus Dillon und hatte den alten Overlandweg nach Südosten genommen, der ihn direkt auf die Barring Ranch zuführte.
Mit finsterem Gesicht blickte der Schotte dem Fremden entgegen, der da in seinen Hof ritt.
»Was wollen Sie?« empfing er ihn unfreundlicher, als es sonst seine Art war.
Und was sonst auch nicht seine Art war: Er hatte sein Gewehr in der Hand.
Der Fremde kam bis auf fünf Yard heran und stieg dann vom Pferd.
»Ich wollte Sie fragen, Mister, ob Sie keinen Cowboy brauchen.«
»Einen Cowboy?« Er verzog bitter das Gesicht. »Das ist ein böser Hohn, Mister. Ich habe erst vor ein paar Tagen vier Cowboys weggeschickt. No, da wird nichts draus.«
»Kann ich dann wenigstens bei Ihnen übernachten?«
Barring warf einen kurzen Blick in den blauen Himmel.
»Übernachten? Meinetwegen.« Aber er verstand den Mann nicht. Es war gutes Wetter, weshalb übernachtete er nicht draußen in der Prärie?
Der Fremde nahm sein Pferd, sattelte es ab und führte es in den Corral.
Erst jetzt, als er das Tier quer über den ganzen Hof hinter sich her zog, sah sich Barring diesen Gaul genauer an.
Damned! Welch ein Pferd! ging es durch den Kopf des geplagten Ranchers. Er mußte sich eingestehen, bisher noch kein so hervorragendes Tier in dieser Gegend gesehen zu haben.
Wer mochte der Fremde sein? Ein Cowboy? Seiner Tracht nach zu schließen, mußte er ja ein Weidemann sein.
Nachdem der Fremde sein Tier in einen leeren Corral gebracht hatte, sah Barring, daß er hinüber zum Holzplatz ging, der eine Axt nahm und alsbald damit auf schwere Wurzelholzstöcke einschlug.
Barring ging ins Haus zurück. Ann stand hinter dem Küchenfenster.
»Wer ist der Mann, Vater?«
»Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht nach seinem Namen gefragt. Er wollte Arbeit.«
»Und?«
»Ich habe ihn abgewiesen.«
»Aber weshalb denn?« fragte das Mädchen vorwurfsvoll. »Wie willst du die Riesenabreit denn allein bewältigen!«
»Gar nicht! Ich kann sie nicht schaffen. Und mit noch einem Mann ist sie auch nicht zu bewältigen.«
»Das kannst du doch nicht sagen. Vielleicht ist es ein guter Cowboy.«
»Das hilft mir auch nichts. Ich bin ruiniert, völlig erledigt. Mich kann niemand mehr retten.«
Das Mädchen suchte den Vater zu trösten. Ann hatte ja selbst eine bittere Enttäuschung erlebt. War doch Roger Elliot gegangen, ohne noch ein einziges Wort mit ihr zu wechseln! Und sie hatte geglaubt, daß er sie liebe.
Sie konnte nicht ahnen, daß die Tatsache, daß ihr Vater Roger Elliot weggeschickt hatte, sie vor einer viel größeren, vielleicht nicht mehr gutzumachenden Enttäuschung bewahrt hatte.
Der Mann draußen hackte schwere Wurzelstöcke durch, daß die Späne flogen.
Die drei Menschen im Wohnhaus hörten ihn stundenlang arbeiten.
»Das ist aber einer von der eisernen Sorte«, sagte June Barring, als sie mit dem Wäschekorb hereinkam. »Den könnten wir schon gebrauchen, John.«
Der Rancher schüttelte den Kopf.
»Ich kann niemanden mehr gebrauchen, niemanden!«
Er war so niedergeschlagen, daß er einfach keinen Mut mehr zu fassen vermochte.
»Diesmal hat Elliot mich geschafft!«
Es wurde Abend.
Der fremde Cowboy, dessen Name die Barrings nicht einmal kannten, hatte einen gewaltigen Stapel Holz gehackt. Er war nirgends zu sehen.
»Wo ist er geblieben?« fragte June Barring ihre Tochter.
Das Mädchen ging hinaus – und als es zurückkam, stand sogar ein Lachen in seinem Gesicht.
»Er hat den linken Stallflügel ausgemistet; er muß für drei Männer gearbeitet haben.«
»Nein«, meinte die Mutter.
»Doch, und jetzt ist er auf der rechten Seite dran.«
Nach einer Dreiviertelstunde kam der Cowboy mit einem grauen Hengst in den Hof, den er striegelte und dann wieder wegbrachte. Danach kam er mit Barrings Braunem.
Als er auch das Tier gestriegelt hatte, stand Barring auf.
»Er wird doch nicht den Schimmel auch…«
Da kam er schon.
Es begann schon zu dunklen, aber man konnte deutlich sehen, daß der Fremde den Schimmelhengst, diesen gefährlichen Keiler, dessen Abschaffung der Rancher schon mehrmals erwogen hatte, durch die Stalltür führte.
Barring stürzte ans Fenster.
»He, Mister, sind Sie des Teufels! Der Hengst ist wild und…«
»Kann sein«, unterbrach ihn der Fremde, brachte das Tier unbekümmert in den Hof, schlang eine Kette in sein Doppelhalfter und band es an dem Eisenring fest.
Dann machte er sich ans Striegeln.
»John«, mahnte June Barring ihren Mann, »der Bursche ist völlig ahnungslos. Der Hengst wird ihn schlagen! Du mußt sofort hinaus.«
Aber John Barring rührte sich nicht vom Fleck. Gebannt beobachtete er den Fremden.
Damned, wie ging dieser Mann mit dem gefährlichen Keiler um, mit dem weißen Wildhengst, der bisher noch nach jedem ausgeschlagen hatte, der zu keiner nützlichen Arbeit auf der Ranch herangezogen werden konnte!
Es konnte keinen Zweifel geben, dieser Fremde war ein Horseman, wie er im Buche stand. Die absolute Sicherheit, mit der er mit dem großen Pferd umging, bewies dies eindeutig.
Als der Schimmel gestriegelt war, löste der Fremde die Kette, nahm einen Zügel und klemmte die beiden Karabinerhaken in die Trense.
Dann schwang er sich zur Bestürzung der beiden Frauen auf den Rücken des Pferdes.
»John!« schrie June Barring.
Der Alte regte sich nicht. Brennend hingen seine Augen an dem Reiter, der jetzt leicht nach vorn geneigt, fast wie ein Indianer, das Tier in Bewegung setzte.
Der Schimmelhengst ging zwei Schritte und blieb dann stehen.
Da beugte sich der Fremde noch weiter vor und legte seine Rechte in die Mähne.
Da begann der Schimmel loszutraben. Es schien so, als sei er völlig gebändigt.
Aber plötzlich schoß er vorwärts, bockte, rannte auf eine Scheunenwand zu und suchte seinen Reiter abzustreifen.
Damit allerdings hatte er kein Glück.
Der fremde Cowboy riß ihn auf der Hinterhand kurz vor der Mauer herum und preßte seine Schenkel mit eisernem, unwiderstehlichem Druck um den Tierkörper.
Der Hengst bog ab, trabte quer über den Hof und machte einen neuen Bocksprung, der ihm ebenfalls nichts einbrachte als einen schmerzhaften Schenkeldruck.
Wieder rannte er los, schoß Kapriolen, wirbelte herum, schlug wild nach allen Seiten aus – und vermochte doch nicht den Mann von seinem Rücken zu bringen.
Der Fremde saß auf dem Pferd, als sei er mit ihm verwachsen.
»Unfaßlich!« entfuhr es Barring.
Es war inzwischen so dunkel geworden, daß man eigentlich nur noch den Körper des weißen Pferdes erkennen konnte; der Reiter wirkte schon wie ein Phantom.
Und jetzt trabte der Schimmel sehr ruhig im Kreis durch den Hof. Runde um Runde.
Der Fremde hielt an und stieg ab.
Jetzt rechnete Barring mit einem Ausfall des Tieres. Doch der Hengst ließ sich ruhig in den Stall führen.
Gespannt beobachteten die drei Barrings, was weiter geschah.
Im Gerätehaus flammte Licht auf.
»Er hat die kleine Stallampe genommen«, sagte Ann leise.
Und nach einer halben Stunde machte sich Barring auf den Weg.
Die kleine Lampe hing am Haken im Gerätehaus, und der Fremde war nirgends zu sehen.
Dafür waren sämtliche Geräte gesäubert und standen ordentlich auf ihren Plätzen.
Da zog ein leichter Windstoß die Tür zum anschließenden Strohhaus auf. Ritsch, ritsch! drang es an das Ohr des Ranchers.
John Barring schüttelte den Kopf und ging ins Wohnhaus zurück, wo er sich in seinen Schaukelstuhl fallen ließ.
»Schläft er?« forschte Ann.
»Kein Gedanke. Nachdem er die ganzen Gerätschaften gesäubert hat, ist er beim Strohschneiden.«
»Was? Im Dunkeln?«
»Nicht ganz, die Tür vom Gerätehaus wirft einen Lichtschimmer zu ihm hinein, der ihm offenbar genügt. Immerhin war er zu vorsichtig, die Lampe mit ins Strohhaus zu nehmen.«
»Wird der denn überhaupt nicht müde?«
Der Rancher zog die Schultern hoch. Er hatte andere Sorgen, als über diesen seltsamen Cowboy nachzudenken.
Er scheint tatsächlich für drei zu arbeiten, der Fremde. Die Barrings konnten es erleben.
Wann er am nächsten Tag aufgestanden war, wußte niemand. Jedenfalls waren um die Frühstückszeit schon die Corralpferde versorgt, die Stallpferde, die Kühe, die direkt zum Hof gehörten, und die Hühner waren auch schon draußen.
Als Ann ihnen Futter geben wollte, kam das Federvieh nicht herangefegt wie sonst, und das Mädchen stellte zu seiner Verwunderung fest, daß auch sie schon gefüttert waren.
Fassungslos stand sie im Hof und hielt Ausschau nach dem Cowboy, der offenbar zaubern konnte.
Er war nirgends zu sehen.
Der Rancher kam aus dem Wagenschuppen zurück.
»Wolltest du nicht einen Reifen aufziehen, Dad?« fragte Ann.
Barring winkte ab.
»Er ist aufgezogen, und alle Naben sind geölt. Die Sättel blank, als wären sie neu, und alle Krippen gefüllt. Der Bursche ist mir unheimlich.«
»Wo steckt er?«
»Keine Ahnung.«
»Vielleicht ist er schon weg?«
Barring schüttelte den Kopf.
»O nein, weg ist er nicht, denn sein Falbhengst weidet noch in unserem Corral, und so ein Pferd läßt niemand zurück.«
Sie suchten ihn gemeinsam und fanden ihn nicht.
Gegen halb elf ritt er plötzlich von Westen her in den Hof.
Auf dem Schimmel. Er hatte das Tier zwar nicht gesattelt, kam aber damit an, als hätte er nie auf einem anderen Pferd gesessen, und schob es in den Corral zu seinem Braunen.
»Das riskieren Sie bloß nicht«, rief der Rancher mahnend. »Wenn er Ihren teuren Gaul tritt, komme ich für nichts auf.«
Der Fremde lachte ihn entwaffnend an und entblößte dabei eine Doppelreihe blendendweißer, ebenmäßig gewachsener Zähne.
»Das sollte er nicht riskieren. Und er wird es auch nicht.«
Barring rieb sich das Kinn und beobachtete mit Sorge die beiden Hengste in dem kleinen Corral.
Der Fremde wandte sich unbesorgt ab und schleppte zwei Milchkannen vom Kuhstall zur Veranda.
»Übrigens, der Creek ist trocken, und Ihre Rinder waren teilweise auf das westliche Nachbarland abgewandert.«
Barring griff sich an den Kopf.
Das mit dem Creek, das erschütterte ihn nicht mehr. Er hatte damit gerechnet. Aber die Rinder! Wenn sie auf Elliots Land abtrieben, waren sie vogelfrei.
Der Fremde zündete sich eine große schwarze Zigarre an und hielt auch dem Rancher die Ledertasche hin, in der noch zwei Zigarren steckten.
»Nein. Sagen Sie, stehen die Rinder auf dem westlichen Ufer, oder sind sie schon den Hang hinaufgezogen?«
»Sie waren schon darüber hinweg.«
»Aber dann muß ich ja sofort…«
»Bleiben Sie nur, ich habe sie eingebracht.«
»Sie – allein?«
»Es blieb mir kaum etwas anderes übrig, da ich mich nicht gut teilen konnte.«
»Ja, aber die Boys von drüben… War denn niemand zu sehen?«
»Doch, zwei nette Burschen.«
»Na und?« fragte der Rancher entgeistert. Das mußten doch Elliots Leute gewesen sein.
»Wir haben uns ausgesprochen, und dann war alles klar.«
»Ausgesprochen…? Alles klar?« Nun begriff Barring nichts mehr.
Ann stand kopfschüttelnd dabei. Vorhin, als der Vater gesagt hatte, der Mann sei ihm unheimlich, hatte sie noch gedacht: mir nicht. Aber jetzt war er ihr auch unheimlich geworden.
Da sprengten drei Reiter in den Hof. James Elliot und zwei Cowboys.
Die beiden Cowboys hatten ziemlich demolierte Gesichter.
Elliot hielt zehn Yards vor der Veranda an und brüllte mit wutverzerrtem Gesicht: »Barring, das geht schief! Das schwöre ich Ihnen! Sie haben offenbar Banditen angeworben! Ihre Rinder waren auf meiner Weide, und da hat sie einer Ihrer Bluthunde zurückgeholt. Dabei hat er zwei meiner Leute derart verprügelt, daß sie mir nur winselnd Bericht zu erstatten vermochten. Ich war zufällig auf dem Vorwerk hinter dem Creek, sonst wäre ich noch nicht hier.«
»Sie waren nicht zufällig auf dem Vorwerk, Elliot, sondern Sie sind schon seit gestern da!« unterbrach ihn der Fremde.
Elliot warf beide Arme hoch und brüllte: »Barring! Ich fordere Sie hiermit auf, diesen Ban…«
Er brach jäh ab, denn der Fremde hatte mehrere Schritte auf ihn zu gemacht und blieb jetzt stehen. Scharf durchforschte er das Gesicht des Viehzüchters. Dann fragte er über die Schulter zurück: »Sagen Sie es mir, Rancher, wenn Ihnen dieser Schreihals auf die Nerven geht.«
Elliot war so verblüfft, daß seine Arme runtersanken und er nur fassungslos auf den Fremden stierte.
Der zog die Brauen zusammen.
»Haben Sie sonst noch Wünsche, Elliot? Nicht? Wollte ich Ihnen auch geraten haben. Wir lieben diese Brüllerei nicht. Wenden Sie Ihr Pferd und danken Sie Gott, daß ich Ihre Beleidigungen überhört habe.«
Elliot hatte seine Fassung wiedergewonnen.
»Hören Sie, Mann«, keuchte er heiser, »ich weiß gar nicht, wer Sie sind. Aber lassen Sie sich eines gesagt sein: Sie schaffen mich nicht.«
»Ich hatte diese Absicht bisher auch nicht, Elliot. Aber wenn Sie es darauf anlegen, mich näher kennenzulernen, soll es mir recht sein.«
»Sie haben diesen Mann da niedergeschlagen, und der andere hat ein blaues Auge. Eine solche rüde…«
»Vorsicht, Elliot, nicht vorschnell urteilen. Der Junge da hinter Ihnen, der jetzt angestrengt auf seine unsauberen Hände sieht, fiel mich an wie ein Wilder. Er ließ mich nicht zu Wort kommen, und da habe ich ihm eins auf die Nase gegeben. Der andere, der sich jetzt hinter Ihnen versteckt, war so dumm, den Revolver zu ziehen. Wissen Sie, solche Scherze liebe ich bei der Arbeit nicht. Und ich war bei der Arbeit, Elliot. Ein gewissenloser Bursche, den ich auch noch finden werde, hat nämlich einen Abzweig in den Creek gebaut. Deshalb sind die Tiere auf das Westufer gewandert. Ich habe sie zurückgeholt. Hoffentlich hatten Sie nichts dagegen.«
Elliot starrte den Mann fassungslos an.
Dann wandte er mit einem Ruck das Pferd, ritt, gefolgt von seinen Leuten, zum Tor, hielt da wieder an und brüllte drohend: »Das schwöre ich dir, Barring, du wirst wimmern! Wimmern wirst…«
Da fauchte ein Revolverschuß über den Hof.
Auf eine solche Distanz hatte weder John Barring noch James Elliot je einen Revolverschuß erlebt.
Er kam aus seinem großen Buntline Special mit sechskantigem Lauf, den der Fremde in der linken Faust hielt, und die Kugel stieß dem Rancher Elliot den Hut vom Kopf.
Gelähmt vor namenloser Verwunderung blickte Elliot auf den Fremden.
Das war einfach zuviel für ihn.
Der Fremde lud gelassen die verschossene Patrone nach, und bei dieser Beschäftigung behielt er die drei Reiter im Auge und rief: »Verschwindet! Wenn noch einmal einer von euch hier ungebeten auftaucht, gibt’s Kattun.«
»Barring!« röhrte Elliot heiser. »Das wer…«
»Sie sollen verschwinden!« fegte der Fremde mit metallischer Stimme entgegen.
Da trabten die drei Reiter aus dem Hof.
Der seltsame Cowboy schob den Colt ins Halfter zurück und nahm die Zigarre wieder auf, die er solange auf die metallbeschlagene Verandakante gelegt hatte.
»Das nennen Sie: Wir haben uns ausgesprochen, Mann?« krächzte Barring.
»Na, wer wird denn aus dieser kleinen Geschichte gleich einen Wirbel machen. –?Übrigens, Mister Barring, wollen Sie in die Berge hinaufreiten, oder soll ich es tun? Da oben muß irgendwo ein Abzweig sein. Und er muß heute noch verschwinden.«
Barring musterte den Mann kopfschüttelnd.
»Wer sind Sie eigentlich?
»Das wollte ich Ihnen gestern schon sagen, Rancher, aber Sie hatten ja kein Interesse daran.«
»Nein, ich habe es auch jetzt nicht. Sie meinen es gut, Mister. Und ich kann Ihnen bescheinigen, daß Sie ein großartiger Cowboy, ein handfester, sehr selbstsicherer Weidemann sind. Aber es hilft mir in meiner Lage, die Sie nicht kennen können, gar nichts…!«
»Wer sagt, daß ich Ihre Lage nicht kenne?«
»Ich. Sonst hätten Sie sich gehütet, ausgerechnet hierher zu kommen.«
Ann hatte den Fremden schärfer betrachtet.
»Doch, Vater, er weiß etwas. Und mehr als wir ahnen. Woher kannte er Elliots Namen? Und woher wußte er, daß Elliot sich schon seit gestern drüben bei seiner Vorwerkhütte aufhält?«
Der Fremde schickte dem Mädchen einen anerkennenden Blick zu.
»Die Sache ist nicht geheimnisvoll, Miß. Ich kam durch Dillon, und da haben die Leute offenbar nur ein Thema. Ich erfuhr genug, um niemandem noch eine Frage stellen zu müssen.«
»Und… da sind Sie trotzdem zu mir herausgeritten?« fragte Barring verdutzt.
»Weshalb nicht? Einer, der droht und schlägt und stark ist, braucht wahrscheinlich keine Leute und ist nicht mein Fall. Ich dachte mir, daß ich hier am Platze bin.«
Barring nickte. »So, das dachten Sie. Hm. Ja, am Platze scheinen Sie ja zu sein, und vor allem fragen Sie ja nicht viel.«
»Wer viel fragt, bekommt viel Antwort, sagte mein Vater immer.«
»Sie müssen einen klugen Vater gehabt haben.«
»Doch, sicher. – Wie sieht’s nun aus, soll ich in die Berge reiten?«
»Nein, ich reite selbst. Sie müßten die Stelle erst suchen, und ich kenne sie schon.«
»Das heißt, daß dieser wohlmeinende Mensch den Abzweig schon öfter in den Creek gesetzt hat?«
»Ja, genau das.« Barring sah den Fremden nachdenklich an. »Sie sind ein ziemlich harter Brocken, Mister…«
»Earp.«
»Earp«, wiederholte der Rancher, ohne näher auf den Namen zu achten, den ihm dieser sonderbare Cowboy da genannt hatte. »Aber es hilft nichts, so gern ich einen so nützlichen Mann wie Sie hier gehabt hätte – ich kann Sie nicht brauchen.«
»Brauchen bestimmt«, gab der Fremde zurück.
»Ja, aber nicht bezahlen.«
»Hören Sie, Rancher, wenn die beiden Hacatts und Roger Elliot für fünfundzwanzig Dollar hier gerackert haben, dann werde ich nicht mehr verlangen.«
»Nicht mehr? Mann, Sie sind doch ein Vormanntyp, ein Klasse-Cowboy, den man selbst mit vierzig Bucks noch beleidigt.«
»Kann sein, aber ich habe so meine Ticks, Rancher. Und diesmal stehe ich auf fünfundzwanzig.«
Barring schüttelte stumm den Kopf, ging sein Pferd holen und ritt davon.
Als er zurückkam, war der Cowboy nirgends zu sehen.
Fast enttäuscht wandte sich John Barring dem Hause zu.
Ann kam ihm entgegen.
»Ist alles wieder in Ordnung, Vater?«
»Ja, aber ich habe oben vom Fuß der Berge aus gesehen, daß sich drüben auf Elliots Weiden irgend etwas tut. Deshalb habe ich meinen Gaul in den Schweiß gebracht, so bin ich gejagt. Jetzt tut es mir leid, daß ich den Mann weggeschickt habe.«
»Wen?«
»Diesen eigenartigen Earp, oder wie er sich nannte. Hatte den richtigen Nerv für unsere Situation. Drüben rottet sich etwas zusammen. Ich habe mehrere Reiter bemerkt und wette, daß sie auf unseren Hof zuhalten.«
»Vater!« entfuhr es dem Mädchen erschrocken. »Ich werde ihn holen.«
»Wen?«
»Den Fremden.«
»Wieso? Ist er denn noch hier?«
»Ja. Er hat erst drei neue Latten drüben in den Corral gesetzt, die der weiße Hengst zerschlagen hatte: Der ist übrigens jetzt wirklich lammfromm, vor allem, seit ihm der Falbe einen derben Tritt gegeben hat, den er nicht so leicht vergißt.«
»Einen Tritt?« fragte der Rancher bestürzt. »Wer… wem?«
»Der Falbe unserem Satan.«
»Und der Mann, wo steckt der?«
»Ich glaube, er ist jetzt auf der Weide. Genau weiß ich es nicht. Er hat mir zwei Wäschepfähle hinten auf der Bleichwiese gesetzt und dann eine Stunde oben am Scheunendach gearbeitet, oben am First, wo du die beiden neuen hellen Latten siehst. Und dann ritt er weg.«
»Mit dem Schimmel?«
Ann schüttelte den Kopf.
»Nein, mit seinem Pferd.«
»Dann kommt er wohl nicht mehr zurück.«
Barring wandte sich hastig um.
Es war ihm, als höre er in der Ferne den dumpfen Hufschlag von Pferden. Aber es war nur die Sorge, die ihm dieses Geräusch vorgaukelte.
»Schließ das Tor ab. Ich werde die Luken der Ställe schließen und die Palisadenpforte hinten…«
Da trat die Frau des Ranchers auf die Veranda.
»Nein, John. Das werden wir nicht tun. Wir haben gar keinen Grund dazu.«
Barring blickte zu seiner Frau auf.
»Well, einen Grund haben wir nicht. Und wenn man seine Tore verschließt, greift man an, hat General Grant gesagt.«
Sie brauchten nicht sehr lange zu warten.
Ann, die oben durch eine Dachluke das Gelände nach Westen hinaus beobachtete, rief schon nach einer Viertelstunde: »Ich sehe sie kommen, Vater. Es sind mehrere Reiter. Fünf, sechs, sieben!«
Sieben Reiter!
Er kommt also mit einer gewaltigen Verstärkung zurück, der verbissene James Elliot, dachte der Schotte verzweifelt. Jetzt wird er sich für die Schlappe in der Frühe rächen…
Ann hatte ihren Beobachtungsposten aufgegeben und stand jetzt hinter der Gardine des hochgeschobenen Küchenfensters, die Winchester schußbereit in der Hand.
Ihre Mutter stand mit bleichem, aber gefaßtem Gesicht hinter ihr.
John Barring stand mitten im Hof.
Dann kamen sie. Zu fünft.
Also hatten sich zwei von dem Trupp abgesondert. Ein böses Zeichen. Diese beiden Reiter umritten wahrscheinlich die Ranch mit der Absicht, von irgendeiner Seite über die leider nicht allzuhohe Fenz in den Hof zu dringen.
Elliot hatte wieder die beiden Männer von heute morgen bei sich, einen bärtigen Burschen mit wildem Aussehen – und Ric Skinner.
Wie ein Fürst zügelte er sein Pferd sieben Yard vor Barring, stemmte die Linke in die Hüfte und sah sich um, als sei er auf diesem Ranchhof bereits der Herr.
Stumm verharrten seine Männer in Linie hinter ihm.
Eine halbe Minute kroch über den in schwüler Hitze liegenden Hof. Grauviolett hatte sich der Abendhimmel gefärbt, und nicht der leiseste Windhauch fächelte Kühlung.
Da schnarrte Eliot endlich: »Wo ist er?«
»Von wem sprichst du, James?«
»Nennen Sie mich nicht James, Barring. Ich bin für Sie, für einen so hinterhältigen Kerl, der obendrein Banditen beschäftigt, Mister Elliot.«
»Ich warne dich, James. Du treibst es zu weit!«
Elliots Gesicht verfinsterte sich. Hektische Flecken brannten auf seinen Wangen und seiner Stirn.
»Ich habe gefragt: Wo ist er?«
»Wer?«
»Der Bandit, der meine Leute angefallen hat und…«
»Ich habe keine Banditen auf meiner Ranch!« empörte sich Barring. »Und jetzt ersuche ich dich, meinen Hof zu verlassen, James. Ich habe keine Zeit, mich mit dir herumzuplagen.«
»Keine Zeit?« höhnte der Viehzüchter, der einmal mit dem Mann, den er jetzt vernichten wollte, so eng befreundet war. »Nein, viel Zeit hast du allerdings nicht mehr, das ist schon richtig. Und jetzt spuck aus, ehe ich dich züchtigen lasse: Wo ist der großmäulige Bursche?«
Da machte Barring bebend vor Zorn ein paar Schritte vorwärts.
»Was fällt dir ein, Elliot! Wie redest du mit mir? Wie wagst du dich hier aufzuführen? Du redest von Hinterhältigkeit und von Banditen und übersiehst dabei ganz, wie du dich aufführst!«
»Was?« kreischte der verblendete Viehzüchter außer sich vor Zorn. »Willst du Halunke etwa damit gesagt haben, daß ich mich wie ein Bandit benehme?«
»Es fehlt nicht mehr sehr viel daran«, schlug Barring rauh zurück.
»So?!« Elliot wandte sich im Sattel um.
»Morbat! Vorwärts, Sie kennen meinen Befehl. Packen Sie diesen Burschen, der unser Land schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert vergiftet, und fesseln Sie ihn!«
Der Cowboy Slim Morbat, jener Mann, der von dem Cowboy Earp in der Morgenfrühe dieses Tages mit einem schweren Rechtshänder von den Beinen geholt war, rutschte mit hölzernen Bewegungen aus dem Sattel, nahm sein Lasso und ging auf den Schotten zu.
»Das wirst du nicht wagen!« rief Barring mit bebender Stimme, wobei er keinen Blick von Elliot ließ.
»Doch, Barring, und ob ich es wagen werde. Ich werde noch mehr wagen, nämlich einen Strolch, der mich vernichten wollte, aufzuknüpfen! Damit es endlich Ruhe im County gibt. – Morbat, tun Sie, was ich Ihnen befohlen habe!«
Schon klang Schwirren in der Luft.
Gleich darauf schwebte die Schlinge einer Lassoleine über dem Kopf Morbats, aber nur für den Bruchteil einer Sekunde, dann fiel sie und zog sich mit einem harten Ruck um Oberkörper und Arme des Cowboys.
Die fünf Eindringlinge fuhren herum.
James Elliot sah hinter dem Waschhaus, das ein Stück in den Hof vorsprang, einen Reiter.
Es war der fremde Cowboy mit seinem Falbhengst.
»Da!« brüllte Elliot, während er mit der ausgestreckten Rechten auf ihn deutete. »Das ist er! Los, packt ihn!«
Der Fremde stieg vom Pferd, dachte aber gar nicht daran, Morbat freizugeben. Als der versuchte, die Schlinge zu lösen, wich der Hengst zur Seite aus, und da das Lasso am Sattelknauf befestigt war, zog sich die Schlinge nur noch enger zu.
Langsam kam der Cowboy Earp in den Hof, ging auf Morbat zu und nahm ihm den Revolver aus dem Halfter und warf ihn auf den Vorbau.
Aber das tat er gewissermaßen mit der Linken, so nebenbei, denn er ließ Elliot und die anderen nicht aus den Augen.
»Sie sind ja schon wieder da, Elliot«, rief er dem Rancher zu. »Ich werde das Gefühl nicht los, daß es Ihnen hier gut gefällt. Leider haben wir gar keine Zeit. In zehn Minuten wird gefüttert.«
»Hier wird nichts mehr gefüttert, Bursche. Und du bist der erste, dem ich es beibringen werde! Skinner! Gerben Sie ihm das Fell!«
Der Tex schwang sich schnell aus dem Sattel und kam geduckt auf den Cowboy zu.
Drei Schritte vor ihm blieb Skinner jedoch stehen. Irgend etwas in dem Blick des Fremden bannte ihn. So warf er den Kopf herum und blickte seinen neuen Boß an.
»Was soll mit ihm geschehen, Boß?«
»Mach ihn fertig, diesen Strolch!« schrie Elliot in rasender Wut.
Da hechtete der texanische Tramp doch noch dem Fremden entgegen, wurde aber von einem krachenden rechten Schwinger empfangen und schwer durchgeschüttelt.
Richard Skinner indessen war ein schwerer und gefährlicher Schläger, der auch eine Menge einzustecken vermochte.
Der Fremde ließ dem Rechtshänder eine rammende linke Gerade folgen, fing zwei wilde Heumacher Skinners ab, blockte einen rechten Haken weg und wuchtete dem Banditen dann einen fürchterlichen Uppercut unter die Kinnlade, die dem Mann die Füße vom Boden zu heben schien.
Wie ein nasser Sack fiel der Tramp nach hinten und blieb mit weit ausgestreckten Armen und Beinen liegen.
Als sei nicht das mindeste geschehen, wandte sich der Fremde an Elliot.
»Was sagten Sie noch, Mister?«
Der zog sein Pferd ein paar Schritte zurück und giftete: »Harms! Webster! Was gafft ihr so? Er will mich angreifen! Es ist eure Pflicht, ihn niederzuschießen!«
Da griffen die beiden Cowboys zu den Revolvern.
Und gerade das hätten sie nicht tun dürfen.
Sie hatten ihre Waffen noch nicht ganz aus den Halftern, da peitschten zwei brüllende Schüsse über den Hof.
Sie kamen aus dem großen Revolver mit dem überlangen, sechskantigen Lauf, den der Cowboy Earp in seiner Linken hielt.
Die Colts von Harms und Webster lagen auf dem Hof.
Webster blutete an der Hand. Harms war unversehrt.
Elliots Pferd tänzelte noch weiter zurück. Die Augen des Viehzüchters tasteten den Hof ab.
Plötzlich schrie er mit weithin schallender Stimme: »Flerges! Pulk! Vorwärts, worauf wartet ihr denn noch!«
Da brach von den Lippen des seltsamen Cowboys Earp ein rauhes Lachen. Er wandte sich ab, während er seinen Colt wieder auflud und verschwand hinterm Küchenhaus.
Es dauerte nicht lange, da kam er zurück. Mit jeder Hand schleppte er einen gefesselten Menschen in den Hof, die er bei Skinner fallen ließ.
»Sollten Sie sich die Kehle nach diesen beiden Schurken heisergeschrien haben, Elliot? Ich wollte sie schon in die Wurst machen. Aber wenn sie zu Ihren Strolchen gehören, dann rate ich Ihnen, sie mitzunehmen.
Und… Augenblick noch, Elliot, nicht so hastig. Damit wir uns richtig verstehen: Ich habe gesagt, daß wir keine Zeit haben, weil in zehn Minuten gefüttert werden muß. Wenn Sie den Einfall haben sollten, noch einmal zurückzukommen, ist unser freundschaftlicher Umgang zu Ende. Dann wird gnadenlos geschossen. Und jetzt dampfen Sie ab!«
Skinner rappelte sich eben hoch und wankte auf den Fremden zu, da packte der ihn am Kragen und bugsierte ihn zu seinem Pferd.
»Los, Boy, steig auf!«
Skinner stellte sich benommener, als er war.
Er hing kaum im Sattel, als er auch schon mit der dem Fremden abgewandten Hand den Revolver zog und plötzlich nach vorn stieß.
Aber der texanische Landstreicher war nicht schnell genug.
Der seltsame Cowboy hatte schon seinen Fuß gepackt und ihn aus dem Sattel gerissen. Ein Faustschlag beförderte den Colt Skinners bis zum Brunnen hinüber.
Webster, der damit beschäftigt gewesen war, Pulk und Flerges von ihren Fesseln zu befreien, war ein hinterhältiger Bursche, der seine Sekunde für gekommen hielt.
Auch er glaubte, unbemerkt zum Colt greifen zu können, als der fremde Cowboy aus der Halbdrehung von der Hüfte her mit der Linken feuerte.
Websters rechter Unterarm bekam einen schweren Preller. Der Getroffene brüllte auf.
»Ich habe gesagt: Wir müssen füttern und haben keine Zeit mehr. Runter vom Hof!«
Jetzt trollten sie sich und konnten plötzlich alle laufen, schwangen sich auf ihre Gäule und galoppierten aus dem Hof.
Nur Skinner nicht. Er kauerte am Boden und maß den Fremden mit lauerndem Blick.
»Falls es dir einfallen sollte, Tramp, das Messer aus dem Sattelschaft zu ziehen, hast du ausgesorgt und liegst in einer halben Stunde fünf Fuß tief unter der Erde!« rief ihm der Cowboy mit schneidender Stimme zu.
Skinner hatte tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, sein Wurfmesser, das er heimlich im Stiefelschaft trug, zu ziehen.
Wie mochte es der Fremde entdeckt haben?
Er kam nicht auf den Gedanken, daß der Cowboy es schon entdeckt hatte, als er auf ihn zugekommen war, um ihn zu schlagen.
Mit wutverzerrter Fratze zog sich der Texaner auf seinen Gaul und ritt sehr langsam vom Hof.
Als er das offene Tor erreicht hatte, hob er noch einmal drohend die Faust. Dann sprengte er davon.
War der Fremde dem Schotten schon vorher seltsam und fast unheimlich gewesen, so vermochte Barring sich jetzt überhaupt kein Bild mehr von ihm zu machen.
Bisher hatte er ihn für einen besonders tüchtigen Cowboy gehalten, um den sich die Rancher reißen würden, weil er so unerhört schnell, fleißig, sauber und überlegt arbeitete.
Aber was er jetzt demonstriert hatte, ließ den Alten denn doch bedenklich dreinschauen. Der Fremde schoß ja wie der Teufel!
Das war nun wirklich unheimlich.
»Blicken Sie nicht so düster drein, Rancher, es ging nicht anders«, sagte der Cowboy Earp, während er das Lasso aufrollte, seinen Falben absattelte und das Tier in den Corral brachte.
Als er zurückkam, stand Ann Barring neben ihrem Vater auf der letzten Stufe der Verandatreppe.
»Da mein Vater anscheinend kein Wort des Dankes über seine Lippen bringen kann, Mister, will ich es für ihn tun. Aber, um ehrlich zu sein: So etwas haben wir hier noch nicht erlebt. Sie sind ein ausgesucht fleißiger und umsichter Cowboy, und wir müßten verrückt sein, wenn wir Sie nicht behalten wollten.«
»Wir können ihn gar nicht behalten«, fiel der Rancher dumpf ein.
»Well«, meinte das Mädchen, »aber wir sind ihm zu Dank verpflichtet, Vater, und…«
»Ich weiß, Elliot ist verrückt geworden. Aber er hätte es bestimmt nicht zum Äußersten kommen lassen.«
»Da bin ich anderer Ansicht«, entgegnete der Fremde. »Und was die Arbeit auf dem Hof angeht, die kann jeder ordentliche Cowboy ebenso verrichten. Falls Sie die Bande da unterschätzen, sind Sie allerdings auf dem Holzweg. Mag Elliot vielleicht nur verblendet vor Ärger sein, so kann er doch in seiner Verblendung großen Schaden anrichten. Und sind die Boys, die er bei sich hatte, auch nicht allzu wild – dieser Skinner ist ein höchst gefährlicher, schneller Bursche.«
Danach wandte er sich ab und ging zum Stallhaus.
Die zehn Minuten waren um, und es mußte gefüttert werden.
Ann kam ihm sofort nach, während der Rancher sich erst einen Schluck Whisky genehmigen mußte, um den überstandenen Schrecken hinunterzuspülen.
Das Mädchen half dem fremden Cowboy bei der Arbeit.
Als der Rancher dazukam, meinte der Cowboy: »Es ist gleich erledigt, Mister Barring. Sie könnten mal nach dem Huf des Grauen sehen, ich glaube vorn links wird’s dünn.«
»Was…«
Barring verließ das Stallhaus.
Kurz darauf erschien er wieder in der Tür.
»Sie haben recht. Er braucht einen neuen Huf. Das ist so ziemlich das einzige, was wir hier leider nicht machen können.«
»Machen wir gleich«, sagte der Fremde.
Und dann konnten die Barrings erleben, wie der Fremde im sinkenden Licht des Tages mit einer Geschicklichkeit ohnegleichen dem Lieblingstier des Ranchers einen tadellosen Huf aufschlug.
Das Werkzeug, das er dazu benutzen konnte, war etwas primitiv, denn es stammte noch von einem Mann, der vor vielen Jahren hier vorbeigekommen war, eine Nacht im Hof verbrachte – und am anderen Morgen tot im Stroh gelegen hatte. Die Schmiedesachen hatte er auf einem kleinen Wagen bei sich gehabt.
Es war dunkel geworden. Auf dem Hof der Barring Ranch war es still.
Ann stand am Brunnen und spannte ihre Hände um den Griff des Wassereimers.
Der Fremde saß drüben auf der untersten Stufe der Verandatreppe und blickte über den Hof.
Ann hatte sich die ganze Zeit vorgenommen, etwas zu sagen, aber sie fand einfach nicht den Mut dazu, obgleich sie sonst absolut nicht schüchtern war.
»Mister…«
»Earp.«
»Mister Earp«, wiederholte auch sie, ohne über den Namen des Mannes zu stolpern, »es sind schlechte Dinge geschehen hier im County. Und das seit langem.«
Sie glaubte ihm erklären zu müssen, wieso ihr Vater in ein solches Mißgeschick geraten sei, aber der Cowboy winkte ab.
»Ich weiß von den Dingen, Miß Barring.«
Ann ließ den Eimer stehen und kam näher.
»Es war nicht gut, seit dem Tage, an dem meine Mutter dem Vater ihre Hand gegeben hatte. Aber Schlimmes geschah erst seit jenem Unglückstag, als sich oben in Dillon dieser schreckliche Revolverkampf abspielte. Seitdem ist hier im County alles wie verhext. Wir haben gar nichts damit zu tun gehabt. Im Gegenteil, die Leute in der Stadt können Ihnen sagen, daß mein Vater den unsinnigen Kampf aufhalten wollte, wenn es ihm leider auch nicht gelang.«
»Er hat gehandelt, wie ein richtiger Mann handeln sollte. Vielleicht hätten ohne ihn nicht vier, sondern noch mehr Tote auf der Mainstreet gelegen.«
Ann nickte.
»Das ist richtig. Aber manchmal denke ich, daß er gar nichts hätte tun sollen. Denn seit dieser Zeit geht nichts mehr gut. Die Männer, die hier arbeiteten, gehörten den Ranches an, die sich in Dillon an jenem Julitag gegenüberstanden. Es war absurd – aber sie arbeiteten hier zusammen. Und Roger Elliot…« Sie senkte den Kopf. »Ich glaubte, er…, vielleicht meinte er es ja doch ehrlich. Aber er ging davon ohne ein Wort. Wie die andern. Und seitdem bekämpft Elliot meinen Vater, und niemand weiß warum.«
»Haben Sie diesen Skinner eigentlich früher schon einmal gesehen?« fragte der Cowboy Earp unvermittelt.
»Er war bei uns auf der Ranch, eine ganze Zeit, das heißt…«
»Nein, ich meine noch früher. Vorher?«
Ann schüttelte den Kopf.
»Nein, er kam damals und blieb. Aber er ist kein guter Mann. Wir wußten es. Seit ich gesehen habe, daß er den kleinen Hund vor Hillers Bar in Dillon getreten hat – ich habe es zufällig beobachtet – er wußte gar nicht, daß ich auch in der Stadt war – seitdem wußte ich, daß er nicht gut ist.«
Der Fremde schwieg.
So sagte Ann: »Vielleicht ist ja nun alles vorüber. Aber selbst wenn es so wäre: Vater hat keinen Mut mehr, und vielleicht auch keine Kraft mehr, noch einmal von vorn zu beginnen. Sie brechen ihm immer wieder den Creek ab, dann brannte es hier – und jetzt kommen sie schon auf den Hof geritten, um ihn zu bedrohen. Glauben Sie, daß es vorüber ist?«
»Nein, Miß. Das glaube ich nicht. Elliot ist noch krank und wird nicht nachgeben.«
»Auf die Dauer kann ihn niemand halten! Wenn er will, wirft er uns leicht an die Erde. Er ist reich, und wir sind arm. Er kann sich so viel Hilfe leisten, wie er will. Wir sind froh, wenn wir leben und durchkommen können.«
»Ich weiß.«
Ann blickte in das dunkle Gesicht des Mannes, das sie jetzt in der Dunkelheit kaum noch erkennen konnte.
»Und Sie werden ihn allein ein drittes Mal auch nicht aufhalten können.«
Es war keine Frage, es war eine Feststellung, die das Mädchen beklommen ausgesprochen hatte.
Der Fremde schwieg.
»Weshalb sagen Sie nichts, Mister?«
»Earp«, wiederholte er halblaut.
Ann fiel der Name jetzt auf.
»Earp? Wie dieser Sheriff?«
»Genauso.«
»Weshalb antworten Sie nicht, Mister Earp?«
»Weil ich Ihre Worte nicht für eine Frage hielt.«
»Es war auch keine Frage. Und dennoch hoffe ich…«
Da stand der Mann und reckte sich zu seiner vollen Größe.
»Es ist schon eine böse Sache, Miß. Ich kann wenig dazu sagen. Selbstverständlich kann ein einzelner Mann kein halbes Dutzend Männer aufhalten, jedenfalls nicht auf die Dauer. So etwas gelingt vielleicht einmal mit viel Bluff und Worten, aber…«
»Nein, Mister Earp«, unterbrach sie ihn, »das dürfen Sie nicht sagen. Es war nicht nur Bluff, und es waren nicht nur Worte. Und eigentlich… Ach, ich kann es gar nicht über die Lippen bringen, was ich sagen wollte.«
»Ich weiß es ohnehin, Miß Barring«, entgegnete der Mann.
»Nein, Sie können es gar nicht wissen. Ich wollte Ihnen nämlich Mut machen. Weil Sie… unsere einzige Hoffnung sind.«
Sie schluckte, ehe sie weitersprach.
»Auch Vaters einzige Hoffnung. Wenn er auch anders spricht. Die Menschen in der Stadt haben andere Sorgen, als sich um die Kämpfe der Rancher untereinander zu kümmern. Sie tratschen höchstens darüber an den Theken. Und die kleinen Farmer im County haben Angst. Sie sind froh, wenn ihnen niemand etwas tut. Die einzigen, die uns vielleicht hätten helfen können, sind die von der Hacatt Ranch, der dritten großen Ranch in diesem District. Aber gerade die Hacatts haben allen Grund, die Finger aus dem Spiel zu lassen. Zu hart war der Zusammenprall, den ihre Söhne mit denen der Elliot Ranch damals hatten. Es ist ein wahres Glück, daß nichts Schlimmeres entstanden ist.«
All dies wußte der Mann, der vor ihr stand. Und er wußte auch, daß es bitter schwer sein würde, James Elliot aufzuhalten.
»Ich weiß nicht, was in Mister Elliot gefahren ist«, sagte Ann bedrückt. »Sollte ein Mensch so nachtragend und haßerfüllt sein können, daß er nach so vielen Jahren seinen Gefühlen einen solchen Ausbruch erlaubt?«
»Doch, Miß, das wäre kein einzig dastehender Fall. Aber ich glaube nicht, daß James Elliot aus diesem Grund so erbittert gegen Ihren Vater vorgeht.«
»Und weshalb, glauben Sie, tut er es?«
»Ich weiß es selbst noch nicht. Aber ich werde es herausbringen.«
Da stellte sie eine sehr entscheidende Frage: »Weshalb wollen Sie es herausbringen, Mister Earp?«
Ein kleines Lächeln stand in den Augenwinkeln des hochgewachsenen Mannes. Ann Barring gewahrte es trotz der Dunkelheit.
»Weil ich schon als kleiner Junge sehr neugierig war, Ann Barring«, sagte er.
Sie blickte forschend in sein markantes Gesicht.
»Haben Sie etwas mit den Elliots?«
Er schüttelte den Kopf.
»Es wäre ja nicht ausgeschlossen«, fand das Mädchen. »Man hat ja schon gehört, daß ein Mann nach Jahren zurückkommt, um sich zu rächen.«
»Ich kenne James Elliot erst seit heute, Miß Ann. Und gehört habe ich von ihm gestern zum erstenmal in Dillon.«
Die hübsche kleine Ann Barring konnte sich nicht vorstellen, was einen Mann bewegte, den Spuren so gefährlicher Dinge so haarscharf nachzureiten.
Was hätte sie wohl gesagt, wenn sie gewußt hätte, daß der Mann, der da so dunkel und groß vor ihr stand und schon mehr Eindruck auf sie gemacht hatte, nicht irgendein Cowboy namens Earp war, sondern selbst der berühmte Marshal Earp, von dem sie vorhin noch gesprochen hatte?
Er war durch Dillon gekommen und hatte die Geschichte nicht einmal selbst gehört. Sein Freund, der im ganzen Westen gefürchtete Spieler und Gunman Doc Holliday, hatte sie am Spieltisch erfahren.
Obgleich die beiden Dodger auf dem Heimritt von Montana nach Kansas gewesen waren, hatte der Marshal sich sofort dazu entschlossen, auf die Barring Ranch zu reiten.
Vielleicht hätte der Rancher nur verzweifelt den Kopf geschüttelt, wenn er erfahren hätte, wer da zu ihm gekommen war. Der große Wyatt Earp! Himmel, die Gegner würden vielleicht ferngeblieben sein, aber auch nur so lange, bis sie gewußt hätten, daß der Marshal weitergeritten war. Und wenn die Barrings ihr Geheimnis gehütet hätten? Well, sie selbst waren jedenfalls dem Marshal gegenüber nicht so unbefangen gewesen, wie sie es einem Cowboy gegenüber waren.
Er hätte keine Ruhe auf dem Weiterritt nach Kansas gefunden, der Missourier, wenn er sich nicht wenigstens hier umgesehen hätte, wenn er nicht mindestens den Versuch gemacht hätte, den unglücklichen Zwist zu schlichten.
Sehr schnell hatte er einsehen müssen, daß hier nichts mehr zu schlichten war. Jedenfalls jetzt nicht.
James Elliot befand sich in einem guten Zustand, in dem er keinem guten Wort zugänglich war. Das stand fest. Die Art, in der er bereits gegen den Schotten vorging, spitzte die Dinge derart zu, daß der Marshal gezwungen war, ganz hart zu kontern, wie er es ja auch getan hatte.
So ganz allein war Earp glücklicherweise nicht. Er hatte ja einen Helfer in der Nähe, der ihn nicht im Stich lassen würde.
Aber was waren zwei einzelne Menschen gegen einen rasenden Viehzüchter, der immer noch Geld genug besaß, um eine große Helferschar in die Sättel zu bringen?
Bewußt hatten sich die beiden Freunde getrennt. Es war nicht notwendig, irgend jemanden auf den Gedanken zu bringen, daß der Cowboy, der sich da so handfest bei Barring eingeführt hatte, irgend etwas mit dem gepflegten Gambler zu tun hatte, der sich oben in der Stadt aufhielt. Um so größer war die Chance des Spielers, unbeobachtet und unbehelligt zu wachen.
Bereits in der vergangenen Nacht war Doc Holliday bei der Ranch gewesen, wo der Marshal ihn erwartet hatte.
Während der Georgier den Platz des Marshals einnahm und bei der Barring Ranch wachte, bestieg der Missourier seinen Hengst und ritt hinüber zur Elliot Ranch, um ihr einen heimlichen Besuch abzustatten.
Er stellte fest, daß seine Beobachtung vom Vortage stimmte. James Elliot war mit einer Anzahl Reiter auf dem Vorwerk, also bereits ganz in der Nähe der Weidegrenze Barrings. Und der Corral auf der Ranch war völlig leer. Somit hatte Elliot höchstwahrscheinlich alle seine Leute bei sich.
Wo war Roger Elliot, der bisher bei Barring gearbeitet hatte?
Was Doc Holliday dem Marshal von Roger Elliot berichtet hatte, war so ungereimt und merkwürdig, daß sich Wyatt Earp vorgenommen hatte, diesen Burschen besonders unter die Lupe zu nehmen.
Roger war es gewesen, der diesen unseligen Gunfight angezettelt hatte. Die Leute in der Stadt wußten, daß James Elliot seinen Sohn nicht vom Hof gewiesen hatte. Was veranlaßte den jungen Mann, dennoch zu gehen und ausgerechnet bei dem einstigen Rivalen des Vaters Arbeit zu nehmen? Hatte er irgendeinen Grund, den Vater zu schädigen? Oder wollte der Bursche vielleicht so irrsinnig sein, das Schuldkonto, das er sich bei seinem Vater aufgeladen hatte, dadurch verringern zu wollen, daß er den Mann, den der Vater so lange gehaßt hatte, irgendwie schädigte?
Eine verquerte Idee, vielleicht, aber der Marshal hatte die sonderbarsten Dinge in diesem Lande erlebt. Ein Bursche, der aus so nichtigen Gründen, ja, aus einem Nichts heraus einen so mörderischen Gunfight entfacht hatte, der außerdem die seltsamsten Gewohnheiten besaß, was seine Kleidung anbetraf, seine Waffen, sein Sattelzeug, sein Pferdegeschirr und anderes mehr, ein solcher Mensch konnte auch auf einen so kranken Gedanken gekommen sein.
Hollidays Gewährsmann war – eine Frau.
Sie stand in Hillers Bar an der Theke und hatte sich in den eleganten Fremden, der sich vorsichtshalber John Holl genannt hatte, vergafft. Sie glaubte sich ihm dadurch interessant machen zu können, daß sie ihm solche Geschichten aus dem County erzählte.
Ursprünglich hatten die beiden Dodger nur einen Tag in Dillon bleiben wollen. Da sie nicht im gleichen Boardinghouse Quartier bekommen hatten, war es bisher niemandem aufgefallen, daß die beiden zusammengehörten. Und nachdem der Marshal schon so informiert war, erkundigte er sich selbst auch noch unauffällig an mehreren Stellen in der Stadt nach dem, was er noch glaubte, wissen zu müssen.
Die Sache stand schlechter, als er befürchtet hatte.
In der Stadt gab man die Barring Ranch bereits auf, und niemand dachte daran, den drei einsamen Menschen beizustehen. Zu mächtig war der Gegner, der James Elliot hieß.
Eine Gestalt beschäftigte den Marshal neben Roger Elliot ganz besonders: der eigenartige Texaner, der sich Skinner nannte.
Da er häufig in der Stadt gewesen war und dem Alkohol stark zusprach, kannten ihn die Leute besonders in Hillers Bar ziemlich gut.
Was hatte er bei Barring gesucht? Einen Job für fünfundzwanzig Dollar, wie er sich in der Schenke oft gebrüstet hatte? Wohl kaum.
Was aber sonst?
Und plötzlich stand er in Elliots Crew.
Als der hagere Bursche da neben Elliot in den Hof kam, wußte Earp sofort Bescheid über ihn, obgleich er ihn vorher nie gesehen hatte. Solche Typen fallen einem erfahrenen Gesetzesmann auf.
Und dann, als er mit ihm zusammengeraten war, stand es für ihn fest, daß dieser Skinner ein ganz gefährlicher Bandit war. Der gefährlichste Gegner.
Es sei denn, daß dieser Roger auf seine Art noch mehr zu fürchten war. Aber das gedachte der Missourier schon am nächsten Tag herauszufinden.
Vielleicht hätte die kleine Ann Barring jetzt mehr Mut gehabt, wenn sie gewußt hätte, wer der Mann war, der auf die Ranch gekommen war und so entschlossen handelte.
Aber Wyatt Earp hatte beschlossen, sein Geheimnis noch zu wahren.
Es sollte rascher gelüftet werden, als ihm lieb war.
Ann ging zu ihrem Eimer zurück und nahm ihn vom Brunnenrand.
Der Marshal folgte ihr, nahm ihr den Eimer ab und trug ihn vor die Haustür.
Das Mädchen blieb neben der Tür stehen.
»Wann werden Sie weiterreiten, Mister Earp?«
»Das weiß ich noch nicht.«
»Heute doch nicht mehr?«
»Nein, ganz sicher nicht«, entgegnete Wyatt lächelnd.
Sie hätte ihm so gern gesagt, daß sie vorhin alle sehr bedrückt gewesen waren, als sie annehmen mußten, er sei weitergeritten.
Und sie hätte ihn gern gefragt, wo er herkam. Es war seiner Sprache nicht anzuhören. Er sprach ein sauberes, klares Englisch, wie es die Menschen sprachen, die von der Küste stammten. Aber er sah andererseits wiederum nicht so aus, als ob er von der Küste käme. Er war ein echter Westman, dessen war sie gewiß. Voller Rätsel war der Cowboy Earp für die kleine Ann Barring.
»Sagen Sie es mir, wenn Sie weiterreiten müssen?«
»Das verspreche ich Ihnen.«
Sie reichte ihm die Hand, die er kräftig drückte, und ging ins Haus.
Als sie an der Stubentür vorüberkam, vernahm sie aus dem Dunkel die Stimme des Vaters: »Ann, warte.«
Sie blieb stehen und stellte den Eimer ab, den sie hatte in die Küche bringen wollen.
»Komm her, Ann.«
Sie trat in die Stube. Es war so dunkel, daß sie die Gestalt des Vaters kaum sehen konnte.
Sie sah auch die Mutter nicht, die am Fenster stand.
»Du hast mit ihm gesprochen, Ann?« begann der Vater zögernd.
»Ja.«
»Und, was hat er gesagt?«
Ann zog die Schultern hoch.
»Eigentlich nichts.«
»Nichts?« fragte der Rancher verdutzt. »Ihr habt doch eine ganze Weile miteinander gesprochen.«
Ann überlegte.
»Nein, wir haben nur wenig gesprochen.«
Da stellte der Vater ihr die gleiche Frage, die sie vor Minuten dem Mann gestellt hatte.
»Wann reitet er weiter?«
»Er weiß es noch nicht.«
»Aha.«
»Aber er wird es mir vorher sagen.«
»So, wird er das.« Der Rancher ging ruhelos in dem großen Raum auf und ab. »Es hat keinen Sinn«, kam seine knarrende Stimme aus der hintersten Ecke. »Wir können den Kampf gegen Elliot nicht durchstehen. Wir haben keine Chance. Auch nicht mit dem besten Cowboy der Welt auf unserer Seite.«
Anns Augen leuchteten, als sie die Worte des Vaters hörte. Er hielt ihn also für einen einzigartigen Cowboy!
»Nein, das ist hoffnungslos. Da kämpfen wir einen sinnlosen Kampf. Und ich bin nicht gewillt, irgend jemanden zu opfern. Dazu kommt, daß ich nicht verrückt genug bin, mir einzubilden, daß ein solcher Mann für einen Spottlohn bei mir arbeiten möchte. Wir – deine Mutter und ich – wir sind der Ansicht, daß es eigentlich nur eine einleuchtende Erklärung für sein Hiersein und sein Verhalten gibt, Ann.«
Eine sonderbare Angst erfüllte plötzlich das Herz des Mädchens. Wenn der Vater doch jetzt nicht weitersprechen würde! dachte sie.
»Wir meinen, Ann, daß der Mann dich irgendwie in der Stadt gesehen haben wird, und daß er deinetwegen hergekommen ist.«
Stocksteif stand Ann Barring in der Tür und blickte in das Dunkel des Raumes. Endlich brach es von ihren Lippen: »Nein, Vater, das glaube ich nicht.«
Sie wandte sich um, nahm ihren Eimer auf und ging damit durch den dunklen Gang in die Küche, wo es noch eine Menge Arbeit für sie gab.
*
Es war Mitternacht durch, als der Missourier die Ranch verließ. Er ging zu Fuß das Stück den leichten Hang hinüber, dorthin, wo der Wald begann.
Da setzte er sich unter eine große Kiefer und wartete.
Schon nach einer Viertelstunde vernahm er den leichten Hufschlag eines einzelnen Pferdes in der Ferne.
Wyatt Earp stand auf und machte ein paar Schritte in die Richtung hinein.
Der Reiter kam näher, bis auf dreißig Yard, und da stieß der Marshal den Ruf des Waldkauzes aus, der sofort erwidert wurde.
Das Erkennungszeichen für Doc Holliday.
Er kam heran, stieg von seinem Rapphengst und ließ die Zügelleinen fallen.
Die beiden Männer gingen an den Wandrand und ließen sich da nieder.
»Ob man sich eine Zigarette anzünden kann?« forschte der Georgier.
»Ich glaube schon. Ich sitze fast eine Viertelstunde hier, es war nichts zu hören, was auf die Gegenwart von Menschen schließen ließe.«
»Eine Viertelstunde? Zounds, habe ich mich so verspätet? Well, die Schöne hat mich lange aufgehalten. Sie war wieder beim Thema. Eine ganz verrückte Sache hat sie mir da erzählt. Von unserem Freund Roger Elliot…«
Interessiert hörte der Marshal zu, was der Freund ihm zu berichten hatte.
Nach einer halben Stunde trennten sie sich.
Doc Holliday ging das Stück zur Ranch hinauf, das der Marshal vorhin heruntergekommen war, und Wyatt bestieg den Rappen des Freundes und ritt nach Norden davon.
Nach Dillon.
*
Als Skinner nach der Niederlage durch den fremden Cowboy auf der Barring-Ranch hinter den anderen herritt, sann er auf Rache. Obgleich er sonst immer ein Einzelgänger gewesen war, überlegte er jetzt, wo er Roger Elliot finden könnte.
Roger war, nachdem Barring ihn wie die anderen von der Ranch geschickt hatte, keineswegs heim zu seinem Vater geritten. Er traute sich immer noch nicht nach Hause. Wie sollte der Vater seine drei toten Brüder Jonny, Willie und Martin schon vergessen haben? Und die Mutter?
Nein, der Cowboy Roger Elliot besaß nicht genug Charakterstärke, den Eltern unter die Augen zu treten, auf den Hof zurückzukommen, um durch harte ehrliche Arbeit gutzumachen.
Er war nach Dillon geritten.
Und Skinner wußte es.
Als sich der Rancher mit Morbat, Harms, Webster, Flerges und Pulk auch nicht mehr in dem Vorwerk aufhielt, sondern seinem fernen Hof entgegenritt, hing Skinner erst nur ein Stück zurück. Als ein genügend großer Abstand zwischen ihm und den anderen bestand, wandte er sich in einer Mulde, die von den anderen nicht eingesehen werden konnte, nach Norden.
Der Stadt zu.
Er erreichte sie erst nach Einbruch der Dunkelheit.
Aus den beiden einander schräg gegenüberliegenden Schenken fiel helles, von Buntglasfenstern gebrochenes Licht.
Wagen standen umher und zahlreiche Pferde an den Querholmen. Auf den Vorbauten standen die Menschen beieinander und unterhielten sich.
Die Wärme ließ sie so lange wie möglich im Freien bleiben.
Ric Skinner stieg vor Hillers Bar von seinem Gaul, warf neben einer ganzen Pferdereihe die Zügelleinen um einen Querholm, sah sich kurz auf der Straße um und schlenderte dann in die Bar.
Dort herrschte reger Betrieb. Sämtliche Tische waren besetzt, und an der Theke, wo die stark blondierte schöne Dalida stand, drängten sich die Männer nur so.
Offenbar gab es neben dem Whisky auch ständig etwas zu lachen bei der Dame. Und die meisten dieser Männer schienen daheim wenig Grund zum Lachen zu finden. Deshalb kamen sie in Hillers Bar.
Skinner stand der Sinn nach anderen Dingen. Er schob sich an die Stirnkante der langen Theke und schnipste ungeduldig mit den Fingern.
Die Frau ließ sich durch dieses Gebaren nicht in ihrer Ruhe und Heiterkeit stören. Ohne Hast schob sie ihm einen Whisky zu.
Skinner ergriff blitzschnell ihre Linke und spannte seine Finger sehr kräftig darum.
»Hör zu, Girl, ich habe dich etwas zu fragen.«
Die Frau riß sich los und wich vor diesem Gesicht erschrocken zurück.
»Sind Sie verrückt, Mann?«
»Wo steckt Roger?«
»Welcher Roger?«
»Elliot.«
»Was geht es Sie an?«
Da schnappte der Texaner wieder zu und zog die Frau dicht zu sich heran.
»Hör zu, mein Frosch, Roger hat mir einiges von dir erzählt…«
Da wurde die Frau so rot, daß man es trotz ihres weißgepuderten Gesichtes sah. Rasch schob sie sich näher und fragte mit heiserer Stimme: »Wer sind Sie? Der Tex von der Barring Ranch?«
»Genau, Mäuschen.«
»Ich bin nicht Ihr Mäuschen!« Dalida warf einen raschen Blick über die Gesichter der anderen Männer an der Theke, und als sie glaubte, darauf nur Interesse für den Whisky, die beiden Tanzgirls, die soeben das Podium betraten und für rauhe Gespräche gelesen zu haben, zischte sie dem Texaner zu: »Er ist oben in meinem Zimmer.«
»Ach…«
»Nichts ach, Mister!« Die Frau zog die Brauen zusammen. »Wir sind seit Jahren befreundet…«
»Aber wohl nur im Dunkel, he?« spöttelte der Tramp.
Wieder stand die Frau blutübergossen da. Ja, es stimmte. Roger schämte sich ihrer, und wenn er kam, suchte er sie nur nach Einbruch der Dunkelheit auf.
»Wo finde ich das Zimmer?«
»Nummer drei. Aber wenn Sie Lärm machen, Skinner, rufe ich den Sheriff!«
Der Tex griff wieder nach ihr und packte ihr schmales Gesicht mit seiner groben Hand.
»Wer wird denn Lärm machen, wenn er eine so hübsche Gastgeberin hat.«
»Ach, lassen Sie mich los, Mann! Und in einer Stunde komme ich herauf und werfe euch beide raus. Roger soll sonstwem die Bude vollqualmen.«
»Nun mal nicht so giftig, kleine Schlange!« Skinner stieß sie rücksichtslos zurück und hatte obendrein die Frechheit, sie noch anzufeixen, ehe er davonschlenderte.
»He, Mann, der Whisky!« rief ihm die Frau nach.
Da deutete er mit einer nicht mißzuverstehenden Geste an die Stirn.
»Den kannst du mal für einen Freund Rogers ausgeben.«
»Sie zahlen den Whisky!« keifte sie.
»Verrückt geworden?«
Skinner wollte weiter, doch er wurde von einem Mann, den er bisher nicht im mindesten beachtet und über dessen rechte Schulter er die ganze Zeit mit dem Mädchen verhandelt hatte, am Ärmel aufgehalten.
Grenzenlose Verwunderung malte sich im Gesicht des Texaners, als er den Mann jetzt genauer betrachtete.
Es war ein hochgewachsener Fremder im eleganten schwarzen Anzug mit modernem Rüschenhemd und einer weinroten Seidenkrawatte. Das Gesicht des Fremden war schmal, kantig, wettergebräunt und gutgeschnitten. Es wurde von einem eisblauen Augenpaar beherrscht und von einem schwarzen breitrandigen Californiahut bis zu dem sauber ausrasierten Schnurrbart hin beschattet.
Ganz sicher hätte Ric Skinner jetzt laut aufgelacht, wenn ihm jemand gesagt hätte, wer der Fremde war.
Doc Holliday, der berühmte Gambler und Gunman, den der ganze Westen kannte, der Georgier, der zusammen mit dem Marshal Earp durch das Land ritt und dessen schnelle Revolverhand bis heute kein Bandit gewachsen war.
Doc Holliday? Nein, das hätte Skinner nie geglaubt. Den Spieler hätte er sich ganz anders vorgestellt. Wilder, rüder, vielleicht auch nicht so groß und ganz bestimmt nicht so elegant und ruhig.
Richard Skinner musterte den Mann mit einem Blick, in dem sich Verwunderung und Spott spiegelten.
»He, was ist denn mit dir los? Wohl verrückt geworden, Dandy, he?«
Der Georgier hatte eine Zigarette im Mundwinkel stecken, schob sie, ohne die Hand dazu zu benutzen, in den anderen Winkel und kniff ein Auge ein.
»Sie haben Ihren Whisky vergessen zu zahlen, Mister.«
»Was habe ich?«
»Wenn Sie schlecht hören, sollten Sie mal einen Arzt aufsuchen. Sie haben Ihren Whisky nicht bezahlt. Und was nicht bezahlt wird, muß Miß Dalida selber zahlen.«
»Ach, muß sie das? Dann soll sie mal. Und – was geht das dich an, Dandy? He? Schätze einen Dreck.« Skinners Augen funkelten vor aufsteigender Wut. Wagte es dieser Stadtfreak da ihn aufzuhalten! Am liebsten hätte er ihn jetzt niedergeschlagen.
Da blitzte es in den Augen des Fremden auf.
»Vorwärts, Mann, zahlen Sie Ihren Whisky, wie das jeder andere hier tut.«
Der Zorn übermannte den wilden Texaner.
Ich werde ihn buffaloen. Ihm den Revolverlauf über den Schädel schlagen, daß er es nie wieder riskieren wird, einen Texaner an seine Zeche zu erinnern – so dachte Ric Skinner.
Seine Hand zuckte zum Colt.
Und da geschah etwas, das sich der schnelle Ric niemals hätte träumen lassen: in der rechten Faust des Fremden schimmerte plötzlich unter der Thekenkante hervor der vernickelte Lauf eines schweren Revolvers.
Skinner starrte entgeistert auf die Waffe – hob dann den Blick und sah in ein eisiges Augenpaar.
»Sie wollten zum Geld und nicht zum Colt greifen, Tex!«
Skinner nahm mit der Linken zwei Münzen aus der Gurttasche und warf sie an Holliday vorbei auf die Theke. Dann maß er den Spieler noch mit einem haßerfüllten Blick und wandte sich ab.
Er hatte jetzt Eiligeres zu tun. Aber diesen Kerl, den würde er sich noch greifen.
Während er die Treppe hinauflief, schoß er durch die Geländerstäbe noch einen forschenden Blick auf den Fremden an der Theke.
Damned, das war die zweite Abfuhr an einem Tag!
Er würde sich für beide rächen. Gegen den Kerl draußen bei Barring würde es kein Kinderspiel sein, das war ihm schon in dem kurzen Gang klargeworden.
Aber hier, dieser geschniegelte Bursche, den würde er fertigmachen! Wie hatte der bloß so schnell den Revolver in der Hand gehabt? Skinner war davon überzeugt, daß der Mann ihn schon lange vorher heimlich gezogen haben mußte.
Das allerdings war ein Irrtum; und Skinner hätte das gewußt, dann wäre er vorsichtiger gewesen.
Richard Skinner war ein Landstreicher aus Texas, der überall versuchte, den großen Fischzug zu tun. Der keine Skrupel kannte und bereit war, jedes Hindernis aus dem Weg zu räumen, um zu Geld zu kommen.
Es war ihm nie gelungen. In Oklahoma City hatte ihn um ein Haar eine ganze Ranchmannschaft erwischt.
In Shawnee erging es ihm ähnlich. In Mariboon waren es die Leban Brothers, die ihm beinahe an den Kragen gekommen wären.
Immer hatte er mit Hilfe seiner Gerissenheit und seines schnellen Pferdes noch im allerletzten Augenblick entkommen können.
Arbeiten wollte er nicht, er suchte den großen Fang. Und den glaubte er in Ann Barring gefunden zu haben. Hatte er erst sie, dann hatte er auch alles, was ihr gehörte.
Dieser Roger war ja nicht auf das Mädchen und ihren Besitz aus. Er würde ein willfähriges Werkzeug in seinen Händen sein.
Es war Pech, daß der alte Elliot seine Pläne mit seinen allzu ungestümen Vorgehen fast zerschlagen hatte. Aber das ließ sich noch reparieren. Zunächst einmal hatte er Elliot gezeigt, daß er sein Mann war. Das war wichtig. Jetzt mußte ihm Roger dazu verhelfen, den Barrings eine andere Meinung beizubringen.
Daß er keine üble Absicht gehabt hätte. Und daß er ja nur gegen diesen wilden Cowboy hätte vorgehen wollen, in dem er einen Feind der Barrings gesehen hätte.
Er sah überhaupt nur ein einziges echtes Hindernis in seinem Plan, den er tatsächlich der Verwirklichung nahe glaubte: Der fremde Cowboy, der so hart mit der Faust und so gefährlich mit dem Revolver war.
Und eben diesen Mann mußten sie gemeinsam schlagen. Er mußte verschwinden, koste es, was es wolle.
Und Roger Elliot schien ihm auch dazu das geeignete Werkzeug zu sein.
Im Gegensatz zu Roger wußte der Texaner sehr genau, was er wollte. Nur die Wege, die er beschritt, waren noch undurchsichtiger.
Jetzt hatte der Tramp das Obergeschoß erreicht, ging an den ersten beiden Türen vorbei und stand vor dem Zimmer, auf dessen Tür eine 3 kunstvoll aus Messing aufgesetzt war.
Ohne anzuklopfen trat der Bandit ein.
Roger hatte in einem Plüschsessel gesessen und fuhr erschrocken hoch.
Als er den Mann erkannte, der da vor ihm stand, sank er wieder in den weichen Sitz zurück.
»Du? Wie kommst du denn hierher?«
»Dreimal darfst du raten«, krächzte Skinner feixend und sah sich in dem überladenen Raum um.
Auf einem Spiegeltischchen entdeckte er eine Karaffe mit Brandy. Er nahm den gläsernen Stöpsel ab und setzte sich die Karaffe an seinen schmierigen Mund.
Roger betrachtete ihn mit aufsteigendem Ekel.
»Was willst du eigentlich, Ric?«
»Ich suche dich.«
»Mich?«
»Ja, dich.«
Niemand in der Schenke hatte auf den Fremden geachtet, der die Theke verlassen hatte und ebenfalls nach oben gegangen war.
Er hatte hier im Haus das Zimmer Nummer vier gemietet.
Es lag gleich neben dem Zimmer Dalidas.
Und es hatte sehr dünne Wände…
Roger Elliot sah sich unbehaglich nach dem Texaner um, der wie ein Tiger durch den Raum schlich, alles anfaßte, die Schränke öffnete und nicht einen Gegenstand unbeachtet ließ.
»Mach endlich das Maul auf, Mann!«, knurrte Elliot.
»Ich habe dir etwas Interessantes mitzuteilen, Boy.«
»Nämlich?« fragte Elliot ungeduldig.
»Barring hat einen Helfer bekommen, der nicht dableiben darf.«
»Einen Helfer?«
»Ja, ich war vor ein paar Stunden mit deinem Vater auf der Ranch. Da tauchte der Bursche plötzlich auf. Ich kenne ihn. Aber das weiß er nicht. Ein gefährlicher Bandit, Nelson heißt er. Und wo er auftaucht, gibt es Dampf. Er muß verschwinden, ehe seine Freunde kommen. Die folgen ihm meistens nach ein paar Tagen. Er hat die finstersten Ideen…«
Und dann sprach der Bandit von seinen eigenen Ideen, die er dem angeblichen Nelson in den Stiefel schob.
»Und das schärfste ist, daß er Barrings Crew erst einmal so stark machen will, daß dein Vater im County kein Bein mehr an die Erde bekommen wird. Barring wird euch fertigmachen…«
So hetzte der hinterhältige Bandit, bis Roger Elliot sagte: »Das also ist Barrings Plan! Ich habe es gewußt. Nur deshalb bin ich zu ihm gegangen, um ihm irgendwelchen Schaden zuzufügen, den er nicht so leicht entdecken könnte. Aber es ist mir nicht gelungen. Er hat es wohl geahnt und mich nicht zuletzt deswegen vom Hof geschickt. Aber ich werde gegen ihn kämpfen, wie ich gegen die Hacatts gekämpft habe. Ich werde…«
Roger Elliot hatte inzwischen das fünfte Glas Brandy getrunken und redete sich in einen wilden Zorn, angefacht durch die Hetzerei des Texaners.
»Wir werden ihn fertigmachen!« sagte Skinner und meinte den Mann, den er Nelson genannt hatte.
Und Elliot glaubte, daß von Barring die Rede sei.
Dann entwickelte Skinner dem Jüngeren seinen Plan.
»Hör zu. Wir müssen es sehr raffiniert anstellen, wenn wir einen solchen Kerl erledigen wollen. Und was auch geschieht: es muß unser Geheimnis bleiben.«
So erfuhr der verblüffte Elliotsohn, daß Ric Skinner vor allem den Fremden schlagen wollte. Und er behauptete, daß damit Barring geschlagen sei. Daß er die Niederwerfung Barrings aber den Reitern der Elliot Ranch zu überlassen gedachte, verriet er noch nicht. Und er selbst wollte sich bei Barring wieder einschleichen. Und Roger sollte ihm dazu verhelfen.
»Ann ist in dich verliebt. Ein Narr sieht es«, hechelte er. »Du wirst sie morgen abend, wenn es dunkel geworden ist, besuchen. Oft genug hast du ja unter ihrem Fenster gestanden. Du mußt ihr klarmachen, daß ich euer Mann bin, also für Barring. Daß ich nur mit Elliot zurückgekommen wäre, um Schlimmeres zu verhüten. Und daß dieser Nelson der wahre Feind ihres Vaters sei…«
Damit hatte Skinner Roger, wo er ihn haben wollte.
»Wenn ich wieder drin sitze, Roger, dann vernichten wir die Barrings, ohne daß sie es merken. Aber wir brauchen noch ein paar gute Leute. Du kennst dich doch hier aus. Fünf Burschen fehlen uns zur Rückendeckung. Los, schaff sie herbei! Ich warte hier. In anderthalb bis zwei Stunden dürftest du sie zusammenhaben.«
»Mitten in der Nacht?«
»Unser Vorhaben kennt keine Zeit. Es eilt!«
Das war der Augenblick, in dem Doc Holliday sein Zimmer lautlos verließ, hinunterging, seinen Rapphengst aus dem Stall holte und in voller Karriere durch die Nacht nach Süden sprengte.
Er hatte dem Marshal Bericht erstattet. Und Wyatt Earp hatte beschlossen, selbst nach Dillon zu reiten. Vielleicht gelang es ihm ja, die Pläne Skinners zu zerschlagen, ehe sie zur Ausführung kamen.
Während Doc Holliday den Wachposten bei der Barring Ranch bezogen hatte, strebte der Marshal der Stadt zu.
Der Rappe brachte ihn schnell dorthin. Es gelang ihm verhältnismäßig leicht, über den von Doc Holliday beschriebenen Anbau in das von dem Spieler bewußt hochgeschobene Fenster zu steigen und so in dessen Zimmer zu kommen.
Nebenan war nur das leise Pfeifen eines Mannes zu hören. Ab und zu klickte der Stöpsel der Brandykaraffe.
Wyatt Earp verließ das Zimmer des Georgiers, trat auf den Gang, lauschte in den Schankraum hinunter und klopfte dann an die Nebentür.
»Yeah!«
Er trat ein und schloß die Tür rasch wieder hinter sich.
Richard Skinner war wie von der Sehne geschnellt aus dem Sessel hochgefahren und wich bis an den Schminktisch Dalidas zurück. Fassungslos starrte er den Mann an, der ihn aus kalten Augen musterte.
»Hallo, Ric.«
»Ha…« Das Wort erstarb dem Tramp zwischen den Zähnen.
»Mein Name ist Nelson, wie du ja weißt. Ich bin gekommen, um mich mit dir zu unterhalten.«
Skinner hatte beide Hände auf Dalidas Glastisch aufgestützt und den Kopf weit vorgeschoben.
»Mit mir… willst du…, wollen Sie sich unterhalten?« stotterte er.
»Ja, allerdings nicht hier. Draußen.«
»Draußen?«
»Richtig.«
Skinner schüttelte wild den Kopf und stieß sich so hart von dem Tischchen ab, daß der große runde Spiegel, der darauf befestigt war, bedenklich wackelte.
»Nein, Mann, das schaffen Sie nicht!«
Wyatt packte ihn kurzerhand mit der Rechten und zog ihn zu sich heran.
»Hattest du die Absicht, vorzeitig auf deine Kauwerkzeuge zu verzichten, Skinner?«
Der Tramp verstand ihn nicht, starrte ihn nur aus glimmenden Augen an.
»Ich fragte: ob du den Wunsch hast, in Zukunft vor jeglichen Zahnschmerzen bewahrt zu bleiben.«
»Was…«
»Ob ich dir sämtliche Zähne einschlagen soll?!«
»Mir…, was wollen Sie?«
Wyatt schob ihm einen Revolver in die Rippen.
»Komm, Ric, wir beide machen einen hübschen Mondspaziergang. Die Nacht ist warm und die Luft so ungesund in diesem parfümierten Zimmer. Come on.«
Durch Doc Hollidays Zimmer konnte er ihn natürlich nicht hinausbringen; das war ausgeschlossen, da sonst der Georgier verraten war.
Es gab nur einen Weg: Die Treppe hinunter durch die Schenke. Und das war gefährlich mit einem solchen Banditen.
Auf dem Korridor mahnte Wyatt ihn leise: »Es kommt jetzt ganz auf dich an, Rick, ob du diesen schönen Sommerabend noch überlebst. Ich habe für den anderen Fall drüben bei dem Undertaker hübsche Särge gesehen…«
Skinner stand steif wie eine Statue und starrte aus dem Halbdunkel des Flurs durch die Geländersprossen in den lärmerfüllten Schankraum hinunter.
Wenn er jetzt losschrie, dann drückte der andere hinter ihm ab. Das wäre also Wahnsinn.
Aber unten, wenn er erst unten zwischen den Leuten war, dann würde sich eine Gelegenheit finden!
Er irrte. Denn unten zwischen den Menschen konnte der Missourier ihm viel dichter folgen, ihm sogar den Revolverlauf hart in den Rücken drücken, was ihm auf der Treppe, die so gut anzusehen war, schwergefallen wäre.
Skinner schob sich durch die Menschen, kam in der Nähe der Theke vorbei und hörte den spöttischen Ruf des Mädchens: »Na, Tex, schon wieder weiter? Wie steht’s mit einem Drink?«
Skinner blieb stehen.
»Weiter!« fauchte ihm der Marshal ins Ohr. »Ich kenne kein Pardon. Denk an die hübschen Särge. Ich dachte mir, Bergkiefer schwarz gebeizt wäre schlecht für dich. Meine Freunde bezahlen ihn gern, deinen Sarg.«
Da ging Skinner weiter.
Sie kamen an den Eingang.
Noch einmal blieb er stehen und wandte sich mit einem Ruck um.
Er hatte schon den Mund zum Schrei geöffnet, als sein Blick in die Augen des Fremden fiel.
Der Schrei blieb ihm in der Kehle stecken. Langsam drehte er sich um und ging hinaus.
Neben der Vorbautreppe stiegen gerade einige Männer von den Pferden: Roger Elliot und drei Leute, die er für das Vorhaben aufgetrieben hatte.
Skinner starrte zu Elliot hinüber.
Hölle! Sah der vertrackte Bursche ihn denn nicht? Spürte Roger denn nicht die Klemme, in der er saß?
Roger Elliot war so in Eile, daß er den Partner, der eben von dem Missourier auf die Straße geschoben wurde, nicht einmal sah.
»Ah, deine Freunde«, raunte Wyatt dem Tramp zu. »Well, sie werden sich eine Weile in dem Zimmer der Dame unterhalten, bis ich zurückkomme.«
Wyatt bugsierte Skinner in eine stille Nebengasse und schob ihn dann zwei Schritte von sich ab.
Der Revolverhahn knackte hart. Das Geräusch drang Skinner bis ins Mark.
»Hör genau zu, Ric. Ich bin ein eigenartiger Bursche und habe mir das Mädchen in den Kopf gesetzt. Ja, die kleine Ann! Daran wirst du und auch sonst niemand etwas ändern. Du wirst jetzt sterben, weil du dich allzu aufdringlich gezeigt hast. Meine Freunde haben dich hier in der Stadt beobachtet, bei Elliot in dem Zimmer oben und unten an der Theke. Du stehst auf unserer Liste obenan. Tramps wie dich können wir nicht in unserem Revier brauchen. Das mußt du einsehen.«
»Aber Sie können mich doch nicht so einfach über den Haufen schießen!«
»Nicht?« tat Wyatt verwundert. »Weshalb denn nicht? Du wirst doch nicht mehr gebraucht und störst unsere Pläne.«
»Nein… n – nein!« Ich… ich reite sofort. War ja schon auf dem Weg nach Norden. Nur zufällig traf ich Roger Elliot hier.«
»Keine Story, Brother«, fuhr Wyatt ihn an. »Zufällig holt er jetzt für dich ein paar schmutzige Boys zusammen. Nichts da, du fährst ab. Nimm’s nicht so wichtig, es weint dir keiner eine Träne nach. Und wie gesagt: für den Sarg sorgen wir.«
Skinner schwitzte in Todesangst.
»Hör zu, Nel…, hören Sie zu, Mister. Ich… habe ein Geschäft für Sie.«
»Ach?«
»Ja, ich weiß jetzt, daß Sie auf dem gleichen Trail reiten wie ich und…«
»Nicht ganz, Skinner, nicht ganz.«
»Dennoch werde ich Ihnen einen Tip geben. Großartig! Nur siebzig Meilen von hier vorm Reynolds Paß…«
»Sprichst du etwa von der Hitchins Ranch?« fragte Wyatt ahnungsvoll.
»Ja, kennst du sie?«
»Und ob. Da laß die Finger weg, die haben jetzt eine neue Mannschaft und einen Vormann, der jahrelang Sheriff von Topeka war.«
Das war ein harter Bluff, aber er wirkte. Der Tramp kniff verstört die Augen zusammen.
»Dann hätte ich noch was für dich, Nelson. Ich kann schon mal voranreiten, nach Anaconda. Eine große Sache.«
»Bestimmt?« tat der Marshal interessiert.
»Ja, ich warte auf dich in Anaconda im Whiteman-Hotel…«
»Kenn ich, an der Station. Und was hast du da ausgekundschaftet?«
»Ich nicht selbst, aber ein Freund von mir. Er hat es mir in Tulsa erzählt. Die Horse Ranch…«
Wyatt kannte die große Horse Ranch, die der Bandit ihm schilderte. Der Marshal beschloß, noch in dieser Nacht eine Warnung an den Sheriff von Anaconda aufzugeben.
»All right, Skinner, das ist eine großartige Sache, die machen wir beide zusammen. Das hier bei Barring habe ich meinen Freunden schon versprochen. Hier gibt’s sowieso nicht viel zu holen.«
»Nein, aber besser als nichts ist es schon. Ich suche immer noch einen großen Fang, der mich für den Rest meines Lebens sättigt.«
»In Anaconda wirst du gesättigt werden. Wir schmeißen das ja zusammen. Hier kann ich dich jetzt nicht brauchen. Reite schon voran und warte bei Whiteman auf mich. In fünf Tagen bin ich auch da.«
Der texanische Tramp Richard Skinner hatte sich tatsächlich bluffen lassen. Und dazu kam der Respekt, den er vor dem harten Cowboy hatte. Er stieg auf seinen Gaul und ritt nach Norden zu aus der Stadt.
Wyatt beobachtete ihn eine Weile vom Stadtrand aus, und als er sich davon überzeugt hatte, daß der Bandit tatsächlich weiterritt, wandte er sich zurück, um Hillers Bar wieder aufzusuchen.
*
Roger Elliot war mit drei Männern in die Schenke gekommen, stürmte die Treppe hinauf und fand Dalidas Zimmer zu seiner Verwunderung leer. Als er wieder hinunter an die Theke kam und die Frau nach Skinner fragte, zog sie die Schultern hoch.
»Ich weiß nicht, wo er hingegangen ist. Er ist doch eben erst hier vorbeigekommen. Ja, er hatte einen Fremden bei sich. Einen großen Mann.«
»Wie sah der aus?« forschte Elliot, wobei eine dunkle Ahnung in ihm aufstieg.
»Groß, wie ich schon sagte, schwarzes Haar, dunkles Gesicht. Blaue Augen hatte er, das weiß ich sogar genau…«
»Blödsinn!« fuhr sie der Cowboy ungeduldig an.
»Du sollst mir nichts von seinen Augen erzählen, ich will wissen, wie er aussah!«
»Das gehört doch dazu.«
»Hast du seine Waffen gesehen?«
Die Frau schüttelte den Kopf.
»So etwas interessiert mich gar nicht. Jedenfalls war es ein sehr gut aussehender Mann mit ernstem Gesicht…«
»Ich habe seine Revolver zufällig gesehen«, meinte ein älterer Westläufer, der vorn an der Theke lehnte. »Weil mich so etwas interessiert. Er hatte links einen verdammt langläufigen Colt im Halfter stecken, der…«
Mehr brauchte der junge Elliot gar nicht zu wissen. Seine Befürchtung hatte sich bestätigt. Es muß der Mann gewesen sein, von dem Ric Skinner gesprochen hatte!
Rasch zog der Cowboy seine drei Genossen hinaus auf die Straße.
»Vorwärts, wir müssen weg hier. Hier ist es nicht geheuer.«
Die drei sahen ihn verdrossen an.
»He«, meinte Uli Gagbay, »erst versprichst du uns Bucks und schleppst uns in die Kneipe, ohne daß wir einen Tropfen bekommen, jetzt schleppst du uns wieder raus? Nein, das wird nichts, Elliot. Das Ding ist irgendwie faul.«
»Auf jeden Fall«, stimmte der Holzarbeiter Finkbaner zu. »Er hat ja vor dem Kerl, den Dalida beschrieben hat, unheimliche Manschetten. Wir sollten wohl die Kastanien für dich aus dem Feuer holen, was? Nichts da. Laß uns zufrieden!«
Der dritte blieb noch einen Augenblick stehen, folgte dann aber den beiden anderen. Sie stiegen auf ihre Gäule und trollten sich.
Roger blickte wütend hinter ihnen her, nahm dann aber seinen Fuchs und ritt nach Süden zu aus der Stadt.
Als Wyatt Earp in die Bar zurückkam, winkte ihm Dalida schon zu.
Er trat an die Theke.
Sie musterte ihn eingehend und stellte zu ihrer Befriedigung fest, daß er tatsächlich blaue Augen hatte. Und was für Augen!
»Mister, Roger Elliot hat Sie gesucht. Vor einer Viertelstunde.«
»Ich weiß. Er hatte wahrscheinlich drei Männer bei sich«, gab Wyatt zurück.
»Ja.«
»Und ist er oben?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Nein, sie sind wieder gegangen.«
»Weggeritten«, meinte der alte Westläufer und beobachtete, wie vorhin schon, den großen Revolver an der linken Seite des Fremden.
Sie waren also weggeritten. Da galt es, keine Zeit zu verlieren.
Wenn sie zur Barring Ranch ritten, hatte Doc Holliday vier Leute gegen sich!
In scharfem Galopp preschte der Marshal auf den Silver Creek zu, passierte den Kiefernwald und schoß die Anhöhe hinauf.
Die Ranch lag in tiefster Stille vor ihm. Er ritt auf den Corral zu.
Plötzlich tauchte eine Gestalt vor ihm auf, wie aus dem Boden gewachsen.
Man sah eigentlich nur die weiße Hemdbrust, die selbst durch diese Dunkelheit schimmerte.
Doc Holliday hatte nichts zu berichten. Hier auf der Ranch war alles still geblieben. Das bedeutete, daß Roger Elliot mit den drei Männern höchstwahrscheinlich auf die Ranch seines Vaters geritten war.
Der Marshal erzählte dem Freund, was er inzwischen erlebt hatte.
»Wenn Skinner tatsächlich weggeritten ist, hat sich Ihr Weg in die Stadt doppelt gelohnt«, meinte der Spieler. »Und ich wette, daß Sie jetzt am liebsten auf die Elliot Ranch ritten.«
Der Missourier lachte leise.
»Sie treffen den Nagel auf den Kopf, Doc. Das hieße aber, daß Sie hier wieder eine Weile Wache schieben müßten.«
»Darüber bin ich mir klar. Reiten Sie los.«
»Sofort. Ich will nur die Pferde tauschen. Der Rappe hat die Strecke so rasch hinter sich gebracht, daß ich ihn jetzt nicht wieder jagen will. Ich nehme den Falben.«
Und diesmal ging’s noch schneller.
Wyatt kannte ja den Weg, oder besser gesagt: die Richtung.
Er ließ das Pferd hundertfünfzig Yard von der Ranch entfernt in einem Gebüsch stehen, schlich auf den Corral zu und sah nur ein einziges Pferd da grasen.
Der Pferdefreund lockte das Tier an sich und stellte sofort fest, daß es noch heiß und schweißig war. Es stand also erst ganz kurze Zeit hier und hatte einen scharfen Ritt hinter sich.
Roger Elliots Fuchs.
Wyatt Earp verließ den Corral und stahl sich auf den Hof.
Es war unverantwortlich, daß James Elliot, der noch Leute genug hatte, keine Nachtwache aufstellte. Für den Marshal war das jetzt natürlich ein günstiger Umstand.
Unbehelligt kam er auf den Hof.
Vielleicht hatten sie hier einen so gefährlichen Hund, daß sie es gar nicht nötig hatten, eine Wache aufzustellen?
Aber auch dies erwies sich als ein Irrtum. Die große Elliot Ranch lag völlig unbewacht da.
Aus den nicht ganz geschlossenen Fenstern des Mannschaftshauses drangen laute Schnarchtöne und verrieten, daß von dorther keine Gefahr zu befürchten war.
Der Missourier hielt im tiefen Dunkel der Scheunenfront auf das große Wohnhaus zu.
Wyatt schlich an die Breitseite im Osten, huschte tief an den Boden geduckt weiter, bis er die Rückfront des Gebäudes erreichte.
Da sah er einen Lichtschein aus einem der unteren Fenster fallen. Und dann hörte er die Stimmen zweier Menschen, eine männliche und eine weibliche Stimme.
Behutsam blickte er näher, bis er die Worte verstehen konnte.
»Und du schämst dich gar nicht!« rief die Frauenstimme empört. »Die ganze Zeit über stromerst du wie ein Tramp auf der Prärie herum. Vater hat neulich, als der Brand über das Gras fegte, zu mir gesagt: Ich würde mich nicht wundern, wenn es Roger gewesen ist. Der Junge ist völlig verwirrt! Ja, das sagte dein Vater. Und jetzt tauchst du plötzlich hier auf, weil dein Geld ausgegangen ist. Weil du wieder weg willst.«
»Ich muß weg, Mutter«, hörte der Missourier die schnarrende Stimme eines Mannes. »Ich habe gar keine Wahl. Drüben bei Barring ist eine Bande, die es auf mich abgesehen hat. Wahrscheinlich hat Barring diese Halunken angeworben, wegen Vater.«
»Erzähle keine Geschichten!« sagte die Frau brüsk. »Wenn dein Vater auch all diesen Unsinn glaubt, ich glaube es nicht. Und du als junger aufgeschlossener Mensch sollest es erst recht nicht glauben. Überlege doch selbst einmal, welchen Grund sollte Barring haben, so gegen uns vorzugehen…«
»Er hat die Prärie angezündet, Mutter!« log Roger. »Er ist ein Verbrecher. Ich weiß es. Er hat das Unglück oben in Dillon verschuldet. Lange genug kenne ich ihn jetzt schließli…«
»Schweig!« herrschte ihn die Frau mit bebender Stimme an.
»Ma!«
»Ich habe gesagt: schweig! Sprich mir nie wieder von dem Unglück oben in Dillon, sonst will ich dich hier nicht mehr sehen. Jonny, Willie und Martin…«
Bei dem letzten Namen bebte ihre Stimme so stark, daß sie ein Schluchzen nur mit äußerster Überwindung vermeiden konnte. »Sie sind alle tot. Und sieh dir Ted an, deinen Bruder Ted! Weil du die Hacatts niederzwingen wolltest, sind deine anderen Brüder tot und er für den Rest seines Lebens ein Krüppel. Ein Mann, der kein Mann mehr ist! Der nicht mehr alleine gehen kann, sondern zwei Stöcke braucht. Querschnittgelähmt, sagt Doc Williams. Weißt du, was das bedeutet für einen so jungen Menschen? Das kannst du nicht ermessen, Roger.
Du treibst dich herum, anstatt dem Vater zu helfen, anstatt ihm die schwere Last hier etwas abzunehmen. Du willst deinen Haß gegen einen Mann befriedigen, der dir nichts getan hat. Immer hast du irgend jemanden gehaßt. Damals war es Jerry McIntosh. Als ihn Imre Callinger erschoß, fing das mit Zarab Hamelinnen an, der dich angeblich in der Stadt beleidigt hatte. Hamelinnen zog weiter nach Westen, und da begannen dich die Hacatts zu ärgern. Heute ist es der alte Barring. Und wenn es den nicht mehr gibt, wird es todsicher jemand anders sein. So aber geht das nicht, Roger! Es ist nicht gut, was du tust. Ich halte dich nicht für schlecht – aber du bist auf keinem guten Weg. Du mußt zu dir selbst finden. Du mußt andere Menschen ihr Leben leben lassen, das hier in diesem Land ohnehin schwer genug ist.«
»Aber, Mutter! Barring will Vater vernichten!«
»Das wird sich herausstellen.«
»Herausstellen? Wenn die Ranch abgebrannt ist, ist jedes Herausstellen zu spät! Er muß überrollt werden!«
»Überrollt?« empörte sich die Frau. »Was sind das für Ausdrücke! Überhaupt, was ist aus dir geworden! Du siehst bleich und käsig aus, abgemagert und finster. Stiehlst dich in der Nacht wie ein Dieb in das Haus deines Vaters, um Geld zu holen. Wo wolltest du hier Geld holen, Roger? Ich frage dich. Dies ist das Arbeitszimmer deines Vaters. Wenn du hier Geld suchtest, dann wolltest du es also stehlen!«
»Mutter!«
»Sei still. Ich habe das Geräusch gehört, weil ich jedes Geräusch in der Nacht höre, weil ich nicht schlafen kann, seit sie nicht mehr da sind, die Kinder…«
Ein leises Schluchzen erstickte ihre Stimme.
Dann fiel eine Tür ins Schloß.
»Verdammter Kram! Weibergeheule!« hörte der Marshal die Stimme des jungen Mannes.
Dann richtete sich Earp auf und blickte in das Zimmer hinein.
Sich hier auf die hohe Brüstung hinaufziehen, wäre nicht ohne verräterische Geräusche abgegangen. Aber das Fenster war so weit hochgeschoben, daß er den Raum sehr gut überblicken konnte.
Ruhig zog er seinen großen Revolver und legte ihn auf die untere Kante des Fensterrahmens.
»Roger Elliot!« Er hatte es nicht laut gesagt.
Der Bursche fuhr entgeistert herum und sah den Mann drüben am Fenster, den Mann und den Revolver!
Es verging fast eine halbe Minute, ehe der Bursche heiser vor Erregung hervorstieß: »Was… wollen Sie?«
»Komm her, Junge.«
»Nein!«
Der große Hahn des schweren Revolvers knackte laut.
»Sie werden es nicht wagen, mich hier auf der Ranch zu ermorden!« keuchte Roger bebend vor Angst.
»Komm her«, sagte der Marshal ruhig.
Langsam kam der Rancherssohn näher.
»Komm heraus«, mahnte Earp.
»Weshalb?«
»Das erfährst du noch. Los, steig durch das Fenster!«
Roger Elliot sah im Augenblick keine andere Möglichkeit, als den Worten des unheimlichen Fremden Folge zu leisten.
Als er draußen neben ihm stand, blickte er zu ihm auf,.
»Was… wollen Sie von mir? Ich habe kein Geld! Außerdem kommen unsere Cowboys jeden Moment vom… Vorwerk zurück. Und der Rancher ist noch vorn in seinem Rechnungszimmer und…«
»Schweig!«
Wyatt packte ihn am Arm und zog ihn mit sich.
Er führte ihn zum Corral.
»Nimm dein Pferd!«
»Nein…«
»Ja, das Pferd, mit dem du vorhin aus der Stadt gekommen bist. Auf den Sattel mußt du verzichten. Wir haben nicht allzuviel Zeit.«
»Wer…«
»Vorwärts!«
Nur Minuten später ritten sie nebeneinander nach Osten, auf den Silver Creek zu.
Dort hielt der Marshal an.
»So, Roger Elliot, sieh dir diese Stelle genau an. Hier erwartet John Barring genau morgen mittag, das heißt jetzt schon heute mittag um zwölf Uhr deinen Vater. Und nur du wirst ihn begleiten. Wenn ihr mehr Leute mitbringt, gibt es Krieg auf der Weide. Blutigen Kampf. Vergiß es nicht! Hier erwartet John Barring deinen Vater, und nur ich werde ihn begleiten. Ihr könnt oben bis zu den Hügeln noch andere Männer mitnehmen, aber nicht bis hierher in die Senke.«
Elliot hatte den Worten des Fremden gelauscht.
Längst hatte er begriffen, wer ihn da so bestimmt und kaltherzig von der Ranch geholt hatte: Das mußte der Mann sein, der jetzt zu Barring gehörte, der schon dem Vater und Skinner eine solche Abfuhr erteilt hatte!
Skinner hatte gesagt: Der Mann ist gefährlich! Sehr gefährlich. Wenn wir ihn unterstützen würden, wäre er unser Untergang. Und vor allem: der ist nicht allein. Der hat eine ganze Crew hinter sich…
Wo war Skinner jetzt? Der Fremde hatte ja auch ihn entführt.
»Hier kommt ihr beide hin, denk dran, Junge. Und denk auch an das, was dir deine Mutter gesagt hat. Sie ist eine gute und kluge Frau. Wenn du dir irgendwelche dummen Scherze einfallen lassen solltest, Roger Elliot, werde ich dir zeigen, was ich mit so rachsüchtigen Burschen, wie du einer bist, anstelle. Hast du verstanden?«
»Ja.«
»All right. Vergiß es nicht, genau um zwölf Uhr. Dein Vater und du. Hier an dieser Stelle!«
»Und… was wollen Sie damit erreichen?«
»Das erfährst du früh genug.«
Roger atmete auf. Er wußte jetzt, daß der Fremde nicht die Absicht hatte, ihn auszulöschen, und bekam sofort wieder Oberwasser.
»Wer sagt uns, daß Barring uns hier keine Falle legt?«
Da griff Wyatt nach ihm und zerrte ihn fast vom Pferd. Ganz nahe war sein Gesicht vor dem des Cowboys.
»Hör zu, Junge, John Barring hat noch niemals jemandem eine Falle gestellt, einen Creek abgezweigt, noch die Prärie angezündet! Daß ihr in keine Falle lauft, liegt auf der Hand. Es ist um zwölf Uhr helllichter Tag. Hier gibt es keine Verstecke. Das Land ist auf mehrere Meilen hin gut zu übersehen. Es kann also gar keinen Hinterhalt geben. Und ich rate dir gut: Kommt!«
»Wenn mein Vater nicht kommen will?« fragte der Bursche trotzig.
»Es ist deine Sache, ihn zu bewegen, hier zu erscheinen!«
Der Missourier ließ ihn los, wendete sein Pferd und setzte über den Creek.
Wie von Furien gejagt, preschte Roger Elliot zur Ranch zurück.
Er ging in sein Zimmer, legte sich nieder und fand doch keinen Schlaf.
Am nächsten Morgen glaubte James Elliot nicht recht zu sehen, als er den Sohn im Hof mit den Cowboys bei der Arbeit fand.
Der Rancher rief ihn zu sich.
»Was willst du hier?« Seine Augen funkelten böse.
»Ich arbeite bis neun Uhr, dann müssen wir uns auf den Weg machen.«
»Bist du verrückt?«
»Nein, Vater. Wir müssen um neun losreiten, damit wir ohne große Eile um zwölf am Silver Creek sind.«
Der Rancher sah sich nach seiner Frau um.
Aber Roger hatte ihr schon alles erzählt.
»John Barring wartet da auf dich, James«, sagte die Frau mit verhaltener Stimme.
»Barring, dieser hinterhältige Halunke! Na warte, ich werde mit den Boys hinreiten, um ihm eins auszuwischen, wovon er sich nicht mehr erholen wird! Das schwöre ich euch!«
»Nein, Vater, wir beide reiten allein.«
»Was willst du? Du Herumtreiber willst mir gute Ratschläge geben?«
Jetzt berichtete Roger, was er zu berichten hatte.
Der Rancher zog die Stirn in tiefe Falten.
»Das ist ja wieder eine Bedrohung. Eine Erpressung! Wenn wir nicht kommen, wollen sie dir also an den Kragen. Eine saubere Geschichte!«
Aber um neun Uhr stieg James Elliot dennoch in den Sattel.
Und sein Sohn Roger ritt hinter ihm her.
Die Cowboys folgten genau im Abstand von einer Dreiviertelstunde. Sie hatten den Auftrag, hinter den Hügeln zu bleiben, wenn der Rancher und sein Sohn den Creek erreicht hatten.
*
Als Sheriff Fenner an diesem Morgen in sein Office ging, sah er das Mädchen vor dem Bureau auf dem Wagen sitzen. Es war Ann Barring, die auf ihn wartete. »Sie müssen zur Ranch kommen, Sheriff!« rief sie ihm zu. Und dann erklärte sie ihm, daß heute mittag ein Versuch gemacht werden sollte, die beiden verfeindeten Rancher auszusöhnen.
»Und was soll ich dabei?« fragte der Gesetzesmann unbehaglich, denn er hatte es bisher immer vermieden, sich um die Feindschaften der großen Rancher zu kümmern.
»Es ist im Juli Blut genug geflossen zwischen den Angehörigen zweier Ranches, Sheriff«, sagte das Mädchen rauh. »Und jetzt sollen Sie dabeisein, um neues Unglück zu verhindern.«
Gregg Fenner hatte absolut keine Lust dazu.
Aber dann sagte Ann: »Wenn Sie nicht kommen, wird der Gouverneur über die Vorgänge im County verständigt. Er wird auch erfahren, daß Sie sich um nichts kümmern!«
Fenner winkte ab.
»All right, aber Sie werden wenigstens gestatten, daß ich mich rasiere und meine Winchester mitnehme…«
Wenig später kam er mit. Steif ritt er auf seinem alten Fuchswallach neben dem Wagen der Barring Ranch entgegen.
Erst als sie nach Stunden durch das Hoftor ritten, tat er den Mund auf: »Seltsame Einfälle hat Ihr Vater plötzlich!«
»Der Einfall stammt nicht von ihm. Dieser Mann dort hatte ihn!«
Sie deutete auf den Missourier, der gerade aus dem großen Scheunenbau kam.
»Wyatt Earp!« entfuhr es dem Sheriff. Mit einem Satz war er von seinem Gaul herunter und lief auf den Marshal zu. »Alle Teufel! Wyatt Earp! Sie sind es wirklich! Ich werde verrückt! Fast hätte ich die Forderung der Miß ausgeschlagen. Sie hätte mir doch ein Wort sagen können, daß Sie hier sind und die Sache in die Hand genommen haben!«
»Dann wären Sie wohl etwas rascher gekommen?« kam da eine Stimme von hinten an Fenners Ohr.
Er fuhr herum und blickte in die eisblauen Augen des Georgiers.
»Doc Holliday!« rief Fenner. »Jetzt schlägt es dreizehn!«
Der Sheriff hatte die beiden Männer vor Jahren unten in Colorado gesehen, als sie in Yampa mit der gefährlichen Bande Chet Nugents aufräumten. Er hatte die beiden sofort wiedererkannt.
Ann Barring stand wie versteinert da.
Wer war der Mann, dieser eigenartige, so selbstsichere Cowboy?
Wyatt Earp? Die kleine Ann Barring glaubte nicht richtig gehört zu haben. Wyatt Earp? Der berühmte Marshal aus Dodge City?
Und der andere Mann, der jetzt erst ganz plötzlich auf den Hof gekommen zu sein schien, dieser elegante Fremde, sollte Doc Holliday sein?
Sie mußte sich an der Armstütze des Wagensitzes festhalten, sonst wäre sie vielleicht heruntergerutscht.
Da trat ihr Vater aus dem Haus.
Ann hielt ihn auf.
»Dad, weißt du eigentlich, wer der Mann ist?«
»Natürlich, das ist Earp.«
»Hast du ihn auch mal nach seinem Vornamen gefragt?«
»Nein, weshalb?«
»Wyatt heißt er. Ganz kurz und schlicht Wyatt Earp. Schon mal gehört den vollen Namen: Wyatt Earp…!«
Der Rancher griff nach seinem Hut und nahm ihn langsam vom Kopf. »Wyatt Earp…«
»Ja, Vater, unser prächtiger Cowboy ist niemand anderes als Wyatt Earp! Sheriff Fenner hat ihn eben laut genug begrüßt. Offenbar kennt er ihn. Und weißt du, wer der andere Mann ist, der da eben aus dem Boden aufgetaucht zu sein scheint?«
Barring sog die Luft tief ein.
»Nein, Ann, das weiß ich nicht. Aber wenn du mir jetzt sagst, daß es Doc Holliday ist…«
»Ist er, Vater.«
Da kam der Marshal schon auf den Rancher zu.
»Es ist bisher alles in Ordnung, Mister Barring. Ich habe den Sheriff rufen lassen, damit auch er dabei ist und sich von der ordnungsgemäßen Abwicklung der Dinge überzeugen kann.«
John Barring musterte den Marshal plötzlich mit ganz anderen Augen. Auch den Spieler sah er forschend an. Den Hut hatte er immer noch in der Hand, als er leise sagte: »Meine Tochter sagte mir eben, daß Sie… Wyatt Earp wären?«
»Ja, das ist richtig. Und dieser Mann ist Doc Holliday. Er wird uns ein wenig den Rücken decken.«
Ann stieg vom Wagen und vermochte die Augen nicht von den beiden Männern zu lassen. Sie war so verblüfft wie ihr Vater, der vor Überraschung ganz vergessen hatte, den Sheriff zu begrüßen.
*
Es war genau Mittag.
Wyatt Earp und John Barring ritten zum Creek hinunter. Dort stiegen sie von den beiden Pferden. Während Barring durch das hier kaum knöcheltiefe Wasser zum jenseitigen Ufer watete, blieb der Marshal bei den Pferden stehen.
Die beiden Männer blickten nach Westen.
»Er kommt nicht«, meinte der Schotte nach einer Minute.
»Er kommt!« beharrte der Marshal.
Und da tauchten in der Ferne auf dem Hügelkamm auch schon zwei Reiter auf, die rasch näherkamen.
James Elliot und sein Sohn Roger kamen heran und stiegen ebenfalls von den Pferden.
Ohne ein Wort der Begrüßung rief Elliot, indem er nach Osten deutete: »Da drüben sind Reiter! Ich habe sie von oben gesehen!«
»Es sind zwei Männer«, entgegnete der Marshal. »Der eine ist der Sheriff und der andere mein Freund Holliday.«
»Wer?«
»Mein Freund Holliday.«
»Wer sind Sie überhaupt?« knurrte Elliot bissig.
»Mein Name ist Earp. Wyatt Earp.«
Da griff sich James Elliot unwillkürlich an den Hals.
»Wyatt… Earp?«
Auch seinem Sohn war die Kehle auf einmal sehr trocken geworden.
Der Fremde sollte Wyatt Earp sein! Der große Marshal, von dem man schon soviel gehört hatte!
»Außerdem haben Sie keinen Grund zur Klage«, rief der Missourier, »denn Ihre Reiter halten oben hinter dem Hügelkamm, also in gleicher Entfernung.«
»Woher wollen Sie das wissen?«
»Ich habe sie gesehen.«
Elliot nickte.
»All right. Und was soll ich hier? Sie sind es also, der mich herbeordert hat, Marshal?«
»Richtig, das habe ich. Weil Sie sich jetzt hier mit Mister Barring vernünftig unterhalten sollen.«
»Ausgeschlossen. Er ist mein Feind, hat mich beleidigt und hat…«
»Ruhe!« donnerte der Marshal über den Creek.
»Sie haben jetzt hier Gelegenheit, alles in Ruhe mit Mister Barring zu besprechen!«
Und dann sprachen sie, die beiden ehemaligen Freunde.
Sie sprachen fast eine Stunde miteinander.
Und dann reichten sie sich auf einmal die Hände.
Ein befreites Lachen brach über die Lippen James Elliots.
»Alter Freund, und ich hielt dich für einen Banditen! Damned! Jetzt such dir endlich ein paar Cowboys, und dann wird es auch bei dir aufwärts gehen!«
Er versetzte ihm einen freundschaftlichen Stoß – und John Barring stolperte zurück, genau in den Creek.
Wyatt Earp fing ihn im allerletzten Moment auf.
Elliot stand mit erschrockenem Gesicht da.
»Geht’s wieder los?« fragte Barring ihn grinsend.
»Um Himmels willen! In diesem Leben nicht mehr, John. Dazu ist es zu kurz. Mach’s kurz und bestell’ June einen Gruß. – Vorwärts, Junge«, wandte er sich an seinen Sohn, »wir haben heute noch eine Menge Arbeit!«
Rogers Augen hingen an dem Marshal. Er hob die Hand grüßend zum Hut und folgte dann dem Vater.
John Barring hatte sich längst aufgerichtet. Verwundert blickte er auf den Marshal, der immer noch im Bachbett kniete.
»Was gibt’s denn da, Mister Earp?«
Wyatt blickte zu ihm auf. »Haben Sie mir nicht mal von einem Indianer erzählt, der von einem Geheimnis des Silver Creeks sprach?«
Barring, glücklich über den guten Ausgang dieses Zusammentreffens mit Elliot, winkte lachend ab.
»Ja, ja, alte Geschichten einer Rothaut!«
Da nahm Wyatt Earp seine rechte Hand aus dem Wasser und hielt ihm ein haselnußgroßes blinkendes Metallstück entgegen.
»Wissen Sie, was das ist, John Barring?«
Der Schotte kniete sofort neben ihm nieder und nahm das Metall in seine verarbeiteten Hände.
»Gold! Allmächtiger! Gold ist im Creek!«
»Und was für Stücke! Hier, da, dort!«
Wyatt nahm noch drei weitere Körner aus dem Sand des Baches.
»Ihr Silver Creek ist Gold wert, Mister Barring. Ich wette, daß Sie bald genug Geld hier herausgeholt haben werden, um sich ein Wassergrabennetz vom Black Trail River in Ihre Weide ziehen zu lassen…«