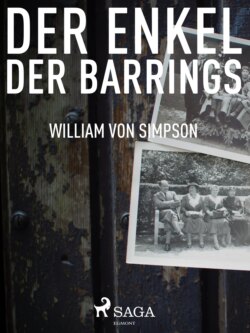Читать книгу Der Enkel der Barrings - William von Simpson - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zweites Kapitel
ОглавлениеAn der Wohnung am Lützowufer, die Mathilde Barring, die Witwe des verstorbenen Wiesenburgers, innehatte, klingelte es. Das Mädchen war gerade abwesend, und so ging Hanna Lamberg, die nun schon über dreißig Jahre lang durch hundert Bande mit den Wiesenburger Barrings unlösbar verbunden war, selbst hinaus, um zu öffnen.
Fast klein, so schlank, daß ihre schwarzgekleidete Gestalt beinahe mager erschien, um den Hals die lange, goldene Uhrkette geschlungen und ein mit lila Bändern geziertes weißes Spitzenhäubchen auf dem noch ganz blonden Haar, ging sie mit schnellen, leisen Schritten durch den halbdunklen Flur und öffnete die Tür.
Erstaunt, ja erschrocken sah sie auf den Depeschenboten.
»Fräulein Lamberg?« fragte dieser geschäftsmäßig kurz.
»Ganz recht«, erwiderte Hanna ein wenig beklommen. »Ein Telegramm? Und für mich?«
Der Bote wies mit seinem dicken Zeigefinger auf die Anschrift. »Jawoll! For Ihnen! Sehn Se hier, Fräuleinche, ganz klipp un klar steht druff ›Fräulein Lamberg‹. Woll’n man hoffen, det wat Scheenet drinstehn möchte. Morjen!«
In einer gewissen Erregung ging Hanna zurück in die Wohnstube, suchte die goldgefaßte Brille hervor, setzte sich auf den mit weinrotem Samt bezogenen Sessel, den einst immer der verstorbene Wiesenburger benutzt hatte, und entfaltete mit bebenden Händen das Telegramm. Es hatte immer etwas Beunruhigendes, beinahe Beängstigendes für sie, eine Depesche zu bekommen. Sie überflog den Inhalt, las ihn dann noch einmal langsam nach, indem sie leise die einzelnen Worte vor sich hin murmelte: »Eintreffe heute acht Uhr, bleibe, wenn möglich, vorläufig bei Euch. Archi.«
Im ersten Augenblick empfand Hanna nichts als Freude über die Aussicht, Archibald wiederzusehen und ihn für einige Zeit zu haben. Allein dann überkamen sie auch schon allerlei Zweifel und Bedenken.
Mein Gott, er schien auf längere, wenigstens unbestimmte Zeit zu kommen. Wie war das nur möglich? Erst in drei Wochen war seine Lehrzeit um. Warum er sie nur so kurz vor ihrem Abschluß unterbrach? – Sollte irgendwas vorgekommen sein, er womöglich Differenzen mit Herrn Lüdemann gehabt haben? Bei seinem zum Aufbrausen neigenden Temperament war das nicht so unmöglich, aber es wäre schlimm, sehr schlimm, sollte sein Scheiden aus Drangwitz vorzeitig und – Gott verhüte es – im Unfrieden erfolgt sein. Auf alle Fälle sollte er es jedoch gemütlich hier haben, der Archi. Blumen wollte sie ihm ins Zimmer stellen und dann für ein ordentliches Abendessen sorgen. Eine gute Klinge schlug er, der Archi. Ihn mit einer Schüssel Gänseklein aufräumen zu sehen war eine wahre Freude. Doch für Gänseklein war noch nicht die Zeit. Von den jungen Gänsen, die schon jetzt an den Markt kamen, schmeckte es nicht kräftig genug. So beschloß sie, Archi ein vernünftiges Rumpsteak mit geschabtem Meerrettich und Bratkartoffeln abzubraten und ihm dann noch ein gefülltes Schaumomelett, das er so gern aß, backen zu lassen. Ein bißchen verwöhnen durfte man ihn schon, dafür war er ja bei der Großmama. Sein Magen sollte nicht zu kurz kommen und erst recht nicht sein Herz.
Am Abend seiner Ankunft hatte Archi die Großmutter nicht mehr gesehen. Sie war leidend, hatte oft mit dem Herzen zu tun und sich deshalb daran gewöhnen müssen, sehr früh zu Bett zu gehn.
»Ich habe der Großmama noch gar nichts von deinem Besuch gesagt, Archi«, hatte Hanna ihm erklärt. »Sie hätte sich möglicherweise aufgeregt und dann kein Auge zugetan. Morgen vormittag, bevor du sie siehst, werde ich sie orientieren. Natürlich nur, soweit es nötig ist. Die unerhörte Bemerkung über deinen lieben Vater, zu der sich dieser Herr Lüdemann hat hinreißen lassen, darf sie nicht erfahren. Es würde sie nur sehr aufregen, und bei ihrem Herzen muß ihr jede Aufregung ferngehalten werden.«
Du lieber Gott, es war wahrhaftig kein Wunder, daß Mathilde Barrings armes Herz unter all den Wechselfällen ihres langen Lebens – sie war nun schon fünfundsiebzig – schwach und krank geworden war.
Was war nur während der letzten sechzig Jahre alles auf sie eingestürmt, was alles hatte sie erfahren an Leid und Not, Erfüllung und Enttäuschung, Freude und Leid! Viel hatte ihr ein gütiges Schicksal im Leben gegeben, mehr ein unbegreiflich grausames ihr im Alter geraubt.
Archi saß in der in Sonnenschein gebadeten Wohnstube, die tausend Erinnerungen in ihm lebendig werden ließ. Er sah auf das alte Sofa, das er kannte, solange er denken konnte. Seine Hand, groß, mager und verarbeitet lag auf dem warmen, weinroten Samtbezug. Blickte er zurück auf die Jahre seines Lebens – es waren immerhin schon fünfzehn oder sechzehn Jahre, die er zurückdenken konnte –, so erschien ihm seine Vergangenheit traumhaft flüchtig, voller Widersprüche und Rätsel.
Die Tür zum Nebenzimmer öffnete sich, und am Arm Hannas betrat die Großmama, auf einen Stock gestützt, im schwarzen Seidenkleid das Zimmer. Auf dem merkwürdigerweise immer noch glänzendschwarzen Haar saß ein Häubchen aus cremefarbenen Spitzen. Ehrerbietig ging Archi ihr entgegen und küßte ihr die Hand.
»Das ist aber mal eine Überraschung, mein Kind. Sei mir willkommen.«
Sie wandte sich Hanna zu. »Ich möchte gern zum Fenster, Fräulein Lamberg. Hier kann ich den Jungen nicht genau genug sehen.«
Am Fenster, im vollen Schein der Mittagssonne, betrachtete sie prüfend den Enkel. Endlich hob sie die Hand und fuhr ihm liebkosend über die Wange. »Großpapas Augen«, murmelte sie. »Wenn du sprichst, ist mir, als hörte ich die Stimme deines Vaters. Komm, gib mir einen Kuß, und nochmals, sei mir von Herzen willkommen.«
Dann saßen sie nebeneinander auf dem Sofa, und die Großmama hielt seine Hand in der ihren, die in einem Halbhandschuh aus schwarzen Filetspitzen steckte. Archi kam das alles beinahe merkwürdig vor. Es geschah so selten, daß die Großmama sich weich und zärtlich zeigte.
»Fräulein Lamberg hat mir erzählt, daß du in Drangwitz Verdruß gehabt und deine Lehrzeit dort vorzeitig abgebrochen hast. Das ist nicht programmäßig. Aber es ist unwichtig, sofern du selbst von der Richtigkeit deiner Handlungsweise überzeugt bist. Was hast du nun für Zukunftspläne?«
»Tante Gisa hat mich nach Bancroft Park eingeladen. Anfang Oktober will ich zu ihr fahren und erst am ersten April zurückkommen.«
»Ich weiß, Archi. Tante Gisa hat mir geschrieben, wie sie sich auf dich freut. Und deine Mutter? Ist sie einverstanden mit deinen Plänen?«
»Ich weiß nicht recht, Großmama. Bestimmtes hat sie noch nicht dazu gesagt. Aber schließlich – sie kann ja eigentlich nichts dagegen haben …«Er stockte, ein nachdenklicher Ausdruck trat in seine Augen. Dann sprach er zögernd weiter. »Allerdings – wie meine Mutter sich jetzt dazu stellen wird, wo ich vorzeitig aus Drangwitz weggegangen bin, das fragt sich. Sie muß ja doch aber einsehen, daß es nicht anders ging.«
»Ich hoffe, daß deine Mutter das einsehen wird«, sagte Mathilde Barring leise und fuhr dann in entschiedenem Ton fort: »Ich wünschte dir die schöne Zeit drüben bei Tante Gisa. Es ist nützlich für einen jungen Menschen, die Welt kennenzulernen. Auch daß du gut Englisch sprechen lernst, ist wünschenswert. Aber danach, Archi, vom April an, was hast du dann vor?«
»Dann möchte ich für ein Jahr in eine Zuckerrübenwirtschaft. Weißt du, Großmama, in eine sogenannte hochintensive Wirtschaft, wie wir sie bei uns in Ostpreußen nicht haben.«
Sie nickte. »Und dann, mein Kind, was dann?«
»Dann muß ich mein Jahr abdienen.«
»Bei den dritten Kürassieren?«
»Nein! Bestimmt nicht! Überall, aber nicht in Königsberg.«
»Nicht im Regiment deines Vaters?« fragte sie erstaunt.
»Nein, Großmama«, gab er schnell, beinahe erregt zurück. »Der Vater – das war selbstverständlich, daß der dritter Kürassier wurde. Er gehörte zu Ostpreußen und bloß dazu. Ich nicht mehr. Ich will mich nicht womöglich über die Achsel ansehen lassen. Das will ich nicht und kann ich auch gar nicht«, schloß er trotzig.
Am einundzwanzigsten September fuhr Archi nach Königsberg, wo am dreiundzwanzigsten die Trauung Alis mit dem Premierleutnant im zwölften Ulanenregiment, Lothar Freiherrn von Gyllenfeld, stattfand.
Ursprünglich hatte Archi der Hochzeit fernbleiben wollen. Der Gedanke, zwischen all den vielen Verwandten und Wiesenburger Bekannten sozusagen Spießruten laufen zu müssen, hatte etwas Abschreckendes für ihn gehabt. Alle Welt redete jedoch so lange auf ihn ein, die Hochzeit seiner ältesten Schwester, mit der er sich von Kind auf innig verbunden fühlte, mitzumachen, bis er sich schließlich dazu entschloß. Die Großmama und Hanna Lamberg, sein Onkel Andreas und Tante Marianne, Onkel Thomas Barring, der älteste Friedrichsthaler Sohn, und nicht zuletzt Onkel Axel Koßwitz, der gerade zum Oberst befördert und Kommandeur der zweiten Gardeulanen war – sie alle hatten seine Anwesenheit in Königsberg für unerläßlich erklärt, so daß ihm am Ende kaum etwas anderes übriggeblieben war, als nachzugeben.
In der eleganten Sechszimmerwohnung Gerda Barrings auf dem Mitteltragheim in Königsberg waren Gäste zum Essen versammelt: Gerdas Brüder Emanuel und Malte und ihre älteste Schwester Adelheid, Axel Koßwitz, die Gräfin Minka Hoyneburgk, Hanna Lamberg und Archi.
Archi, der zum erstenmal in der Königsberger Wohnung seiner Mutter war, sah mit Befremden die prätentiös und aufdringlich wirkenden neuen Sachen, die sich zwischen den alten schönen Wiesenburger Mahagoni- und Nußbaummöbeln breitmachten. Das Wohnzimmer, in dem man um einen großen runden Tisch herumsaß, war ganz neu eingerichtet: modern, unkultiviert, unpersönlich. Warum Gerda mit geringem Aufwand an Geschmack, aber mit viel Geld eine Menge neuer Möbel angeschafft, jene aber, die einst die Räume in Wiesenburg geschmückt hatten, auf den Speicher verbannt hatte, blieb ihr Geheimnis.
Ali und ihr Bräutigam fehlten in diesem Kreise. Sie aßen heute im »Deutschen Haus«, bei den Eltern Lothars, dem Oberst a.D. Freiherrn von Gyllenfeld.
Gerda war zu stark geworden, ihr Haar ziemlich grau, der Mund scharf, die Lippen schmal. Man sah es ihr an, daß sie jetzt eine Frau von über Fünfzig war.
Als die Hoyneburgk für einen Augenblick die Schleusen ihrer Beredsamkeit schloß, erhob sich Gerda und sagte mit einem bezeichnenden Blick auf Archi:
»Wir haben wohl noch einiges zu besprechen, Archibald. Wir wollen das nebenan tun.«
Zu Emanuel und Malte Eyff gewandt, fuhr sie fort: »Ihr tut mir wohl den Gefallen, mitzukommen? Es wäre mir lieber, in eurer Gegenwart mit Archibald zu sprechen.«
Gerda, Emanuel und Malte gingen zum Nebenzimmer – ein Kollegium von Richtern. Archi, in dem beklemmenden Gefühl, wieder einmal dem Versuch seiner Mutter, ihn zu demütigen, ausgesetzt zu sein, folgte ihnen schwer gereizt.
Die Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn wurde im Stehen abgemacht und währte nicht länger als zehn oder zwölf Minuten. Sie spielte sich anders ab, als Archi vermutet hatte.
Überraschenderweise blieb Gerda ganz ruhig. »Über den entsetzlichen Auftritt in Drangwitz will ich nur so viel sagen, daß ich Gott aus tiefster Seele danke, daß er seine Vaterhand schützend über dir gehalten hat; denn sonst … ach, es ist überhaupt nicht auszudenken, was für furchtbare Folgen es hätte haben können, wenn du …« Sie schauderte. »Durch deine schreckliche Heftigkeit wirst du dich noch mal unglücklich machen.«
»Daß ich in Wut geriet, das ist doch bloß selbstverständlich«, fiel Archi ihr ins Wort.
Gerda zuckte die Achseln: »Es lohnt sich nicht für mich, mit dir darüber zu sprechen, was selbstverständlich ist und was nicht. Ich will mich heute nicht aufregen. Ich will nicht! Verstehst du?«
Emanuel hielt es für angezeigt, einzugreifen. Besonders geschickt fing er es nicht an. »Lieber Archibald, selbstverständlich ist für jemanden aus unseren Kreisen, sich in jeder Lage, in jeder, sage ich, zu beherrschen! Es gibt Dinge, die man nicht tut, die einfach nicht gehen. Dazu gehört, daß man seinen Lehrherrn nicht mit Stühlen attackiert. Ich kann mir nicht helfen, aber das ist nun mal so.«
»Und ich kann mir auch nicht helfen«, sagte Archibald sehr erregt. »Wenn einer mir gegenüber Gemeinheiten über meinen Vater behauptet, dann tut er es – wer es auch sei – auf seine eigene Gefahr.«
Malte, der fühlte, wie aufgebracht Archi war, suchte die ihm scheußlich unbehagliche Lage zu retten.
»Wenn du erlaubst, Gerda, möchte ich vorschlagen, die Geschichte auf sich beruhen zu lassen. Schließlich ist sie nicht mehr zu ändern.« Er wandte einen Kunstgriff an. Mit einem Blick auf die Uhr fuhr er fort: »Soviel ich weiß, sagtest du, um sieben sollte zu Tisch gegangen werden? In fünf Minuten ist es soweit.«
Gerda erschrak. »Was? Schon fünf Minuten vor sieben?« Sie schien es plötzlich sehr eilig zu haben. »Mein Gott – ich hab’ noch gar nicht die Suppe und die Soßen abgeschmeckt. Sie kocht ja recht gut, die Schneidereit, aber die Soßen macht sie immer zu lang: ’ne greuliche Manier! ’ne Soße muß kurz sein. Wenn man sie verplempert, schmeckt sie nach gar nichts. Wir müssen pünktlich zu Tisch gehen, sonst verkrischelt der Braten total. Emanuel, tu mir den Gefallen und mach Archibald meinen Standpunkt klar. Ich kann heut keine Szene ertragen! Ich kann es einfach nicht!« Ihr häufig betonter Abscheu vor Szenen bestand in Wirklichkeit nicht. Im Gegenteil, von Zeit zu Zeit hatte sie ein entschiedenes Bedürfnis nach erregenden Auftritten.
Zu Archi gewandt, fuhr sie fort: »Daß man dich, unbeherrscht, unberechenbar und gewalttätig, wie du bist, nicht nach England lassen kann, wirst du wohl begreifen, denk’ ich mir.« Das eröffnete sie dem Jungen, obgleich sie längst bei sich beschlossen hatte, ihn nicht an der Reise zu hindern. Indessen glaubte sie pädagogisch zu handeln, wenn sie ihn noch »zappeln« ließ. Mit einem bekümmerten, ironischen Blick auf Archi, einem undurchsichtig lächelnden auf ihre Brüder ging sie aus dem Zimmer, um die Soße abzuschmecken. Das war jetzt natürlich sehr viel wichtiger als die Auseinandersetzung mit dem Jungen, der ja doch ein ziemlich hoffnungsloser Fall war.
Archi stand da wie jemand, der auf einen harten Kampf gefaßt, aber entschlossen ist, seine Sache durchzufechten.
»Deine Mutter steht auf einem durchaus begreiflichen Standpunkt«, erklärte Emanuel, während er sich bemühte, Nachdruck und Schärfe in seine Worte zu legen. »Man muß – das kannst du keinem Menschen verdenken – darauf gefaßt sein, daß du Tante Gisa und Onkel Harold in irgendwelche Schwierigkeiten bringst.«
»Das glaub’ ich nicht«, unterbrach Archi ihn mit unmißverständlicher Bestimmtheit.
Malte versuchte es auch jetzt wieder mit einem Ablenkungsmanöver. »Verzeih, Emanuel, aber wolltest du dich nicht noch um die Bowle kümmern?«
»Herrjees, die Bowle! Natürlich! Gut, daß du daran denkst.«
Im Grunde durch und durch anständig denkend und sehr gutherzig, innerlich außerdem auf Archis Seite, ließ Emanuel bereitwillig die Bowle als Vorwand gelten, um die Besprechung kurz und schmerzlos zum Abschluß zu bringen.
»Also, streiten wir nicht darüber, ob du falsch gehandelt hast oder nicht. Voreilig war es auf alle Fälle von dir, und, wie gesagt, die Kontenance verlieren, nein, damit macht man sich unmöglich. Das ist etwas, was einfach nicht geht. Dabei muß ich bleiben. Trotzdem haben wir, Onkel Malte und ich und auch Tante Adelheid – die übrigens ganz besonders –, wir haben also versucht, deine Mutter zu bewegen, dich doch nach England ’rüberzulassen. Ja, das haben wir drei ernstlich versucht, mein lieber Archibald. Und es hat sehr, sehr schwer gehalten. Das kannst du mir ruhig glauben! Wir haben uns den Mund fusselig geredet, um deiner Mutter klarzumachen, daß man dir keinen Strich durch die Rechnung machen sollte. Aber – sie hatte taube Ohren. Wir haben getan, was wir tun konnten.« Er legte eine Kunstpause ein, sprach dann weiter: »Ja, so war das, aber … schließlich …«, er richtete sich ein wenig gerader auf und bedachte Archi mit einem ermahnenden Blick, »schließlich ist es uns doch gelungen, und wir freuen uns nun, dir die Englandreise ermöglicht zu haben. Wir rechnen aber mit aller Bestimmtheit darauf, mein lieber Archibald, daß wir es eines Tages nicht bereuen müssen, uns für dich eingesetzt zu haben.«
Der Polterabend im Hotel »Deutsches Haus« war höchst animiert verlaufen. Allerlei Aufführungen und Allotria, ein brillantes Souper, Champagner in Strömen. Bis gegen drei Uhr früh hatte man getanzt, die Jugend wie die Brummkreisel, die älteren Damen und Herren in mäßigen Grenzen und mit ein bißchen wehmütigen, aber doch so schönen Erinnerungen an die allzu schnell verrauschte Jugend.
Der Trauung in der Schloßkirche wohnten einige fünfzig Hochzeitsgäste in etwas miesepetriger Stimmung bei. Die Damen waren mit dem Schlaf zu kurz gekommen, und die Herren hatten bei einem höchst splendiden Gabelfrühstück »Hundehaare aufgelegt«, das heißt, sie hatten ihren Kater vom Polterabend mit sehr viel Bier, Wein und Likör zu bekämpfen versucht.
Aus der Kirche fuhr man in aufgedonnerten, schlecht angespannten Mietequipagen direkt nach Königshalle zum Diner. Eine Weile stand man in den beiden unpersönlichen Salons herum, die den großen Mittelsaal flankierten. Dort war eine riesige Hufeisentafel gedeckt: mäßiges Silber, alltägliche Gläser, dickes Porzellan, das auch durch die auf dem Rand eingebrannte königliche Krone nicht eleganter wurde. Doch die Fülle von Blumen, die auf den Tischen farbenfroh blühten und dufteten, verlieh dem großen Raum ein festliches Gepräge.
Endlich saß jeder auf seinem Platz, hatte den Stuhl zurechtgerückt, die Serviette auseinandergefaltet und fühlte sich für die nächsten anderthalb Stunden vorzüglich aufgehoben.
Archis Tischdame plauderte mit ihrem Nachbarn zur Rechten.
Ein älterer Premierleutnant von Gaißling – Archi kannte ihn so gut wie gar nicht – saß ihm schräg gegenüber. Kein besonders angenehmer Mann. Seine reiterlichen und militärischen Qualitäten sollten, so hörte man, in starkem Mißverhältnis zu seiner Selbstüberzeugung stehen! Mit einer gewissen gönnerhaften Herablassung fragte er über den Tisch hinüber: »Na, wie sieht’s denn aus im Ackerbau und in der Viehzucht, Herr Ökonomierat?«
Archi ignorierte die Frage, bis Gaißling sie wiederholte. Dann lehnte er sie ruhig, aber bestimmt ab.
»Entschuldigen Sie, Herr von Gaißling, aber der Titel Ökonomierat kommt mir nicht zu. Ich darf Sie vielleicht bitten, mich freundlicherweise bei meinem Namen zu nennen.«
Gaißling sah ihn etwas verblüfft an, und sein Gesicht färbte sich tiefer. Die Damen, die Archis Antwort gehört hatten, kicherten, die jungen Leutnants suchten sich das Lachen zu verbeißen.
»Ganz wie Sie wollen, Herr von Barring«, sagte Gaißling und warf Archi dabei einen impertinenten Blick zu, den dieser ruhig erwiderte. »Entschuldigen Sie nur, daß ich Sie irrtümlicherweise zu den Leuten zählte, die Spaß verstehen.« Sehr von oben herab sagte er das.
In diesem Augenblick begannen Archis Gedanken schnell und präzise zu arbeiten. Den Hieb einfach einstecken? Nein – keinesfalls! Er fühlte die Blicke, die sich neugierig, erwartungsvoll auf ihn richteten. Wie wirst du dich nun wohl aus der Affäre ziehen? schienen ein Dutzend Augenpaare zu fragen. Auch Gaißling, eine spöttisch-überlegene Miene zur Schau tragend, sah ihn immer noch an. Man hatte die Unterhaltung eingestellt oder sprach wenigstens leiser. Eine gewisse Gespanntheit lag in der Luft. Die Situation verlangte nach einer Klärung. Irgendwie mußte sie bereinigt werden.
»Zu denen gehöre ich auch, denk’ ich, Herr von Gaißling«, sagte Archi mit kühler Höflichkeit, »aber ich weiß nicht, ob Sie es von der spaßhaften Seite nehmen würden, wenn ich mir erlauben würde, Sie mit Herr General anzureden.«
Damit hatte er den überheblichen Wichtigtuer und eitlen Streber an seiner verwundbarsten Stelle getroffen. Alle Welt nämlich prophezeite Gaißling das Scheitern an der berühmten Majorsecke, in der er auch selbst – verborgen im tiefsten Winkel seines Herzens – eine besorgniserregende Klippe sah. Der zornige Ärger in ihm brauchte ein Ventil. Doch er fand nicht das Wort, mit dem er Archi hätte zerschmettern können, und schließlich schien es ihm am klügsten, den Meinungswechsel mit einem Achselzukken zu beenden. Dann wandte er sich ab und begann eine Unterhaltung mit seiner Tischdame. Archi schien nicht mehr für ihn zu existieren.
Das halb unterdrückte Lachen ringsum, die spöttischen Augen, die Gaißling die Abfuhr, die er sich da eben geholt hatte, quittierten, erleichterten es Archi, mit dem peinlichen Augenblick, dem anmaßenden, um nicht zu sagen nichtachtenden Verhalten seines Gegners fertig zu werden. Er hatte die Empfindung, vielleicht nicht völlig Herr der Lage, auf keinen Fall jedoch der unterlegene Teil zu sein.
Archi sah zu Ali hinüber. Seine Tischdame war vollauf beschäftigt. Der junge Offizier zu ihrer Rechten machte ihr heftig den Hof.
Ali, die ein wenig verschüchtert zwischen Lothar und seinem Vater saß, machte ein Gesicht, als ob sie vor einer immer noch kaum zu begreifenden Lage stände und sich ein wenig bang fragte: »Wohin?«, ohne eine Antwort darauf zu finden. Sie wußte nur, es ging ins Unbekannte, und in der reinen Torheit ihres jungen Herzens glaubte sie, es hinge nur von Lothar ab, sie in eine glückliche Zukunft zu führen. Sie ahnte nicht, daß auch er unbekanntes Land betrat, das sie beide erst zusammen erobern mußten.
Die Gyllenfelds, eine alte Soldatenfamilie, aus der viele den preußischen Königen mit Auszeichnung gedient, für sie gekämpft und auch ihr Leben gelassen hatten, kamen aus einer anderen Welt als die Barrings, die nur auf eigenem Grund und Boden wirklich glücklich sein, nur aus ihm Schwung und Kraft schöpfen konnten. Den Gyllenfelds wurde ihr Soldatentum zum Daseinszweck. Daran gewöhnt, alle fünf oder sechs Jahre die Garnison zu wechseln, vermochten sie kein rechtes Verhältnis für die beglückende Verbundenheit mit der festen Heimat aufzubringen. So klaffte – wie hätte es auch anders sein können? – zwischen der Einstellung Alis und der Lothars ein Riß.
Archi hob grüßend sein Glas, und während Alis Augen wärmer und zuversichtlicher blickten, nickte sie ihm zu. Dann sagte ihr Schwiegervater etwas zu ihr, so daß sie sich ihm zuwenden mußte. Von Belang schien es nicht zu sein. Jedenfalls verlor sich das Lächeln, und ihr Gesicht nahm den unpersönlichen Ausdruck konventioneller Höflichkeit an.
Als Gerda schließlich die Tafel aufhob, atmete Archi auf.
Endlich wurden die Flügeltüren zum Festsaal geöffnet, ein Leutnant von den zwölften Ulanen und ein Dragoneroffizier zogen sich eilig weiße Handschuhe an und übernahmen sozusagen das Kommando, das heißt, ihr Amt als Vortänzer. Das Orchester ließ die »Aufforderung zum Tanz« ertönen, um dann in die melodiösen Rhythmen des Faustwalzers überzuleiten.
Das junge Paar eröffnete den Ball. Gyllenfeld tanzte elegant, gelassen und in der festen Überzeugung, eine höchst brillante Figur zu machen; Ali war unter dem Kreuzfeuer der hundert Augen erst ein wenig steif und verlegen. Aber bald geriet sie ganz unter den Einfluß der Musik, ihre Bewegungen wurden weich und schmiegsam, sie vergaß all die vielen Menschen um sich her, und mit Temperament und der ihr eigenen natürlichen Grazie tanzte sie leicht und beschwingt den Walzer zu Ende. An den Gehtänzen, der Quadrille à la Cour und der Française, beteiligten sich auch die älteren Herrschaften: gemessen, gefühlvoll und mit ein wenig forcierter Grazie bewegten sie sich nach den Kommandos der Vortänzer, die sich bemühten, ihre Befehle in möglichst elegantem Französisch durch den Saal zu schmettern.
Endlich konnte Archi den Moment abpassen, Ali, um die die Herren sich rissen, zu einem Walzer zu holen. Nach der zweiten Runde schon flüsterte sie ihm zu: »Komm, Archi! Wir setzen uns irgendwo. Sonst komm’ ich überhaupt nicht dazu, noch ein bißchen mit dir allein zu sein.«
Nun saßen sie in einer stillen Ecke in einem der Nebenräume und wußten beide erst nicht so recht, was sie einander sagen sollten.
Schließlich fragte Archi: »Freust du dich auf eure Hochzeitsreise, Ali?«
»So schrecklich nicht, Lo will nach Italien. Mir liegt ei’ntlich nichts an Rom. Vielleicht, daß ich ihm Rom doch noch ausreden kann.«
»Wie lange bleibt ihr in Berlin?«
»Möglichst lange, wenn es nach mir geht.«
»Werden wir uns in Berlin noch mal sehen?«
»Das denk’ ich bestimmt.«
»Weißt du, Ali, dann wollen wir sehen, daß wir …« Er stockte, schien nicht recht zu wissen, ob er das, was ihm auf der Zunge schwebte, aussprechen sollte. Doch Ali half ihm gleich. »Ich weiß, glaub’ ich, was du sagen wolltest. Daß wir beide dann ein paar Stunden für uns allein haben wollen. War es das?«
»Offen gestanden, ja.«
»Siehst du, Archi! Natürlich, wir müssen uns noch mal allein haben!« sagte sie schnell. »Wir beide allein mit der Hanna. Wir essen mal abends irgendwo zusammen. Und dann sprechen wir über alles. Vom Vater und von Wiesenburg und von Karl und August und überhaupt …«
»… über alles. Auch von den Pferden und dem Wald und Barbknechts und Finks und über alles andere.«
Plötzlich standen ihre Augen voller Tränen. »Ach, Archi«, sagte sie, »wie dumm! Zu albern wirklich!«
In gemacht forschem Ton warnte er sie: »Heul nicht, Ali. Sonst fang’ ich auch an.« Nun begannen sie zu lachen, doch hinter diesem ein wenig gewaltsamen Lachen weinten sie um das, was gewesen war.
»Werden – wir – du und ich – auch in Zukunft immer zusammenhalten, Ali?«
Sie sah ihn fragend an. Was meinte er nur? Über etwas, was selbstverständlich war, was gar nicht anders sein konnte, brauchte man doch nicht erst zu sprechen. Statt ihm zu antworten, sah sie sich schnell nach allen Seiten um. Kein Mensch beobachtete sie. Dort hinten standen, ganz vertieft in ihr Gespräch, zwei Herren und rauchten wie die Kaminschlote. Mit einer kindlichen Bewegung legte sie den linken Arm um ihn, zog seinen Kopf zu sich herab und küßte ihn.