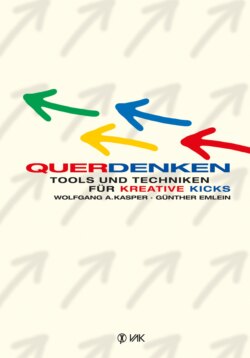Читать книгу QuerDenken - Wolfgang A. Kasper - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWas es mit Kreativität auf sich hat
Erste Annäherungen an einen schillernden Begriff
Die allgemeinen Vorstellungen von „Kreativität“ decken einen weiten Bereich ab. Sie beziehen sich auf genial begabte Literaten, Künstler und Musiker bis hin zu den als kreativ geltenden Grafikern, Designern und Werbefachleuten. Ursprünglich ganz auf den musisch-künstlerischen Bereich bezogen, scheint Kreativität Ausdruck besonders begabter Genies und Zeichen elitärer Berufe zu sein, ohne dass es hier für die überwiegende Mehrheit der Menschheit etwas zu erlernen und sich anzueignen gäbe. Kreativität wurde etwas Besonderes, und nicht jede und jeder verfügt darüber. Kreativität hat man oder man hat sie eben nicht – so könnte ein landläufiges Vorurteil lauten. Also nichts für jedermann?
Oder doch? Nicht erst seit dem Mitte der 90er-Jahre erschienenen Bestseller „Emotionale Intelligenz“ von D. Goleman gibt es Hinweise darauf, dass Führungskräfte in der Wirtschaft wichtige unternehmerische Entscheidungen „aus dem Bauch heraus“ treffen. Solche Entscheidungen bedeuten nicht ein irrationales, auf spontane Emotionen gegründetes Verhalten, sondern beinhalten nach Abwägung sämtlicher sachlich-inhaltlicher Gesichtspunkte eine Entscheidungsqualität, die rational begründete und kreativ-intuitive Kompetenzen kombiniert und vereint. Kreativität scheint ein Zusammenwirken von Gaben zu sein, die in der Regel alle Menschen haben. Es bleibt jetzt nur noch miteinander zu kombinieren, was vorher noch nicht in Beziehung gebracht wurde. Das würde heißen: Jeder Mensch kann auf seine ganz persönliche Weise sehr wohl kreativ sein.
Ein Blick in den Brockhaus verhilft zu einer vorläufigen Definition von Kreativität: Kreativität ist „schöpferisches Vermögen, das sich im menschlichen Handeln oder Denken realisiert und einerseits durch Neuartigkeit oder Originalität gekennzeichnet ist, andererseits aber auch einen sinnvollen und erkennbaren Bezug zur Lösung technischer, menschlicher (…) Probleme aufweist.“
Dabei stammt „kreieren“ von dem lateinischen Wort „creare“, was so viel wie „schaffen“, „schöpfen“ und „erzeugen“ heißt. In biblischer Tradition ist die „Kreatur“ das von seinem göttlichen Schöpfer geschaffene und somit ins Leben gerufene Wesen. Mit dem biblischen Schöpfungsauftrag, dass der Mensch die Erde „bebauen und bewahren“ solle, ist der Grundstein gelegt für die „schöpferische“ Schaffenskraft aller menschlichen Kreatur.5 Ein Blick in die aktuelle Literatur zu diesem Thema zeigt eine weitgehende Übereinstimmung in der Beschreibung von Kreativität – sei sie individueller oder organisationeller Natur. Exemplarisch seien die beiden folgenden Definitionen aufgeführt:
„Demnach ist Kreativität die Fähigkeit, neue Lösungen bzw. neue Ideen zu finden“ (Knieß, S. 1);
„Kreativität als Potential des Menschen, als Ausdruck für Problemlöse- und Kombinationsfähigkeit, als Gestaltungsbedürfnis, wird zum Schlüsselfaktor unternehmerischer Produktions- und Leistungsherstellung“ (Blumenschein/Ehlers, S. 11).
Gerade diese beiden Zitate zeigen, dass Kreativität ein Wechselspiel mehrerer Eigenschaften zu sein scheint: Findigkeit, Kombinationsgabe, Gestaltungsfähigkeit und das Verlassen alter, ausgetretener Geleise.
Die Anfänge der Kreativitätsforschung
Obwohl sich die wissenschaftliche Psychologie seit mehr als hundert Jahren mit den Möglichkeiten der Lokalisierung und Messung menschlicher Intelligenz beschäftigt und auf diesem Gebiet breite Forschung betrieben wird, gilt dies für den Bereich der Kreativität nicht annähernd in einem vergleichbaren Umfang. Vielmehr führt diese bis heute tendenziell ein Schattendasein innerhalb der Forschung. Dem Thema kann man sich also nur Schritt für Schritt annähern.
Eine erste Wende in der Kreativitätsforschung bildete der bekannte „Creativity“-Vortrag des Psychologen J. P. Guilford 1950 in den USA, der die Einführung von Testverfahren zur Evaluation von Kreativität vorschlug. Er prägte auch das Bild von einem „divergenten“ Denken, das charakteristisch für kreative Persönlichkeiten sei, gegenüber einem „konvergenten“ Denken, das auf logisch ableitbare, korrekte Lösungen abziele und damit Ausdruck notwendiger Routine sei. In der Folge stieg das wissenschaftliche Interesse an dem Phänomen Kreativität deutlich an. Nicht zuletzt der „Sputnikschock“ in den USA, der durch den Start des ersten Satelliten der damaligen Sowjetunion ausgelöst worden war, führte zu einer verstärkten Förderung neuer, intelligenter und kreativer Köpfe.6 Eine bis heute in vielen Abwandlungen genutzte intuitiv-kreative Technik ist das schon 1963 von Alex Osborn entwickelte Brainstorming („Ideenwirbel“), das vielfach in Gruppensituationen bei der Ideensuche eingesetzt wird.
Zu den bedeutenden Entwicklern von Kreativitätstechniken ist ebenfalls Edward de Bono7 zu zählen, der den Begriff des „lateralen“ oder „spielerischen“ Denkens geprägt hat, das am ehesten mit „QuerDenken“ übersetzt werden könnte. Dabei geht es um eine möglichst vielfältige, mitunter unkonventionelle Suche nach neuen Lösungen, die sich mit herkömmlichen (mentalen) Methoden nicht immer erschließen lassen.
Bis in die Gegenwart ist die interessante Frage nach dem Zusammenhang zwischen Intelligenz und Kreativität in der Forschung völlig ungeklärt: Ist Intelligenz eine notwendige Voraussetzung für Kreativität oder nur eine hinreichende Bedingung, damit Menschen einfallsreich und innovativ werden können? Demgegenüber mehren sich die Stimmen, die die klassische IQ-Forschung hinter sich lassen und ein multiples Modell der Intelligenz favorisieren und dabei die Annahme einer „kreativen Intelligenz“ vertreten.8
In jüngster Zeit zeichnen sich vor dem Hintergrund neuer Untersuchungsmethoden in der Gehirnforschung beziehungsweise den Neurowissenschaften hoffnungsvolle Entwicklungen ab, die die Kreativität „von ihrem Mauerblümchen-Dasein befreien und ihre weitere Erforschung gleichberechtigt zu der der Intelligenz vorantreiben“.9
Merkmale kreativer Menschen
Nicht immer scheint die eigene Kreativität oder die der Mitarbeiter in einer Organisation besonders hoch im Kurs zu stehen. Schnell machen sich Skepsis und Widerstände breit, wenn es gilt „kreatives Chaos“ abzuwehren. Vielfach mischt sich hier auch die Befürchtung, dass Kreativität zwangsläufig etwas mit Desorganisation und Missmanagement zu tun haben müsse. Nun haben aber gerade Kreativitätsforscher und -entwickler wie T. Buzan, M. Csikszentmihalyi und H. Gardner gezeigt, dass es charakteristische Parameter für kreatives Verhalten am Arbeitsplatz gibt, das sich durch klare Kompetenzen und einen hohen Grad an Selbstorganisation auszeichnet. Die folgenden typischen Merkmale finden sich in der Literatur auf breiter Basis bei jeweils unterschiedlicher Gewichtung der einzelnen Faktoren:
✓ Allgemeines Interesse und Freude an der eigenen Arbeit.
✓ Hohe Flexibilität angesichts neuer Aufgabenprofile.
✓ Reflexion aktueller Arbeitsabläufe mit Blick für effiziente Veränderungen.
✓ Antizipation, d. h. Aufspüren künftiger Aufgaben- und Problemstellungen.
✓ Problemsensitivität, die kontinuierlich an ergebnisorientierten Lösungen interessiert ist.
✓ Fehler-/Frustrationstoleranz, die eigene und fremde Unzulänglichkeiten als nützliches Feedback betrachtet und als sinnvolle Information für die Zukunft nutzbar macht.
✓ Intuition und kreative Intelligenz, die es ermöglichen, Entscheidungen und Handlungsabläufe sachgemäß vorzubereiten und durchzuführen.
Phasen der Kreativität
In der Regel lassen sich die folgenden Phasen im kreativen (Schaffens-)Prozess unterscheiden, wobei es hier im Detail unterschiedliche Möglichkeiten der Differenzierung gibt10:
Auch wenn die letzte Phase streng genommen nicht mehr zum Kreativitätsprozess im engeren Sinne gehört, so ist sie innerhalb einer Organisation letztlich von entscheidender Bedeutung; denn was würde ein kreativer Einfall nach dem anderen nützen, wenn er ein ums andere Mal an der harten institutionellen Wirklichkeit scheitern würde.
Kreativität und „Flow“
Das bislang bekannteste Konzept zu einem umfassenden Verständnis von Kreativität hat M. Csikszentmihalyi vorgelegt. Er geht davon aus, dass es kreativ-intuitiv begabten Menschen häufig gelingt, in einem kontinuierlichen Erlebensprozess des „Flow“ zu sein. Damit ist gemeint, dass „Tun und Bewusstsein“11 regelrecht verschmelzen und sich die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Teilausschnitt der wahrgenommenen Wirklichkeit konzentriert. Durch diese innere Absorption auf einen ausgewählten Gesichtspunkt der Arbeit entsteht eine Art Tranceerleben, das bestimmte Affekte wie Freude und Glück hervorbringt. Ein kreativer Flow wäre demnach die Fähigkeit, sich mental so auf seine jeweilige Arbeit einzustellen, dass man gleichsam eins mit seiner Aufgabe wird und sich damit auf eine konzentrierte und entspannte Art und Weise zugleich, in einer Art „Wachtrance“ befindet. Das mag zwar zunächst etwas ungewohnt und recht optimistisch klingen, denn schließlich wissen wir alle, dass Arbeit nicht zu allen Zeiten und unter allen Umständen mit Freude und Lustgewinn verbunden ist. Allerdings kennen viele Menschen bei Beschäftigungen in der Freizeit, bei Spiel- oder Sportaktivitäten, wie sehr man alles um sich herum vergisst und völlig im jeweiligen Tun aufgeht und dabei auch die Zeit bisweilen still zu stehen scheint. Kinder und Heranwachsende verfügen in der Regel noch ausgezeichnet über diese Fähigkeit in einem beständigen Flow zum Beispiel zu spielen oder zu lesen.
Während ein kreativer Flow gleichsam den mentalen Rahmen bildet, innerhalb dessen Menschen ihre guten Ideen und Einfälle entwickeln können, ist die Fähigkeit zum QuerDenken das Medium oder das Vehikel, mit dessen Hilfe Lösungen für anstehende Aufgaben gewonnen werden können. QuerDenken erlaubt es, problemfixierte Gedanken wieder zum „Fließen“ zu bringen, wodurch in der Folge wiederum etwas „Neues“ entstehen kann.
Es geht im Grunde um die Fokussierung der eigenen Aufmerksamkeit in eine gewünschte, lösungsorientierte Richtung. In diesem Prozess werden gleichermaßen rational-bewusste und intuitivunbewusste Gedankenprozesse einbezogen. Das jeweilige Verhältnis von Rationalität und Intuition ist je nach Persönlichkeit und nach Aufgabe unterschiedlich. Aber generell gilt: Es sind immer beide Persönlichkeitsanteile oder „Denkstile“ („GeradeDenken“ und „QuerDenken“) miteinander verwoben.
Kreativität – göttliche Eingebung oder erlernbares Wissen?
Während die einen sich skeptisch gegenüber „Programmen, die Kreativität (…) fördern wollen“12 zeigen, sehen die anderen Anhaltspunkte für eine systematische Steigerung der eigenen Kreativität. Der Einwand ist gewiss berechtigt. Denn Kreativität ist ein spontan-emotionaler Prozess. Diesen kann man auch mit noch so guten Programmen nicht herbeizaubern. Was man hingegen tun kann und was wir entsprechend in diesem Buch vorschlagen: Man kann die Rahmenbedingungen verbessern, so dass der spontane Fluss des Kreativen sich leichter entfaltet – unsere Tools und Techniken unterstützen Sie dabei.
Doch in der Tat muss hier ein jeder selbst entscheiden, wie sehr er die diversen Tools einsetzen mag, um seine kreativen Kompetenzen zu erweitern. Auch wenn es den meisten Menschen dieser Welt zu Lebzeiten nicht vergönnt bleiben sollte, so genial und einfallsreich wie ein Leonardo da Vinci, Albert Einstein oder ein Walt Disney zu werden, so reicht es doch möglicherweise schon völlig aus, wenn jede und jeder das glückliche Maß an Kreativität entfaltet, das ihr und ihm selbst sowie der eigenen Umgebung gut tut und das Leben bereichern hilft.
Checkliste: Kreative Persönlichkeit
Welche Fähigkeiten fallen Ihnen spontan ein, mit denen Sie in der Vergangenheit ein (schwieriges) Problem erfolgreich gemeistert haben?
In welcher Hinsicht könnte Ihnen ein flexibler Denkstil nützlich sein, wenn Sie ein komplexes Thema bearbeiten müssen?
Wie gut gelingt es Ihnen in der Regel, sich selbst und andere zu motivieren und wenn nötig einen Teamgeist zu entfachen?
Wo halten Sie selbst im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein gewisses Maß an Kreativität beziehungsweise Originalität für wünschenswert oder gar geboten?
Wie gut gelingt es Ihnen, an einer gestellten Aufgabe konsequent weiterzuarbeiten, auch wenn damit gelegentliche Rückschläge verbunden sind?