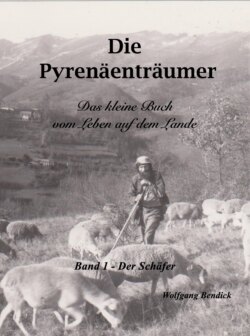Читать книгу Die Pyrenäenträumer - Der Schäfer - Wolfgang Bendick - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAFFEE IN PARIS
ОглавлениеLudwig hatte sich bereit erklärt, mit mir für einen Monat in die Pyrenäen zu fahren und bei der Hausrenovierung zu helfen. Wir hatten den Dienstag als Abfahrtstag ausgesucht. Doch stellten wir bald fest, dass das der Faschingsdienstag war. Das war uns zu riskant, an einem solchen Tag aufzubrechen, mit all den angeduselten Fahrern unterwegs. Wir verschoben alles um einen Tag. Und das war auch besser, wie uns die vielen Autowracks auf der Strecke bewiesen!
Mit unserem Umzugsgut im Auto und dem Anhänger war es nicht ratsam, die Schweiz zu durchqueren, obwohl das der kürzere Weg war. Am Bodensee entlang kamen wir in den Schwarzwald. Nebel lag in den Tälern und ließ uns nicht schnell vorwärtskommen, vor allem, weil wir Schaffhausen, die Schweizer Enklave weiträumig umfahren mussten. Wir hatten unseren VW-Pritschenwagen maximal vollgeladen, mit all dem, was wir augenblicklich zuhause nicht brauchten. Auf die Plane hatten wir zudem eine sechs Meter lange Holzleiter draufgebunden, Geschenk meines Vaters, da die Eltern in ein ebenerdiges Haus umgezogen waren. Hinten dran, im Anhänger befand sich der Motormäher und die mit dreihundert Metern Seil ausgerüstete alte Heuwinde, zugepackt mit anderen Geräten, alles sorgfältig mit Stricken verschnürt.
Wir durchfuhren ein kleines Dorf. „Schau mal, da!“, rief Ludwig. „Die Bäckerei?“, erwiderte ich fragend. „Genau in dem Schaufenster, besser gesagt, auf dem Sims habe ich die letzte Silvesternacht verbracht!“ „Nicht gerade der beste Platz!“, gab ich zurück. „Doch, denn aus dem Gitter davor im Boden stieg eine warme Luft hoch, vielleicht, weil da die Backstube ist.“ „Ich könnte mir was Besseres vorstellen! Kamst du von einer Feier zurück, oder warum…?“ „Nein! Wir waren gerade zu Hause voll am Feiern, da hatte ich Lust, schnell in Paris einen Kaffee zu trinken. Du weißt ja, wir waren alle mal da hingefahren, mit deinem ersten VW-Bus… Und da hab ich mich halt an die Straße gestellt und hab den Daumen rausgehalten. Um zwei Uhr früh war ich hier. Und dann Sense! Als dann die Bäckerei aufgemacht hat, hab ich mir einen warmen Semmel geholt und mich auf die andere Straßenseite gestellt!“
Bei Huningue fuhren wir über den Rhein und wollten über die Grenze. Hier war eine Großbaustelle. Anscheinend wurde der Grenzübergang modernisiert für den LKW-Verkehr. Vor lauter Umleitungsschildern und Nebel hatten wir wohl den Zoll übersehen und sahen plötzlich das erste französische Ortsschild neben der Straße. „Nix wie aufs Gas und weiter!“, meinte Ludwig. „Sowieso! Das hat uns Ärger erspart!“, stimmte ich zu.
Nach zwei Tagen kamen wir auf dem Campingplatz, wo unser Wohnwagen auf uns wartete, an. „Kaufen sie, kaufen sie!“, empfing uns der Eigentümer, „Der französische Franc ist gefallen, die deutsche Mark ist jetzt viel mehr wert!“ Hatte der vergessen, dass wir schon vor zwei Wochen gekauft hatten? Wir besorgten uns ein paar Flaschen Rotwein, Käse und Baguettes und feierten unsere Ankunft in Frankreich. Früh am nächsten Morgen fuhren wir in das Dorf, in dessen Nähe unser Hof lag. Ich konnte es kaum erwarten, den Fuß auf unser eigenes Land zu setzen! Vorher hielten wir an dem Haus an, wo wir unsere Sachen deponiert hatten. Doch das Schloss war weg und man konnte so rein. Trotz des Halbdunkels bemerkte ich, dass jemand alles durchgeschaut hatte. Hoffentlich hatte sich niemand daran bedient! Wir wollten gerade wieder zumachen, da stand ein etwas dicklicher Jugendlicher vor uns. Er hatte einen runden, stoppelhaarigen Kopf und paffte eine Zigarette mit diesem stinkigen, grauen Tabak, dem ‚Caporal‘, den anscheinend jeder Schäfer hier rauchte! Er grinste uns an und nuschelte etwas Unverständliches. Konnte denn niemand hier Französisch? Doch! Als er merkte, dass wir nicht verstanden, wiederholte er, etwas verständlicher: „Un sacre bazar, ce que vous avez là-dedans!“ Was meinte der mit ‚Bazar‘, vielleicht unsere hier deponierten Sachen? Also war er da drinnen gewesen! Und der frühere Eigentümer unseres Hofes, dem dieses Haus gehörte, auch, denn der hatte ja den Schlüssel dafür! Es war besser, nichts mehr hier zu lassen, und alles, was wir dabeihatten, gleich hoch zum Haus zu schaffen!
Wir ließen den Typen stehen und machten uns auf den Weg nach oben. Der Weg war nicht besser geworden und Ludwig musste sich auf die Deichsel des Anhängers stellen, um Gewicht auf die Hinterachse zu bringen, damit wir es den Berg hoch schafften. An der Abzweigung, die auch als Wendeplatz diente, stand natürlich schon Fernand, der Nachbar im Blaumann. Er mochte auf die 80 zugehen! Steht der immer da, oder hatte er schon von weitem das Rutschen unserer Räder gehört, als wir den Berg hochgeschliddert waren? Er begrüßte mich wie einen alten Bekannten. Zusammen gingen wir bis zu dem Brombeergestrüpp, durch das wir damals einen Pfad getreten hatten, um zum Haus zu gelangen. Wir bemerkten, dass sogar ein befahrbarer Weg bis hierher ging und sogar noch ein Stückchen weiter. Dieser war mir vorher nicht aufgefallen, wohl wegen des vielen Gestrüpps. Es gab da sogar eine etwas breitere Stelle, bis wo wir den Anhänger rangieren konnten, um ihn dort abzustellen.
Zuerst holten wir die Sense und ein Hackmesser aus unserer Ladung und hackten damit die ärgsten Ranken ab. Zu unserer Überraschung fanden wir darunter einen in den Hang gegrabenen und gepickelten Weg, wie eine Rampe, der zu der Wiese, die unterhalb des Hauses lag, hinaufführte. Gegen Mittag hatten wir uns durch die vertrockneten Brombeeren von mehreren Jahren durchgesenst. Wir waren gehörig verschrammt! Doch wenigstens sahen wir jetzt klarer! Es gab einen etwa 1,50 Meter breiten Zufahrtsstreifen bis in die Wiese. Der Nachbar, der uns eine Weile auf den Fersen war, hatte mir erklärt, dass der frühere Besitzer da mal mit einem kleinen Allrad-Traktor hochgefahren war, aber sich fast überschlagen hätte. Diese Rampe kam uns wie gelegen für unser Wagen-Windensystem!
Wir machten uns an den Aufstieg zum Haus. „Die Hütte sieht ja nicht so verfallen aus, wie du behauptet hast. Ich hab mir eine Ruine vorgestellt, und das ist ja mehr eine Burg!“, meinte Ludwig. Von hier sah das Gebäude mit seiner wohl 25 Meter langen Vorderfront stattlich aus. „Warte, bis wir drinnen sind!“, erwiderte ich. Je näher wir kamen, umso mehr wurde sichtbar, dass der Verfall schon weit fortgeschritten war. Doch seit unserem ersten Besuch hatte sich nichts verändert. Wir mussten mit Gewalt die Tür aufstoßen, um in den Keller zu gelangen. Das kam wohl daher, dass die Balken, die die Türöffnung bildeten, etwas nach unten weggesackt waren, weil da Feuchtigkeit rangekommen war. Zwei Zentimeter unten an der Tür mit der Motorsäge abgenommen, würden diese wieder beweglich machen! Auf jeden Fall müsste da eine mit Scheiben rein, denn im Untergeschoss waren die Fenster winzig. Ein kühler Hauch schlug uns entgegen, leicht moderig, aber vor allem von Russ. Nach einem kurzen Blick in das Innere setzten wir uns an die sonnenwarme Hauswand und machten erst mal Brotzeit.
Anstatt eine Siesta zu machen, stiegen wir wieder hinunter und banden unsere Ladungen los. Als erstes luden wir den Motormäher vom Hänger und warfen ihn an. Mit den Brecheisen schoben wir anschließend den V-förmigen Rahmen der Winde mitsamt Zubehör vom Hänger hinunter und befestigten ihn mit Seilen hinter dem Mäher. Die Idee war, die Winde mittels des Mähers den Hang hinauf zu ziehen. Doch war diese sicher ebenso schwer wie der Motormäher. Der Mäher drehte leer durch, hüpfte auf der Stelle und fing an, sich langsam einzugraben. Wir hatten eine übrige Achse von unserer Wagenkonstruktion auf dem Hänger. Ich hatte sie behalten, weil es sicher mal eine Anwendungsmöglichkeit geben würde. Und das war jetzt! Wir banden sie unter den Windenrahmen. Somit schleifte jetzt nur noch dessen hinteres Ende auf der Erde. Während ich mit voller Kraft die Holme des Mähers schob hebelte Ludwig mit einem langen Ast das Hinterteil der Winde vorwärts. So 10cm-weise ruckelten wir den Hang hinauf. Das erste, steilste Stück war am schwersten. Als wir das hinter uns hatten und das Haus sichtbar war, ließen wir uns erst mal ins Gras fallen. Da lagen wir eine gute Weile mit keuchendem Atem.
Anschließend schufteten wir uns stückchenweise weiter den Hang hoch. Der Motor roch nach heißem Öl, uns lief der Schweiß und uns fehlte die Luft. Doch die Teile mussten da hoch, sonst wäre jeder Transport unmöglich, da ja keine Zufahrt zu dem Anwesen bestand. Zum Glück! Denn sonst hätte das Anwesen bestimmt das Doppelte gekostet und wäre als Wochenendhof an reiche Deutsche von Airbus in Toulouse verkauft worden. Nach zwei Stunden hatten wir es geschafft! Die Winde stand im Hof, wir machten den Motor aus und ließen uns auf die Erde fallen. Wir waren am Ende. Einen solchen Kraftakt hatte niemand von uns zweien jemals zuvor geleistet! Unsere Köpfe dröhnten, in der Brust schlug das Herz wie eine Rüttelmaschine, unser Atem pfiff keuchend durch den vom heftigen Luftholen wunden Rachen. Der Mund klebte vor Schleim und hatte einen bitteren Geschmack. Wir waren triefnass vom Schweiß. Wir lagen wohl zehn Minuten wortlos da, alles in uns schien wie ausgelaugt. Doch der Körper ist ein guter Sklave! Treu unterwarf er sich nach einer Viertelstunde wieder unserem Willen und stand auf.
Von hier sahen wir nun gut den zukünftigen Verlauf der ‚Seiltrasse‘. Wir verankerten den Unterbau der Winde mit zwei Eisenstangen, die wir so tief es ging mit dem Vorschlaghammer in den leicht feuchten Untergrund schlugen. Wir trugen den Untersatz für den Motormäher nach oben. Dieses war eine Holzbalkenkonstruktion, in die man den ganzen Mäher setzen konnte, damit er nicht wegrollte. An die Stelle des Mähbalkens schraubten wir eine Flanschplatte mit einem kugelgelagerten Zapfwellenstummel daran, die wir zusammen mit einem Mechaniker bei der Baywa gebaut hatten. Das waren Teile aus dem Schrott, die wir zurechtgeschnitten und zusammengeschweißt hatten. Diesen Stummel verbanden wir mittels einer Kardan-Zapfwelle mit der Winde. Nun konnte es losgehen! Ich stellte die Winde auf Leerlauf und wir schleppten das Ende des 300 Meter langen Stahlseiles zu Tal. An zwei Stellen musste das Seil einen Knick machen, wegen des Geländeverlaufes. Hier schlugen wir je einen Pfosten in die Erde, so weit, dass er noch zehn Zentimeter rausragte. Um diese herum lief nun das 8-Millimeter-Seil bis zur Straße im Tal, wo die Fahrzeuge standen.
Wir befreiten den sargförmigen, zweiachsigen Wagen aus dem Pritschenwagen und hängten ihn an das Seil. Hoffentlich würden die Reifen die am Wegrand wachsenden Dornen aushalten! Wir beluden den Wagenaufsatz mit Kleinkram, um keine Leerfuhre zu machen. An der Deichsel befanden sich an drei verschiedenen Stellen Ösen, worin man das Zugseil einhängen konnte. Dieses sollte als ‚Lenkhilfe‘ dienen. Vielleicht könnte so einmal der Wagen, zumindest bergauf, ohne jemanden an der Deichsel fahren. Ich hatte zwei Hupen mit Gummibällen für die Verständigung vorgesehen. Die Bälle schraubte ich bald ab, da mit direktem Hineinblasen eine bessere Verständigung möglich war. Wir machten aus: 3-mal kurz oben – Achtung, bald geht’s los! 1-mal lang unten – alles klar! Mehrmals kurz - noch warten. 1-mal lang oben – es geht los!
Ich war hinaufgelaufen und nach Austausch der Signale warf ich den Motor an. Jetzt war jede weitere Verständigung unmöglich. Außerdem konnte ich in die ersten 15 Meter nicht einsehen. Sicherheitshalber hatte ich eine Deichselverlängerung an der Talseite des Wagens angebracht, damit der Lenker, falls er mal ausrutschte, nicht vor den Wagen gleiten würde. Langsam legte ich den mit einem verstellbaren Gewicht ausgestatteten Kupplungshebel um. Dieser drückte den noch frei beweglichen Trommelzylinder mit seiner konisch geformten Seite in die ebenfalls konische Innenseite des Antriebsrades, welche sich in Dauerbewegung befand. Langsam spannte sich das Zugseil. Der Draht wand sich knirschen um die Trommel. Jetzt bewirkte das Gewicht am Hebel, dass Antrieb und Trommel gekoppelt blieben und ich konnte mit einem dicken Stock das Seil etwas leiten, so dass es sich gleichmäßig verteilt aufwickelte. Langsam wurde Ludwig unten an der ersten Kurve sichtbar und auch der Wagen. Würde alles klappen? Würde das Seil halten, auch, wenn sich mal was verhängte? Die Zukunft würde es zeigen!
Jetzt hatten wir Blickkontakt und es war einfacher. Wider Erwarten ging alles bestens vonstatten! Bald war die erste Fuhre vorm Haus. Das Seil füllte die Trommel ziemlich aus. Da es außerdem 30 Meter zu lang war, kürzten wir es. Auch mussten die Pflöcke etwas tiefer in den Boden, weil die Achsen des Wagens sie berührten. Durch diese Probefahrt sahen wir auch, an welchen Stellen der Hang etwas eingeebnet werden musste, damit die Fuhre nicht umkippen konnte. Doch das ließen wir für den nächsten Tag. Wir waren fix und foxi und sehnten uns nach einer Dusche mit der Gießkanne, Essen und Schlaf!
Am nächsten Tag schafften wir den Rest des Umzugsgutes aus dem Auto hinauf. Von den Sachen, die im Dorf lagerten, holten wir nur das, was wir für die weiteren Arbeiten am Haus brauchten. Am folgenden Tag hackten wir gegenüber unserer ‚Talstation‘ noch weitere Brombeergestrüppe weg und stellten dort unseren Wohnwagen auf. Somit fielen die Anfahrtswege weg. Wir hatten den früheren Besitzern einen Besuch abgestattet. Diese luden uns für den Abend zum Essen ein. Wir sollten aber früher kommen, weil sie uns noch mit einem Sägewerksbesitzer im Tal bekannt machen wollten, der auch einen Baustoffhandel besaß. Dessen Betrieb, zwei Dörfer unterhalb von uns, war, wie so manche andere auch, schon seit einer Weile eingestellt. Der neue, moderne, lag bei St. Girons. Der Händler versprach uns günstige Preise, wenn wir alles bei ihm nähmen. Um das zu testen bestellte ich für die nächste Woche gleich ein paar Balken und kaufte eine Palette Zement, die wir auf Auto und Hänger verteilten. Anhand der Rechnung konnte ich nun die Preise bei den anderen Händlern vergleichen. Und siehe, sie erwiesen sich wirklich als sehr günstig!
Etwa 50 Meter hinter unserer ‚Talstation‘ floss ein Bächlein von unserem Grund herab. Jemand hatte es mit einem querliegenden Baumstamm gestaut. Hier holten wir unser Wasser. Und hierher führte Jean-Paul, der dickliche Stoppelkopf aus dem Dorf, zwei Mal täglich seine zwei Kühe zum Trinken. Ansonsten standen diese in einer kleinen Scheune gegenüber von Fernand, dem Nachbarn im Blaumann, der sich bei uns beschwerte, dass der Urin der Tiere über den Weg laufe und ihm das Leben schwer mache. Jeden Morgen und jeden Abend das gleiche Ritual. Jean-Paul gab den Tieren Heu und schaffte den Mist vor die Tür. Dann mussten sie erst mal fressen. Während dieser Zeit spionierte er uns aus. Wir sahen ihn nicht, wir rochen ihn aber, vor allem seinen üblen Tabak. Und dann stand er plötzlich wie ein Stehaufmännchen da, wo man ihn am wenigsten erwartet hatte! Er zeigte sich immer dann, wenn er dachte, wir hätten ihn entdeckt. Stolz zeigte er uns seine Tiere. Es waren zwei stattliche Schweizer Braunviehkühe, dem Euter nach am Ende der Laktation. Er meinte, er hätte damit im letzten Jahr vier Kälber gemästet und bot uns Milch an. Frischer könnten wir sie nirgendwo bekommen! Er holte einen Hocker aus einer Ecke der engen Scheune, deren Tür die einzige Öffnung war. Spinnenweben verhüllten schier die Deckenbalken, eine Mistgabel lehnte in einer Ecke, eine Schaufel, ein Stock. An einem dicken Nagel hing ein dicker Bart aus aufgeschnittenen Bindegarnschnüren, daneben eine verstaubte Jacke. Am Boden ein Napf, worin er seinen Hunden etwas Milch gab. Er setzte sich zwischen die Kühe, redete ihnen im Dialekt zu und molk dann erst die eine, Zitze um Zitze mit einer Hand, anschließend die andere in einen Plastikkrug mit seitlichem Henkel, den er in der anderen Hand hielt. Da er kein Behältnis hatte, holten wir eine leere Weinflasche aus unserem Wohnwagen. Er füllte sie mit dem Krug über dem Hundenapf, worin sich die überlaufende Milch und der Schaum sammelten. Sich gegenseitig leicht anknurrend leckten die Hunde den süßen Saft.
Wir bereiteten unser Müsli mit der Milch. Sie hatte einen etwas herben Geruch. Deshalb kochten wir sie lieber erst mal ab. Auch hatte sie eine etwas grünliche Farbe. Hatte unsere Flasche abgefärbt? Oder kam das vom Futter? Beim nächsten Melken schauten wir ihm etwas gründlicher zu. Jetzt wurde uns klar, warum seine Milch so undeutsch schmeckte: Die Euter und Zitzen waren ziemlich von Mist verklebt, wohl, weil die Standplätze für kleinere Kühe angelegt worden waren. Also lagen die Tiere zu einem Drittel im Graben. Nach dem Melken jedenfalls waren die Euter, zumindest aber die Zitzen, gut sauber!
Fand er uns nicht am Wohnwagen vor, stieg er zum Haus hoch, paffte uns dicht und schaute bei der Arbeit zu. Was tat er, wenn wir nicht da waren? Natürlich rumschnüffeln! Mal fanden wir einen Fußabdruck im frischen Zement, mal eine Kippe in der Scheune. Aber es fehlte nie etwas. Um ihn loszuwerden genügte es, ihm eine Schaufel in die Hand zu drücken. Dann fiel ihm plötzlich ein, dass er ja noch zum Stall gehen musste, um die Kühe zu tränken! Die Kühe tränkte er eine nach der anderen, weil diese sich sonst um das Ersttrinkrecht stritten. Während die erste in tiefen Zügen trank, bisweilen wohlig innehaltend, hielt er die andere am Seil zurück, bis sich das Wasser im Rückhalt wieder aufgefüllt hatte. Jetzt trieb der Hund auf Kommando die Kuh zur Seite und die andere konnte sich der Tränke nähern.
Wir hatten inzwischen überlegt, wo wir mit der Renovierung des Hauses anfangen sollten. Das Land könnten wir für eine Weile vergessen, war es doch März und die Natur noch im Ruhestand. Das Haus sollte jedenfalls in einem Monat bewohnbar sein. Doris hatte gesagt, sie würde erst einziehen, wenn es Klo und Dusche gäbe. Dazu brauchten wir Wasser. Oberhalb des Hauses sickerte eine Quelle aus der Erde. Nicht sehr stark, aber ausreichend, wenn man ein Rückhaltebecken schuf. Lehm war genügend vorhanden, wie wir am Rande der Rinne, die das Wasser geschaffen hatte, erkennen konnten. Gartenschlauch hatten wir genügend dabei. Wir formten also im Lehm ein Becken, in welches wir so 10cm über dem Boden den am Ende mit Fliegengitter umwickelten Gartenschlauch legten. In diesen 10cm könnten sich die im Wasser schwebenden Partikel absetzen. Nun bauten wir einen Damm in die Höhe, unter dessen oberen Rand wir ein dickeres Rohr als Überlauf eingruben, damit das überlaufende Wasser nicht den Damm wegwaschen konnte. In das untere Ende des Gartenschlauches steckten wir einen Stöpsel, den wir später durch einen Hahn ersetzten. Langsam füllte sich das Becken auf. Wir gingen wieder zum Haus hinunter, der Anfang war gemacht!
Am Haus war eigentlich alles neu zu machen. Um zügig vorwärts zu kommen, bot es sich an, oben anzufangen. Die Vorderseite des Daches, die Südseite, musste vor nicht allzu langer Zeit (wir fanden später heraus, dass das vor dem Krieg gewesen war, also vor 35 Jahren) neu gedeckt worden sein. Das sah man an der einheitlichen, dunklen Farbe der Schieferplatten und an ihrer Form. Doch die Rückseite war in schlechterem Zustand. Nur die Ränder des Daches waren aus schwarzem Schiefer, der Rest aus grauem, der sich zu Pulver zersetzte. Diese Seite müsste in den nächsten Jahren erneuert werden! Bei der ersten Besichtigung schon hatte ich auf dem Dachboden Tropfstellen entdeckt und vorsorgend bei einem Spengler Abschnittsreste von Zinkblechen, meist schmale Streifen, besorgt. Da dieses die Hangseite war, erschien uns die Reparatur einfach. Wir legten eine Matratze oberhalb des unteren Dachrandes, wo dieses einen leichten Knick machte, und dann darauf eine Leiter. Von dieser aus ließen sich nun zu beiden Seiten die Blechstreifen unter die undichten Stellen schieben, ohne dass die Schiefer brachen. Manchmal knickte ich die oberen Ecken der Plättchen mit einer Zange leicht an, damit diese sich festklemmen konnten. Dabei bemerkte ich, dass ein Schieferdach in drei Lagen gedeckt ist. Die Nagellöcher der ersten Reihe werden immer von der dritten darüber verdeckt. Glücklicherweise fanden wir an die rückwärtige Hauswand gelehnt mehrere übriggebliebene oder heruntergeglittene Schieferplatten, mit denen wir die wenigen fehlenden, vor allem am First, ersetzen konnten. Wir legten sie auf eine feste Kante und schlugen sie mit einem Hackmesser auf die richtige Größe. Mit einem Hammer und Stahlnagel schlugen wir die Löcher hinein. Das ging einfacher als erwartet! Nur muss man berücksichtigen, wie der Schiefer bricht! Also das, was beim ‚Schneiden‘ oder ‚Lochen‘ obenauf liegt, gibt beim Verlegen die Unterseite! Am einfachsten geht das Ganze mit einem ‚Schieferhammer‘, den wir uns später auf dem Markt kauften. Beim Kauf ist zu beachten, dass es Hämmer für Links- und Rechtshänder gibt. Das ist kein Witz!
Alte Schiefer sind sehr brüchig. Sind sie nass, halten sie noch weniger Gewicht aus. Man sollte also nur auf trockenen Dächern arbeiten, um nicht mehr kaputt zu machen, als man repariert! Auch sind nasse Dächer wegen der Algen oder Moose, die darauf wachsen, sehr glatt! Wie banden vorsichtshalber noch ein dünnes Kissen unter das obere Ende der Leiter. Um das Dach nicht zu beschädigen drehten wir die Leiter um sich selbst, um an die nächste Stelle zu kommen. Dann befand sich die Leiter auf einem schon ausgebesserten Streifen und man konnte nun den Streifen ausbessern, auf dem vorher die Leiter gelegen hatte, und den folgenden auf der anderen Seite. Für die Arbeiten auf der Südseite hatten wir eine leichte Alu-Leiter mit zwei oben rechtwinkelig angebrachten Haken ausgerüstet, die wir, weil es so am einfachsten war, von der Nordseite, also der Hangseite, auf die andere Seite hinabließen und am First einhakten. Um die von einer Seite (wegen des Wetters und Windes) auf der ganzen Hauslänge oben überstehende letzte Schieferreihe nicht zu beschädigen, befestigten wir eine mit umwickelten Stoff gepolsterte ‚Abstands-Leiste‘ an den Haken der Leiter. Zum Glück waren auf der Südseite nur ein paar Schiefer durch den Wind verrutscht und schnell wieder ausgerichtet. Hier erwies sich oft ein Klacks Kleber aus der Spritze, den es im Baumarkt gibt, als hilfreich. Ich war froh, einen Sicherheitsgurt zu haben, der mit einem Seil auf der Hangseite gesichert war! Am besten wäre ein Klettergeschirr mit selbstblockierender Sicherung, kam mir in den Sinn. Doch diese teuren Teile konnte sich nur ein Reinhold Messmer leisten…
Eigenartigerweise waren die Nordseiten unserer Dächer in schlechterem Zustand als die Südseiten. Bestimmt hing das auch mit der Sonneneinstrahlung zusammen, weil dadurch die eine Dachseite schneller trocknete. Auch lagen auf der Rückseite noch nasse Blätter, zum Teil berührte das Dach die Erde und das Holz faulte von unten her weg.
Am Nachmittag machten wir uns mit der Motorsäge an das Zerschneiden der trockenen Eschenstämme, die unser Vorgänger durch die Fensteröffnungen in die einzelnen Räume gezerrt hatte, um mit deren grünen Blättern seine Schafe zu füttern. Bläulich schwebten die süßlichen Abgase der Säge in den durch die Fenster einfallenden Kegeln aus Licht und die schwarzen Wände hörten erstaunt den Klang des neuen Zeitalters! Das Holz stapelten wir neben dem riesigen Kamin an der Westseite. Jetzt konnten wir uns endlich unbehindert im Haus bewegen! Draußen wurde es dunkel. Ludwig machte im Kamin mit dem zundertrockenen Holz ein erstes Feuer, während ich aus dem Wohnwagen Proviant und die Schlafsäcke holte. Wir verbrachten einen wunderbaren Abend ‚au coin du feu‘. Schon immer hatte ich mir ein Haus mit offenem Kamin gewünscht, jetzt hatten wir es!
Am nächsten Morgen schafften wir all die leeren Flaschen vom Dachboden, die dort zu hunderten herumlagen. Meist waren das dickwandige Flaschen, also uralt, mit Kippverschluss ausgestattet, mit Siegeln oder Inschriften im Glas. Damals muss eine Flasche einen großen Wert besessen haben, sonst hätte man sie sicher nicht gehortet! „Die wenn man auf einen Flohmarkt bringen könnte…“, sinnierte Ludwig. „Nichts wie weg damit!“, rief ich. Doch wohin, da es keine Müllabfuhr gab? Da fiel mir ein, dass wir ja eine Jauchengrube brauchten! Diese sollte gegenüber der Haustür am Rand des Gartens gebaut werden. Wir hoben also ein 2 mal 2 Meter tiefes Loch aus, so 30 Zentimeter tief. Hier rein warfen wir alles Gläserne, setzten eine Sonnenbrille auf die Nase und zerschlugen es mit dem Vorschlaghammer, damit es weniger Platz einnahm. Später gossen wir darauf die Fundamentplatte der Abwassergrube.
Die hölzernen Kästen, in denen früher in einer Schicht aus Asche die getrockneten Wurst- und Schinkenreserven gelagert wurden, waren wegen der Holzwürmer weitgehend zerfallen. Die Asche lag herum. Wir kehrten sie zusammen und streuten sie unterhalb vom Haus in die Wiese, dort, wo wir den Garten vorgesehen hatten. An einer Stelle, über dem Raum mit der eingefallenen Wand, war eigenartigerweise auf dem Dachboden mal ein neuer Fußboden eingezogen worden, den inzwischen die Holzwürmer entdeckt hatten. Er trug aber noch. Diesen ließen wir erst mal in Ruhe, es gab Dringenderes!
Mit Brecheisen und Kuhfuß machten wir uns nun daran, den alten Bretterboden des Dachbodens rauszureißen. Wir fingen auf der Talseite damit an. Als genügend Platz war, nagelten wir aus alten Brettern eine Rinne zusammen, die durch das Küchenfenster im Stockwerk darunter bis in den Garten reichte. Darin beförderten wir den Schrott hinunter. Dort sortierten wir die besseren aus, um sie als Schalungsbretter zu verwenden, die anderen wanderten auf einen Haufen, um bei Gelegenheit verbrannt zu werden, vielleicht an Johanni. Langsam kam wie ein Spinnennetz das Gerippe des Dachbodens zum Vorschein. Mit dem Beil hackte ich verschiedene Balken an, um zu sehen, wie sie innen beieinander wären. Ich war überrascht! Hatte mein erster Eindruck beim Kauf mir gesagt, ich müsste fast alles erneuern, so sah ich jetzt, dass nur das Äußere, praktisch das Splintholz, wurmstichig war und sofort zerfiel, während das Kernholz, hart wie Eisen, dem Beil widerstand. Da hatten sogar die Holzwürmer und –Böcke aufgegeben! Das Innere war so hart, dass wir es nicht schafften die alten Nägel heraus zu ziehen, geschweige denn, neue hinein zu schlagen! Von den ersteren (handgeschmiedet) brachen die Köpfe ab, die neuen wurden krumm. Sicherlich hatte auch die alles fingerdick bedeckende Pechschicht bei der Konservierung des Gebälks mitgeholfen. Denn wie wir sahen, war der Kaminabzug hier oben späteren Datums. Vorher war der Rauch einfach so nach oben durch die Ritzen zwischen Brettern und Schieferplatten abgezogen. Es war fast ausschließlich Hartholz verarbeitet worden, zwar meist etwas schwach bemessen, vielleicht, weil es so nicht gesägt werden musste, welches sich beim Trocknen in ein starres, solides Gebilde verwandelt hatte. Die Stücke waren grob mit der Axt und einem anderen Gerät, das wir im Keller gefunden hatten und dessen Klinge wie eine Gartenhacke ausgerichtet war, behauen worden. Oft war stellenweise die Rinde noch dran. Alles Baumaterial musste aus der unmittelbaren Umgebung stammen!
Die wenigen Stücke, die ich wechselte, musste ich mühsam mit der Kettensäge herausschneiden. Und um neue eizusetzen, mussten wir mit dem Handbohrer die Nagellöcher in den Balken vorbohren. In der Luft schwebte ein leichter Nebel aus Rußpartikeln, der bitter schmeckte und uns die Nasenlöcher verstopfte. Das schräg einfallende Sonnenlicht schob Lichtkeile in das dämmerige Haus, in denen die Staubteile bisweilen wilde Tänze aufführten. Am Abend waren wir froh über unseren Fortschritt, auch wenn es noch lange nicht Aufbauarbeit war!
Samstag fuhren wir auf den Markt in die Stadt. Von früher wussten wir, dass dies der Treffpunkt aller ‚Neos‘ war, aller ‚Zugereisten‘, seien es Franzosen aus den Städten, deutsche Landfreaks oder internationale Hippies. Erkenntlich waren diese an den langen Haaren und auch manchmal an der bunten Kleidung, obwohl sich die Kleidung mancher nicht sehr von der der Einheimischen unterschied, vor allem jener, die Tiere hielten. Deutsch war die Sprache, die man am meisten hörte. Und die Deutschen erkannte man meist auch an den blonden Haaren. Einige der Neueinwanderer hielten einen Marktstand, wo sie Gemüsepflanzen verkauften, selbstgebackene Brotlaibe oder indische Klamotten und Rauchzubehör. Diese Stände galten wohl als Treffpunkt der Landsleute, denn oft stand oder saß eine Gruppe junger Leute dort herum, Kinder tollten lachend umher oder bettelten die Passanten an. Eine Gruppe hatte ihre Instrumente dabei und spielte auf dem Gehsteig vor einem Hotel, worin sich im Erdgeschoss hinter hohen Scheiben ein Café-Bar befand. Um kleine Tischchen saßen Gruppen von exotisch aussehenden Wesen, alles rauchte, alles trank. Der Kellner hatte es schwer, zu den Tischen zu kommen und seine übervollen Tablets zu leeren. Selbst auf dem Fußweg hatte man Tische aufgestellt, um die durstige Menge versorgen zu können, ebenfalls nebenan auf dem Parkplatz!
Auch wir trafen hier auf Bekannte. Irgendwie schienen sich alle zu kennen oder jemanden zu kennen, der jemanden kannte, den man auch kannte… Alle Märkte auf der Welt sind sich ähnlich: Treffpunkt für diejenigen, die etwas zu verkaufen haben und denen, die etwas brauchen. Hier war der Markt zusätzlich Treffpunkt der Leute, die sonst verstreut in den vielen umliegenden Tälern wohnten, ob Einheimische oder Zugereiste, und sich sonst nie sahen. Und hier erfuhr man alles Neue, bevor es in den Zeitungen stand und auch das, was diese nie bringen würden!
Bei einem Bier auf einer Terrasse schauten wir dem Menschenfluss zu. Ab und zu löste sich jemand aus der Menge, kam auf einen zu und man begrüßte sich entweder auf französische Art mit dem ‚Bisou‘, dem hingehauchten Küsschen auf jede Backe, oder man umarmte sich auf Hippieart. Ein paar Polizisten schlenderten durch die Menge, was so manchen Raucher eines Joints dazu bewog, etwas diskreter zu sein. Andere ließen sich nicht einschüchtern und bröselten und drehten ungestört weiter an ihren dreiblättrigen Gebilden. Es schien so etwas wie ein Waffenstillstand zu herrschen. An einem Stand kauften wir von vietnamesischen Flüchtlingen ein paar Frühlingsrollen, die wir auf der Flussmauer verzehrten. Unterhalb von uns saß eine buntgewürfelte Schar auf dem kiesigen Ufer und ließ ein Schillum die Runde machen. Leicht vermischt mit dem Rauschen des Flusses schwebte der Rauch in unsere Nasen. Auf dem Heimweg hielten wir hier und da vor einem Gasthaus an und tranken ein weiteres Bier. Hier bestand die Kundschaft meist aus Einheimischen, die wie wir, noch einen ‚Schluck für die Straße‘ tranken. Hier sprach man ‚Patois‘, Dialekt.
Wir hatten bei einem Eisenhändler einen Dreifuss erworben, unter dem wir unweit der Winde, etwas abseits des Hauses, mit Abbruchholz ein Feuer machten. Im Waschkessel machten wir Wasser heiß. Mit Hilfe der Gießkanne als Dusche halfen wir uns gegenseitig, die schwarze Staubschicht der letzten Woche loszuwerden. Was tiefer eingedrungen war, husteten wir während der nächsten Tage aus.
Pünktlich jeden Morgen kam unser treuer Kuhjunge mit seiner Flasche Milch zum Wohnwagen oder hoch zur Baustelle und stand eine Weile im Weg. Manchmal kam auch seine Mutter oder der Vater und schränkten unsere Bewegungsfreiheit ein oder hielten uns direkt von der Arbeit ab. „Tun die denn den ganzen Tag nichts anderes als rumstehen und quatschen?“, sprach Ludwig auch meine Frage aus. „Tun die Alemannen denn nichts anderes als den ganzen Tag arbeiten?“, mögen diese sich im Patois, uns unverständlich, gefragt haben. Doch hatten diese Besuche den Vorteil, dass wir etwas von dem erfuhren, was im Dorf und in der Welt vorging. Auch zeigte Elie, Jean-Pauls Vater, uns nach und nach die Parzellen, die zum Hof gehört hatten. Beim Vergleichen mit dem Kataster fand ich heraus, welche abhandengekommen waren. Denn ein anderer Nachbar hatte den gleichen Namen gehabt wie unser Vorvorbesitzer, nämlich Dubuc. Um diese zwei zu unterscheiden, hatte man den anderen nach seinem Hausnamen benannt, ‚Graviaret‘, und den unseren ebenfalls, aber ‚le Pourteres‘. Dieses bedeutete, was ich aber erst viel später erfuhr, dass er von ‚Portet d‘Aspet‘ hierhergezogen war. Dieses war das übernächste Dorf, am Fuß des ‚Col de Portet d’Aspet‘, dem Pass am Ende des Tales, gelegen.
Im Raum, in dem sich der offene Kamin befand, war durch eine Bretterwand ein weiteres Zimmer, aber kleiner, abgetrennt worden. In diesem stand im hinteren Ende ein Bett. Hierunter war der Fußboden leicht durchgefault. Vom Keller aus hatte ich schon beim ersten Besuch gesehen, dass sich unter dem Bett ein Karton befand, angefüllt mit Briefen, Fotos und handschriftlich ausgefüllten Katasterpapieren, die bis in das Jahr 1823 zurückgingen. Auch hierin war von jemanden, genannt ‚Le Pourteres‘ die Rede. Diese Papiere verstaute ich in einer Kiste, um sie später mal in Ruhe durchzuschauen. Würde man in ein paar Generationen vom ‚Allemand‘ reden, wenn man den Hof meinte?
Wir mussten das Dorfgespräch sein. Fuhren wir durch den Ort, grüßte man uns, schaute uns neugierig nach, versuchte uns anzuhalten, um mit uns zu reden. Jean-Paul würde seine Stelle als Beobachter sicherlich voll ausnutzen! Meist fuhren wir erst abends, nach der Arbeit und dem Essen ins Dorf, um in der Kneipe, die auch bei Bedarf als Restaurant fungierte, ein Bier zu trinken. Hier befand sich das einzige öffentliche Telefon des Dorfes. Die Gastwirtschaft lag im rechten Winkel zum Fluss, der hier durch einen Damm gestaut war. Fünfzig Meter unterhalb befand sich ein baufälliges Sägewerk, das noch manchmal in Betrieb war. Doch wurde die altertümliche Bandsäge jetzt von einem Elektromotor angetrieben. Die Familie der Wirtsleute wohnte im ersten Stock des schmalen Wirtshauses und in einem Haus neben dem Sägewerk, wo sie auch Gästezimmer betrieben.
Es gab keine Telefon-Kabine, sondern der Apparat hing neben der Toilette, einem winzigen Raum, in dem sich ein italienisches Lochklo befand, dessen Ablauf direkt in den Fluss ging. Meist war man hier ungestört, denn jeder, außer den Frauen, erledigte sein Geschäft auf französische Weise direkt in den Fluss. Das kam auf das gleiche raus. Nur dass dann das Plätschern sogleich ertönte. In dem schmalen Vorraum der Toilette, sozusagen im Warteraum für Frauenkundschaft, also hing das Telefon. Die Zähluhr jedoch befand sich im Gastzimmer und musste vorher und nachher abgelesen werden. Von hier aus tätigten wir die Gespräche mit unseren Lieben. Meist nur kurz, denn im Telefonbereich galt auch in Südfrankreich: ‚Time is money‘!
Die Gaststube selber, ein länglicher, schmaler Raum mit dem Tresen an der rechten Stirnseite, öffnete meist erst abends. Oft ging jemand den Wirt suchen, um ihm zu sagen, dass Kundschaft da sei. Die Wirtsfamilie hatte vier Söhne, zwischen 15 und 20 Jahre alt. Meist kam einer von diesen und sperrte auf. Anschließend an die Gaststube befand sich ein Zimmer mit offenem Kamin, das als ihnen Wohnzimmer diente. Von diesem gelangte man in die Küche.
Hier trafen sich abends die Durstigen vom Dorf und aus dem Tal. An bestimmten Tagen wimmelte es hier von Jägern. Und Jäger war hier fast jeder! Denn oft sah man dieselben wilden Gesichter am Rand der Straße oder im Gelände, in einer alten Armeeuniform, oft mit deutschen Wappen, schwer bewaffnet. Diese Jäger hatten gemeinsam ihre Liebe zu Waffen, zur Waldläuferei und den großen Durst. ‚Aperitif‘ nannte man das oft zeitlich unbegrenzte Trinkzeremoniell, das meist das Essen ersetzte und sich bis in die Morgenstunden hinziehen konnte. Polizeistunde gab es anscheinend keine. Manchmal drehte auch jemand den Schlüssel um und es war eine geschlossene Gesellschaft. Und kam doch mal eine Streife durch das Tal, dann gingen die da rein, tranken ein Glas und unterhielten sich mit den Leuten. Denn für einen Polizisten kann alles Gehörte nützlich sein, vor allem, wenn die Zungen durch den Alkohol gelockert sind!
Auch wir gerieten bisweilen in solch eine feucht-fröhliche Runde, obwohl wir nur telefonieren wollten. Rundum redete man laut über Jagd, die verschiedenen Kaliber, Hunde und Beute in einem uns unverständlichen Kauderwelsch. Ehe wir etwas bestellen konnten, stand schon ein Glas vor uns, meist jener Anislikör, den wir anfangs ohne Wasser hinzuzufügen, tranken. Das ließ die Heiterkeit der Anwesenden um mindestens einen Grad ansteigen, und sie gaben sich alle Mühe, uns die französischen Trinkbräuche beizubringen. Der Barmann hatte den schwierigsten Job: Denn außer Trinken musste er noch das Konsumierte im Kopf behalten. Einfachheitshalber kostete jedes Getränk dasselbe und man trank in ‚Runden‘. Ein jeder drängte sich, um die nächste Runde zu schmeißen! Bevor alle Gläser leer waren, wurde schon wieder nachgefüllt. Je weniger also jemand Durst hatte, um so voller wurde sein Glas und umso dickflüssiger sein Inhalt, weil kein Platz mehr für das Wasser blieb. Zum Glück ließ man uns selten eine Runde zahlen. Denn schnell hatte ich den Betrag ausgerechnet, den sie kostete und sogleich in Säcke Zement konvertiert. Ein Drink kostete 3 Francs. 5 Gläser entsprachen also einem Sack Zement von 50 Kilo oder dem Lohn für 1 Stunde Arbeit...
Wir trinkungebildeten Teutonen, die nichts anderes kannten als Bier, gaben kein gutes Bild ab! Denn obwohl fast alle auf Anisschnaps standen, schien da ein Unterschied zu bestehen: Es gab ‚Pastis‘, ‚Pernod‘ oder ‚Ricard‘ zur Auswahl. Für uns schmeckte das alles gleich. Nicht aber für einen Franzosen! Und der Barmann musste gut im Kopf haben, wem er was nachgießen sollte! Und das geschah mit Flaschen, die auf dem Hals einen Dosier-Ausgießer hatten, eine Art Kropf am Rand des metallenen Schnabels. Jedenfalls erleichterte es das Dosieren, wenn das Glas noch halb voll war. Hatte der Wirt mal versehentlich zur falschen Flasche gegriffen und wurde von einem Glashalter protestiert, dann hielt der Wirt das Loch im Ausgießer zu und konnte durch eine bestimmte Drehung der Flasche den Inhalt des Dosierers wieder in diese zurücklaufen lassen.
Bei einem dieser endlosen Abende erfuhren wir, dass einer der anwesenden Jäger, der auch der Bürgermeister des Dorfes war, einen alten GMC-LKW besaß, ein amerikanisches Kriegsmodell, von den Alliierten zurückgelassen. Dieser war ein Dreiachser, ein Allradfahrzeug, der, je nach Steigung, 4 bis 6 Tonnen transportieren konnte. Er bot uns an, billig Sand und Kies bis zur Kreuzung unweit unserer ‚Talstation‘ hoch zu fahren. Mit unserem VW einschließlich Anhänger, schafften wir jedes Mal nur knapp 1 Tonne. Am nächsten Vormittag hörten wir schon von weitem das Näherkommen des LKWs. Rückwärts quälte er sich auf dem schmalen, ausgewaschenen Kiesweg den Berg hinauf, gewiesen von einem der anderen Jäger, den wir am Abend in der Kneipe gesehen hatten. Dieser hatte ungefähr mein Alter. Obwohl er aus dem Dorf war, hatte er meist in Lille, ganz im Norden, gearbeitet. Jetzt hatte er die Gelegenheit gehabt, bei St. Girons eine Arbeit zu finden und war zurückgekommen. Wir waren also nicht die einzigen ‚Neos‘ im Dorf. In der Kurve kippten sie den Sand ab. Natürlich wollten sie die Baustelle sehen! Ich fragte mich, ob der LKW-Transport nur ein Vorwand gewesen war. Wir stiegen alle den Berg hinauf und schauten unsere Ruine an. Da Yvon, der Fahrer, ein kleines Bauunternehmen hatte, konnte er mir ein paar Tipps geben. Jedenfalls würde die abendliche Tafelrunde jetzt Direktinformation bekommen!
Wir schaufelten den Sand in den Autoanhänger und fuhren ihn bis zur Talstation unserer ‚Seilbahn‘, wo wir ihn in den sargähnlichen Anhänger umfüllten. Jedes Mal so 300 bis 350 Kilo. Oder etwas weniger, und wir packten auf einer aufsteckbaren Halterung noch Langholz drauf, Deckenbalken oder neue Fußbodenbretter. Mit dem schweren Sand unten drin riskierten wir weniger, alles umzuwerfen. Kies und Sand lagerten wir getrennt rechts vom Gebäude an der Seitenwand der Scheune, wo wir auch den vom Moped angetriebenen Betonmischer aufstellten. Dieser fasste drei Schubkarren und stammte von einem Schrottplatz in Deutschland. Da der Elektromotor kaputt war, hatte er nicht viel gekostet. Und da es hier keinen Strom gab, hatte ich an meine Zündapp ein zweites Zahnrad geschweißt, an den Mischer eine Befestigung für das Moped, und mit einer langen Kette beides verbunden. Mit einer Feststellzange beschwerten wir den Gasgriff und es konnte losgehen! Da die Quelle nur beschränkt Wasser lieferte, hatten wir ein Plastikfass durchgesägt und den Schlauch darin befestigt. So konnten wir eine Mischung machen, während sich die Reserve wieder füllte.
Wir hatten zwei Baustellen vorgesehen: eine bei schönem Wetter draußen, eine andere drinnen. Die Materialien waren alle nach oben geschafft. Es war schön, also arbeiteten wir draußen. Die vordere Mauer des Hauses neigte sich leicht nach außen. Dieses sah man auch an den quer verlaufenden Balken auf dem Dachboden, die die beiden hölzernen Längsriegel auf den Wänden miteinander verbanden. Diese sollten den seitlichen Druck des Daches auffangen, anstelle von Bindern, hatten sich aber aus der Halterung gelöst. Schon zwei Mal hatte jemand einen neuen, längeren Querriegel hinzugefügt, wie man auch an der Farbe des Holzes erkannte. Doch diese hatten ebenfalls nachgelassen. Mit einem alten Stahlseil, das wir um die Längsriegel wickelten und mittels Froschklemmen an einer Spannschraube befestigten, versuchten wir, eine weitere Bewegung des Mauerwerks aufzuhalten. Später, als wir den Dachboden ausbauten, gossen wir das Seil in den Betonguss ein, der die Quermauer stabilisieren sollte.
Doch blieb die Frage offen, ob es nur der Druck des Daches war, der die Mauern spreizte, oder ob das von den Fundamenten kam, den Mauern selber. Die 25 Meter lange Vorderfront, ganz aus Feldsteinen, manchmal aber auch Schieferblöcken gebaut, war 6 Meter hoch. Worauf war diese errichtet? Die Zwischenräume waren mit einer Mischung aus Lehm und kleinen Steinen aufgefüllt. Doch unten, wo sie den Boden berührte, waren die Fugen, wohl durch herablaufendes Regenwasser, ausgewaschen und boten allerlei Getier ein Zuhause. Bei Sonne fing es an, sich dort zu regen. Wir beobachteten Mäuse, Eidechsen und auch Schlangen. Jean-Paul hatte sogar schon Vipern beobachtet. Er schien unser Haus gut zu kennen. Bestimmt hatte er schon so manchen Rausch in dem alten Bett darin ausgeschlafen! Denn unten in seiner Kuhscheune hatte er eine Flasche ‚Klaren‘ versteckt, wovon er uns schon angeboten hatte. Auch seine Mutter schien gerne etwas zu trinken…
Wir machten uns daran, mit dem Pickel entlang der Mauer so tief wie möglich nach unten zu buddeln, um eine Art Fundament davor zu gießen. Oberhalb des Grabens legten wir eines der alten Bodenbretter hochkant und verkeilten es mit Steinen. Nun gossen wir Beton in diese Schalung hinein, legten eine Stange Baustahl dazu, füllten auf und stampften, bis die Zementmilch an die Oberfläche stieg. Dazu brauchte man natürlich eine Menge Material, und Material bedeutete zugleich viel Handarbeit: Dreimaliges Umschaufeln des Sandes vom Haufen in den Anhänger, von dort in den Windenwagen, und anschließend in den Betonmischer. Von dort mit der Schubkarre in die Schalung. Nach ein paar schönen Sonnentagen war das fertig. Wichtig wäre auch, bald eine Dachrinne anzubringen!...
Nun zogen wir die Mauern der Jauchengrube hoch, aber aus Hohlblocksteinen. Unter der Türschwelle durch gruben wir eine Rinne, in die wir alle Abwasserleitungen und alle Zuleitungen legten. Zusätzlich noch ein Rohr, das wir leer ließen. Für den Fall, dass… Die Außenmauer zu durchbrechen war schier unmöglich, da diese im Kellerbereich 80 Zentimeter dick war. Warum umständlich, wenn’s auch einfach geht! Was hatten damals die Bauern hier geschuftet, um dieses Haus aufzubauen! Hatten sie die Dicke der Wände nach der Menge der Feldsteine berechnet, um diese loszuwerden? Jedenfalls schien die Stelle, an der das Haus stand, zugleich auch als Steinbruch genutzt worden zu sein. Und an der verschieden starken Pechschicht, die der Rauch des offenen Feuers auf den Innenmauern abgesetzt hatte, sahen wir, dass nicht alle Teile gleich alt waren, dass manche später hinzugefügt worden waren. Das Haus bestand also aus mehreren Teilen, zumindest zweien, wie man an einer Fuge in der Frontseite sah. Verglichen mit der Aktion der Alten, diese festigungsartigen Gebäude zu bauen, glichen unsere Arbeiten eher einer Kosmetik!
Über zwei Wochen waren vergangen. Junge Leute mit einem zweijährigen Buben, die auf der anderen Talseite letztes Jahr ein Haus gekauft hatten, waren vorbeigekommen und hatten uns für Sonntag zum Essen eingeladen. Wie zuvor waren wir am Samstag in die Zivilisation abgetaucht und hatten den Markt in der 25 Kilometer entfernten Stadt besucht. Wie zuvor, hatten wir beim Rückweg an manchen Kneipen angehalten. In jedem Ort befand sich noch mindestens eine, geführt von alten Wirtsleuten, die eigenartigerweise alle auf dem Laufenden waren, wo wir herkamen und wo wir wohnten. Außer an Wochenenden öffneten diese Schenken meistens abends, und das auch nur, wenn Kundschaft da war.
Durch diese am Wege liegenden Hindernisse bedingt, erreichten wir unser Dorf erst gegen Abend. Hell leuchteten die Lichter der Kneipe uns ein Willkommen entgegen, und da wir telefonieren wollten, hielten wir an. Wir tauchten mutig in das Stimmengewirr und den dicken Rauch. Die ausgelassene Stimmung schlug schnell auf uns über und bald standen wir zwischen den Zechern um die kleine Theke und hielten uns an einem Glas Pastis fest. „Die sind ja gut drauf!“, stellte Ludwig fest, „Ob die was geraucht haben?“ „Schau genauer hin! Das sind keine Freaks, das sind bestenfalls Alkoholiker!“ „Ich hätte gerade mal Lust, einen Joint zu drehen und rumgehen zu lassen. Wetten, dass die mitrauchen würden? Denn, so wie die zufassen, sind die gegen Rauschmittel nicht abgeneigt!“ „Vergiss es!“, antwortete ich etwas aufgebracht, „Das kann uns nur Ärger bringen!“ „Na ja, das war doch nur, wie sagt man, so eine rhetorische Vermutung!“, meinte er besänftigend.
Meine Blase drängte mich, die fröhliche Runde kurz zu verlassen. Ich stand schwankend auf der Ufermauer vor dem Klo und schiffte in weitem Bogen in den Fluss. Der war leichter zu treffen als das kleine Rund des Stehklos! Mir kam es wie eine Ewigkeit vor, dass ich da oben stand. Ich schaute mehrmals nach, ob ich nicht schon fertig wäre. Hatte gar nicht gewusst, dass eine Harnblase ein solches Fassungsvermögen besaß! Vielleicht hatte auch der Magen als Reservebecken gedient, kam es mir in den Sinn. Denn wir hatten, außer ein paar süßen Spritzgebäckkringeln auf dem Markt, heute noch nichts gegessen. „Puh! Aber vielleicht besser so“, dachte ich, da kann einem wenigstens nichts rausfallen!
Plötzlich musste ich mich an der Hauswand stützen. Ich stieg von der Ufermauer hinunter und tastete mich an der rauen Wand entlang zurück zur Gaststube. Ein babylonisches Stimmengewirr schlug mir entgegen. Jemand hatte mich bemerkt und hielt mir schwankend mein randvolles Pastis-Glas entgegen. „Tchin! Tchin!“ Ich nahm es und fragte mich, wie viele Runden ich ausgesetzt hatte. Mehr automatisch, vielleicht auch etwas pflichtbewusst, führte ich das Glas zum Mund. „Cul sec!“, rief derjenige, der es mir gereicht hatte und leerte seines auf einen Zug. Ich machte es ihm nach. Ich schüttelte mich. „Übel, dieser übertriebene Anisgeschmack!“, kam es mir und ich musste mir Mühe geben, alles in mir zu behalten. Denn es waren keine Schnapsgläser, aus denen wir tranken, sondern ein Art Wassergläser mit der Aufschrift ‚Pastis‘ oder ‚Ricard‘ in Blau darauf. Mein Freund schaute übel aus. Zwei Jäger hatten es als ihre Pflicht angesehen, auch ihm zu zeigen, was ‚Cul sec‘ bedeutet, auf Deutsch so etwas wie ‚ex‘! Der junge Typ von Barmann, der zwar auch ein Glas in der Hand hielt, aber seinem Aussehen nach wenig getrunken hatte, winkte mich zu sich hinter die Theke. Er bückte sich und hob etwas vom Boden auf, worauf er seinen Schuh gesetzt hatte. Er gab mir ein Zeichen, ihm zu folgen und ging durch die Tür ins Nebenzimmer. „Pass ein wenig auf deinen Kumpel auf! Der hat ein Haschisch-piece rausgezogen und wollte glatt damit auf der Bar einen Joint bauen! Dabei ist es ihm runtergefallen. Zum Glück haben die anderen nichts bemerkt! Ich habe gleich den Fuß darauf gesetzt und es so hinter die Theke befördert!“ Ich dankte ihm, nahm das Piece und steckte es ein.
Wir gingen zurück in die Kneipe. Die Bude war zum Brechen voll. Die Leute auch. In Gruppen saßen die Trinker um die wenigen Tische oder standen, ihr Glas in der Hand, zu mehreren im Raum. Der Wirt ging mit zwei oder drei Flaschen in den Händen von einem zum andern und füllte nach. „Wie kann denn der noch wissen, wer was und wieviel getrunken hat und wie viele Runden ein jeder geschmissen hat?“, wunderte sich mein nach Anis riechendes Hirn. Ludwig war knallrot, klammerte sich am Tresen fest und stammelte Unverständliches. Aber entweder stammelten alle oder schrien nur noch irgendwas vor sich hin, worauf niemand mehr zu hören fähig war. Und außerdem schwabbelte mir der Pastis gehörig gegen die Trommelfelle. „Wir müssen hier weg!“, schrie ich in Richtung Ludwig und zerrte ihn zur Tür. „Un dernier pour la route!“, rief man uns zu und drückte uns ein neues Glas in die Hand. Ich hangelte mich durch den Lärm und den an den Gläsern hängenden Freunden bis zum Wirt. „Payer!“, schrie ich, „Combien?“ „Rien, tout est reglé!“, antwortete dieser. Ich wollte es nicht glauben und zog einen Hunderter aus der Tasche. Er schob ihn mir zurück. „Alles schon bezahlt!“, bekräftigte er. Ich stellte mein Glas in die Spüle hinter dem Tresen, damit es niemand wieder auffüllen könnte und wankte mit Ludwig hinaus. Ich kam mir vor wie ein Kapitän, der als erster sein sinkendes Schiff verlässt!
Diesmal stieg ich nicht auf die Flussmauer, sondern wir lehnten unsere Stirn an die raue Rinde der Bäume im Hof und teilten mit ihnen den Anissaft aus unseren Blasen. Dann kletterten wir mit letzter Kraft in die Kabine und ich suchte eine Weile nach dem Schlüsselloch der Zündung. „Vielleicht hatten sie es bei diesem Modell versetzt, und ich hatte es nur noch nicht gemerkt!“, tröstete ich mich. Letztlich fand ich es da, wo es hätte sein sollen, und die Karre lief an! Langsam tastete sie sich durch die wenigen parkenden Fahrzeuge und bog dann von selber links ab und knirschte den ausgewaschenen Kiesweg hoch. So viele Kurven hatte es nun wirklich nicht, aber Ludwig wurde übel und er kotzte trotz des offenen Fensters auf das Armaturenbrett und auf seine Beine! Auf dem Weg zum Wohnwagen überkam es mich auch wie eine Welle von Mitgefühl, und gemeinsam knieten wir nebeneinander an der Wegböschung und opferten Pan, dem Gott des Waldes. Etwas erleichtert krochen wir anschließend zur Viehtränke und wuschen uns den Anisgeschmack aus dem Gesicht. „BRR! NIE WIEDER!“
Dann pennten wir, trotz des sich anfangs wie verrückt drehenden und in alle Richtungen sich neigenden Wohnwagens. Bis uns ein überhöhter Blasendruck aus den Schlafsäcken scheuchte. Die Sonne stieg gerade über den Berg, die Vögel zwitscherten, der Bach plätscherte, unser Kopf brummte. „Was für ein Morgen!“, entfuhr es mir. „Was für ein toller Abend!“ Ludwig stocherte wohl noch in den Resten seiner Erinnerungen. „Schau mal, da hat doch irgend so eine Sau in unser Auto gekotzt!“, rief er plötzlich. „Irgend so eine ist etwas ungenau. Weißt du noch, wie wir gestern Abend hier hochgekommen sind?“ „Noi, zu Fuß auf jeden Fall nicht, so wie ich jetzt noch beieinander bin!“ „Ich bin auf jedenfalls gefahren! Laufen hätte auch ich nicht mehr können! Und schau mal, was der Wirt in der Gaststube eingesammelt hat!“, sagte ich und gab ihm sein Haschischpiece zurück. „Ja dann kann diese Drecksau nur ich gewesen sein!“, meinte er und machte sich ans Waschen der Kabine.
Später setzten wir Wasser auf den Dreifuß und nahmen eine warme Gießkannendusche. Anschließend warfen wir unsere nach saurem Anis riechenden Klamotten in den Waschtopf und rubbelten, bis das Waschbrett glänzte. Wir spannten ein Seil und hängten alles zum Trocknen in die Sonne. Inzwischen war es fast Mittag geworden. „Ich glaube, es ist Zeit, zu den Nachbarn gegenüber zu gehen, die uns zum Essen eingeladen haben!“, stellte ich fest. „Essen? Trinken? Benutze ja nicht mehr diese Worte! Von denen alleine schon wird mir kotzübel! Geh du nur alleine! Ich lege mich lieber in die Sonne an den Hang und nehme eine Mütze voll Schlaf!“ Also stieg ich alleine die paar hundert Meter ins Tal hinunter, während er den Hang hinaufkletterte auf der Suche nach einem etwas flacheren Plätzchen…
Unten im Tal floss ein strudelnder Bach, über den ich aber auf längerer Strecke keine Brücke sehen konnte. Ich fand eine Stelle, wo ein paar dicke Steine aus der Strömung ragten und ein Überschreiten möglich machten. Die Ufer des Baches waren von Haselsträuchern gesäumt, die gerade ihre Pollenschwänzchen geöffnet hatten. Die hier und da unterspülten Ufer gaben eine nicht sehr dicke, von kleinen Felsen durchsetzte Erdschicht frei, das Bachbett selber war schwarzer, glatter Schiefer. Auf der anderen Seite lagen ein paar schmale Wiesen, durch Haselhecken in kleine Parzellen getrennt, dahinter ging es steil den Hang hinauf, durch Krüppeleichen hindurch. An einer Stelle lag das verbeulte Wrack eines 2CV, völlig ausgeschlachtet. Weiter oben gelangte ich über eine steile Böschung auf die hier vorbeiführende Straße. Da ich mir von unserer Seite aus gut den Weg eingeprägt hatte, fand ich auch bald den Pfad, der zum Haus der Gastgeber hinaufführte. Außerdem stand unten ihr 2CV.
Es war eine herzliche Begrüßung. Aus der Küche strömten leckere Düfte, während Jacques mir einen Pastis anbot. Mir sträubte sich der Bart! Zu so etwas fehlte mir der Mut! Jacques räumte die Flasche weg. „Mir ist ein Bier auch lieber!“, bemerkte er und holte zwei Dosen Guiness. Das war schon besser! Ich erfuhr, dass seine Schwester mit einem Iren verheiratet war. Deshalb also die Vorliebe für diese schwarze Brühe! Ich nahm dankend an und wir prosteten uns zu. Seine Frau Sylvie war, wie ich erfuhr, Polin. Er selber hatte das Aussehen eines Hippies, mit seinem langen Bart. Doch das täuschte. Diesen Look hatte er wohl, weil er Motorradfahrer war! Mit einem Auge schielte er, was mich anfangs unsicher machte. Man wusste nie, mit welchem Auge er einen anschaute! Die zwei schienen okay zu sein. Sie wollten, dass ich hereinkomme. Doch ich sagte ihnen, dass ich es vorzöge, draußen zu bleiben um den Blick zu genießen. Er stopfte sich eine Pfeife. „Drinnen darf ich nicht rauchen, wegen dem Kleinen!“ „Das nächste Mal bringe ich meine Pfeife mit“, sagte ich. „Denselben Tabak habe ich früher auch geraucht!“
Mir gegenüber breitete sich, wie auf einem Katasterplan, unser Anwesen aus. Ich erkannte die Wiesen, die schon vom Wald zurückeroberten Parzellen und mitten drin das Haus, zu einem Teil vom dahinterliegenden Hügelrücken verborgen. Darüber der breite, noch graue Streifen des Buchenwaldes, überragt von dem weiß glänzenden Rücken des ‚Moussaou‘, unseres Hausberges, der bis über 1900 Meter aufstieg. Und auf beiden Seiten des Berges erstreckten sich noch andere weiß gleißende Bergketten, die weit in der Ferne den klarblauen Himmel berührten. Ich schaute eine ziemliche Weile. Idyllisch war ein nichtssagendes Wort für dieses Panorama! Ich fühlte mich glücklich, in einer solchen Gegend gestrandet zu sein! Immer wieder senkte ich meinen Blick, um ihn über das Land schweifen zu lassen, unser Land! Wenn ich den Kopf weiter nach rechts drehte, sah ich den anderen Teil unseres Tales, das sich unter mir gabelte, und sich direkt nach Süden hinzog. Unten, am Grund, heckengesäumte Wiesen, einzelne Häuser, weiter hinten ein kleines Dorf. Dahinter wurde das Land steiler, war von Wald bewachsen und zog sich zu einem Einschnitt hin, in dem man einen entfernten Gipfel wahrnahm, der im Sonnenlicht weiß herüber leuchtete. „Der Maubermé, 2880 Meter hoch!“, sagte Jacques, der mit einem Auge meinem Blick gefolgt war. „Ihr habt hier ja einen Blick wie von einem Aussichtsturm!“, entfuhr es mir. „Ich glaube, dass hier im Mittelalter mal ein Aussichtsturm stand, denn von hier aus kann man alle Täler einsehen und sogleich bemerken, wenn sich jemand nähert. Bestimmt hat man sich damals mit Rauchzeichen oder Feuern verständigt!“, erwiderte Jacques.
Ihr Land, sie hatten nur zwei Hektar, war sehr steil, ein paar kleine Parzellen Wiese, der Rest, wohl wegen des kargen Bodens, meist Krüppeleichen. An mehreren Stellen erhoben sich enorme Esskastanienbäume, sicher mehrere hundert Jahre alt. Diese waren damals an den Kreuzungspunkten der Parzellengrenzen gepflanzt worden, um für alle Zeiten Grenzstreitigkeiten zu verhindern. Nicht weit hinterm Haus erstreckte sich das ‚Plateau‘, eine fast flache Wiese, die aber einem Nachbarn gehörte, welcher auch ihr restliches Land nutzte.
Dann ging es ans Essen. Ihr Junge hatte seinen Schlaf beendet und wurde in seinen Kinderstuhl am Tisch gesetzt. Inzwischen kannte ich etwas den französischen Rhythmus: Man lässt sich Zeit mit dem Anfangen, man isst langsam eine Speise nach der anderen, und immer wieder kommt was Neues. Dazu die entsprechenden Weine (die für mich alle gleich schmeckten, vor allem nach dem vergangenen Abend!). Bis wir dann mit dem Zeremoniell fertig waren, hatte sich die Sonne schon so weit bewegt, dass ihr Schein nur noch gegenüber auf unserem Land lag. Der Rest des Tales war von Schatten erfüllt.
Während des Essens erfuhr ich, dass Jacques und Sylvie bei unseren früheren Eigentümern ein Praktikum gemacht hatten, weil auch sie vorhatten, sich auf dem Lande niederzulassen. Sie hatten deshalb schon längere Zeit gewusst, dass unser Hof verkauft werden sollte, doch weigerten sich die Eigentümer, ihnen diesen zu überlassen. Also kauften sie kurzentschlossen dieses kleine Anwesen, weil ihnen das Tal gefiel! Nur wurde vorher schon ihr ganzes Land von einem Schäfer genutzt, der es nicht herausrücken wollte. Da sie ihren Kredit für den Hof zurückzahlen mussten, wohnten sie vorerst noch woanders, und Jacques arbeitete als Berufschullehrer, seine Freundin als Sekretärin bei einer Vereinigung.
Ich fragte sie, wie denn der 2 CV da unten in den Wald gekommen war. Sie lachten. „Das ist unser früherer. Das war knapp gewesen! Hör zu!“, meinte Sylvie und legte los: „Das war im letzten Herbst. Wir waren alle drei, Woody, der Kleine war gerade ein Jahr alt geworden, in Andorra gewesen, genauer gesagt, am Pas de la Case, etwas vorher, wo man alles zollfrei einkaufen kann. Wir hatten ganz groß eingekauft, damit sich die Fahrt auch lohnt, sind es doch hin und zurück fast 6 Stunden Fahrt! Olivenöl, Wein, Tabak, Alkohol und ein paar Säcke Zucker, weil wir Marmelade kochen wollten. Es war schon dunkel, als wir hier wieder angekommen sind. Jacques hatte die ‚Ente‘ wie üblich an den Straßenrand gestellt. Der Junge schlief noch in seinem Sitz und wir machten uns ans Ausräumen. Wir stapelten alles am Straßenrand. Nur den Zucker ließen wir im Kofferraum, der konnte bis zum nächsten Tag warten! Da wachte der Junge auf und Jacques hob ihn aus seinem Sitz. Er setzte ihn am Boden ab. Da war uns, als hätte sich etwas hinter uns bewegt. Es war das Auto! Wir versuchten, es festzuhalten, aber es war schon zu weit über die Böschung und raste die Wiese runter. Und dann krachte es ein paar Mal, als es in den Wald kam. Das war futsch! Zum Glück hatten wir den Jungen draußen! Jetzt wurde uns klar, welch ein Glück wir gehabt hatten! Durch den Lärm alarmiert kamen auch die Schäfer aus dem Haus. Die hatten uns bestimmt schon eine Weile beobachtet. „Da wird nicht viel übrigbleiben!“, meinte einer trocken, „vielleicht das Reserverad!“
Gut, wir brachten den Jungen hoch ins Haus wo ich ihn abfütterte und Jacques die Einkäufe in mehrmaligem Hin und Her hinaufschaffte. Und stell dir vor, am nächsten Morgen wurden wir von den ‚Poulets‘, den Bullen, aus dem Bett geholt! Anscheinend hatte der Nachbar diese angerufen. Wir mussten alle drei mit ihnen auf die Wache. Der obere Straßenrand war mit einem Band abgesperrt, ebenfalls das Autowrack im Wald! Mehrere Polizisten machten sich daran zu schaffen. Man schob uns in die ‚Estafette‘ und los gings, nach Castillon zum Verhör! Wir wussten gar nicht, was das alles sollte! Sie wollten wissen, ob wir Drogen nähmen. ‚Klar, Guiness!‘, hatte Jacques geantwortet. ‚Was ist das?‘, wollten sie wissen. Wir klärten sie auf. Sie wurden sauer. Ob wir mit Drogen handeln würden, fragten sie jetzt direkt. Wir verneinten lachend. Wir hatten diesbezüglich ein ruhiges Gewissen! Was das für ein weißes Pulver sei, das da im Wald verteilt läge, und auch im Auto? Da wurde uns ihr Gehabe klar und wir mussten noch mehr lachen. Sie hatten den Zucker für Heroin oder Kokain gehalten! Am Mittag bekamen sie dann endlich den Laborbefund: Zucker! Missmutig sagten sie uns, wir könnten gehen. ‚Gehen? 15 Kilometer mit dem Jungen?‘, regte sich nun Jacques auf, ‚ihr habt uns hierhergebracht, ihr bringt uns auch wieder zurück!‘ Was sie dann auch taten. Als nach drei Tagen die Absperrung noch an der Straße war, stiegen wir trotzdem hinunter. Bis auf das letzte Körnchen hatten die Poulets den Zucker eingesammelt. Was für eine Arbeit! Zurückbekommen haben wir ihn allerdings nie. Sie hofften wohl immer noch, dass das Labor sich geirrt hatte!“ Wir wälzten uns schier vor Lachen auf dem Boden, als wir uns das Geschehene vorstellten!
Unterhalb zog eine ziemlich große Schafherde vorbei, begleitet von zwei älteren Männern und zwei Hunden. Die Hunde verbellten uns aus sicherem Abstand, bevor sie der sich entfernenden Herde folgten. „André, der Schäfer und Roger, sein Domestique“, erklärte Jacques. Jetzt aber musste ich aufbrechen. „A bientôt!“, verabschiedete ich mich und stieg den Hang hinunter.
Diesmal fand ich trotz der Dämmerung die kleine Brücke, die den Bach überspannte. Sie lag etwas weiter oberhalb. Dann war ich schon auf unserem Kiesweg und kam bald zum Wohnwagen. Kein Licht! Ein ungutes Gefühl überkam mich. Ich stieg flink zum Haus hinauf, um Ludwig dort zu treffen. Aber da war auch niemand. „Vielleicht ist er ins Dorf gegangen in die Kneipe!“, dachte ich und nahm die trockene Wäsche von der Leine. Sie war schon leicht klamm geworden, von der Abendkühle. Ich nahm sie mit hinunter zum Wohnwagen und zündete eine Kerze an. Inzwischen war es stockduster und draußen heulte ab und zu ein Käuzchen. Ein anderes, weiter entfernt, antwortete ihm. Es erinnerte mich an ‚Umma Guma‘, das Doppelalbum von Pink Floyd. Ich schaute mich im Wohnwagen um. Da lag sein Schlafsack, sein Rucksack, sogar seine Bergschuhe waren da. „Weit kann er also nicht sein, der wird schon noch kommen!“, dachte ich mir und legte mich schlafen. Ich hatte einiges an Schlaf nachzuholen!
Doch der einzige der kam, war Jean-Paul mit seiner Flasche grüner Milch. „Wo ist Ludwig?“, wollte er wissen. Wusste der etwas, was er mir nicht sagte? „Unterwegs, wird wohl bald kommen!“, antwortete ich, obwohl mir mein ungutes Gefühl sagte, dass er nicht mehr kommen würde. Denn er hätte schon längst da sein müssen, egal wo er gewesen war oder wieviel er gebechert hatte! War ihm etwas passiert, hatte er einen Unfall gehabt? War er irgendwo abgestürzt? Oder war er heimgefahren? Den letzten Gedanken verwarf ich gleich wieder. Denn alle seine Sachen waren noch da, auch sein Ausweis! Außerdem wollte Rudi, unser österreichischer Freund in zehn Tagen kommen und ihn abholen. Auch hatte er mir versprochen, mir vier Wochen am Bau zu helfen! Jean-Paul meinte, der kann schon weit sein. „Wie kommst du da drauf?“, wollte ich wissen. „Halt so… vielleicht ist er sogar tot…“ Ich redete nicht weiter von ihm und war froh, als der Bauernjunge gegangen war. „Irgendwann wird ihn wer finden!“, meinte er beim Anzünden seiner Zigarette und zwinkerte mit einem Auge, bevor er ins Dorf runterstieg.
Die Arbeit ging heute nicht voran. Zu sehr war ich in Gedanken bei Ludwig. In Gedanken ging ich all unsere gemeinsamen Abenteuer durch. Nein, der kann nicht einfach abgehauen sein, nach all dem, was wir erlebt hatten (siehe: ‚Wintermärchen‘)! Ich stieg wieder runter zum Wohnwagen und durchsuchte alles, um irgendein Wort oder ein anderes Zeichen zu finden. Nichts! Ich stieg wieder zum Haus, bog aber rechts ab und kletterte den Berg hoch. Ich verfolgte jeden Wildwechsel, jede Spur, die hätte von ihm sein können, war auf das Schlimmste gefasst. Doch nichts! Ich kam bis dort, wo das verwilderte Land in den Buchenwald übergeht und rief nach ihm. Nichts, außer dem vom Wind hergewehten, schwadenhaften Rauschen des Wassers. Ich ging dem Rauschen nach und stand bald vor einem Bach, der in einer kleinen, steilen Schlucht talwärts eilte. Ich folgte ihm am oberen Rand und fand mich plötzlich vor tiefen Einschnitten im Boden, die, erst spät sichtbar, durch die Humusschicht des Waldbodens in den darunterliegenden Felsgrund drangen. Das war Menschenwerk! Hier muss einstmals der Schiefer für die Dächer gebrochen worden sein! Ich rutschte in der dicken Blätterschicht die Böschung runter und zwängte mich am unteren Ende in den Berg hinein. Meine Füße glitten auf flachen, unter dem Laub versteckten Platten aus. Die Ader muss schräg in den Berg gegangen sein. Über mir neigten sich dicke Platten, von Feuchtigkeit und Frost leicht vom noch festen Gestein getrennt, wie ein Damokles-Schwert und drohten, bei Berührung oder Erschütterung, herunterzufallen. Kühl wehte mir der Atem des Berges entgegen. Je tiefer ich vordrang, umso mehr ging der Moosbewuchs in Algen über, am Ende war nur noch schwarzer Fels. Bis hierher waren die Steinmetze vorgedrungen, bis sie plötzlich mit ihrer Arbeit aufgehört hatten. Warum? Auf dem Boden hatte der Wind knietiefes Laub angehäuft. Ich schob es mit dem Fuß weg. Nichts, außer von oben herabgefallene Bruchstücke. Beim Hinausgehen schimmerte es gelblich an einer Wand. Ich ging näher ran. Wie Goldstaub sah das aus. Hatten wir eine Goldmine auf unserem Land? Bestimmt nicht! Das war bestimmt Pyrit, eine Schwefelverbindung, auch Katzengold genannt. Denn sonst hätten die Steinmetze mit dem Schieferabbau aufgehört und ein riesiger Krater würde jetzt da sein, wo sich unsere Wiesen ausbreiteten!
Aber es waren mehrere Spalten hier. Ich musste sie alle abgehen! Vielleicht hatte Ludwig die Gegend erkunden wollen und war in eine solche Spalte gerutscht und… Ich schob all diese hartnäckigen Gedanken zurück und stellte mir vor, wie hier drinnen gearbeitet worden war. Bestimmt hatte man zuerst mit Brecheisen dickere Blöcke aus dem Hang gebrochen, diese mit Meißeln in weniger dicke gespalten, diese dann wiederum, bis man die gewünschte Stärke erreicht hatte. Dann hatte man sie nach Größe sortiert und die Ränder mit einer Art Hackmesser gerade geschnitten. Ab und zu stieß ich auf erhöhte Kais, meist aus Abraum aufeinandergeschichtet, von Moos bedeckt, wo man die Schieferplatten wahrscheinlich auf Maultierrücken verladen hatte, um sie abzutransportieren.
Über mir lag quer ein langer, bemooster Baumstamm auf einer Spalte. Ich wollte sehen, wozu er diente, denn ich spürte, er war von Menschenhand dorthin gekommen. Ich stieg hinauf. Es war eine Wasserrinne. Der Stamm musste vor langer Zeit ausgehöhlt worden sein, um einen Wasserkanal hier rüber zu leiten. Diese ‚Rigoles‘, wie man sie nannte, zweigten von den Wasserläufen fischgrätenartig ab und durchzogen die Hänge und Wiesen zur Bewässerung. Manchmal waren sie mehrere Kilometer lang. Solche Gräben kamen auch an unserem Haus an. Nur waren sie inzwischen vollkommen mit Erde aufgefüllt, mangels Unterhalt. Wie Höhenlinien auf einer Landkarte folgten sie den Flanken der Berge.
Weiter unterhalb lag eine alte Wagenachse zerbrochen im Bachbett. Die verbogenen Ringe der zerbrochenen Räder hingen in den zerbrochenen Speichen und waren dick mit Rost und Moos bedeckt. Was war hier geschehen? War hier ein Holztransport abgestürzt? Ich folgte dem Bachlauf bergab durch den noch kahlen Wald. Bald gesellte sich ein anderer Bach hinzu und mir war, als käme ich in noch genutztes Land. Die Hänge wichen etwas zurück und ein paar flache Wiesen säumten den Bach, umgeben von Reihen ungefähr 20 Jahre alter Pappeln. Der Weg verwandelte sich nun in einen Hohlweg, durch den auch der Bach, bedingt durch einen Erdrutsch, seinen Lauf genommen hatte. Ich stapfte durch den schlammigen Hohlweg weiter und sah plötzlich die Fachwerkbemalung unseres Wohnwagens hinter den Stämmen schimmern. Daneben bewegte sich etwas!
Doch kein Ludwig da. Jean-Paul führte gerade seine zwei Kühe zur Tränke. „Wo ist Ludwig?“, war seine erste Frage. Ich zuckte die Schultern. „Vielleicht hat ihn eine Viper gebissen?“, meinte ich. „Für Vipern ist es noch zu kalt!“, erwiderte er. „Vielleicht ist er wo abgestürzt?“ sinnierte ich. „Oder – vielleicht hast du ihn umgebracht?“, sagte er zögernd. Ich lachte, obwohl mir gar nicht danach war. „Lass deine blöden Witze!“ „Ich kenne mehrere Geschichten von Leuten, die verschwunden waren und wo es sich später herausstellte, dass jemand sie umgebracht hatte!“ Er schaute mich von unten her wie prüfend mit seinen Schweinsaugen an. Er rief dem Hund etwas zu. Dieser sprang vor und zwickte die trinkende Kuh geschickt ins Bein. Bevor diese ausholen konnte, war er schon wieder einen Meter zurück. Sie drehte aber trotzdem langsam um und folgte der anderen in Richtung Scheune. Auch Jean-Paul drehte sich um und folgte den Tieren, eine blaugraue Rauchwolke hinter sich zurücklassend. „Umgebracht! So ein Idiot!“ Doch dann wurde mir plötzlich klar, dass es das sein könnte, was die Leute im Dorf erzählten! Nur auf seinem Mist alleine kann so eine Geschichte nicht gewachsen sein! Zu der Sorge um den verschwundenen Kumpel kam nun noch die Sorge um den Mordverdacht hinzu.
Ich aß nichts und fuhr nach einem Blick durchs Haus ins Tal zu den früheren Eigentümern unseres Hofes. Dort stellte man mir erst mal ein Bier hin und goss sich einen Pastis ein. Inzwischen wussten die Leute, dass ich lieber ein Bier trank anstatt diesen Aniskleister! Wir prosteten uns zu und ich erzählte die Geschichte von Ludwigs Verschwinden. „Schlangenbiss ist unwahrscheinlich. Aber dass er in ein Loch gefallen ist, ist schon möglich. Nicht am Hof, aber etwas weiter weg, wo der Boden aus Kalk besteht, gibt es ‚Dolinen‘, eine Art Krater, die oft mit Laub bedeckt sind.“ Da hatte die Bäuerin eine Idee: Sie kannte den Adjudant-Chef der Brigade, und dieser hatte einen Suchhund. Wir machten aus, uns am nächsten Morgen im Nachbarort Orgibet zu treffen. Vor der Gendarmerie. Das war zwar etwas gegen meine Weltanschauung. „Gehe nicht zum Kaiser, wenn du nicht gerufen bist!“, war meine Devise. Doch in diesem Fall war eine Ausnahme erlaubt!
Die Kaserne der Gendarmen war ein dreistöckiges Gebäude, an dem ein blau-weiß-rotes Leuchtschild mit der Aufschrift ‚Gendarmerie‘ hing. André war schon da. „Im Erdgeschoss befinden sich die Zellen. Jean-Paul aus deinem Dorf hat da schon manchmal eine Nacht verbracht!“, meinte er, sagte aber nicht, warum. Wir stiegen die pyramidenförmig ansteigenden Treppen zum ersten Stockwerk hinauf. Darüber mussten sich die Wohnungen der Gendarmen befinden. Durch die offene Tür traten wir in einen langen Flur und klopften an die Tür der Diensthabenden. Man rief uns hinein und André erzählte den Vorfall.
Doch die Gendarmen interessierte mein verschollener Gefährte wenig. Mich fanden sie viel interessanter! „Erst mal den Pass! Und die Aufenthaltsgenehmigung! - Haben sie nicht? Brauchen sie aber!“ „Wir sind doch in Europa, da brauche ich keine!“, antwortete ich. Sie klärten mich auf, dass ich ab drei Monate Aufenthalt eine solche bräuchte. „Ich bin erst drei Wochen da!“, entgegnete ich. „Können sie das beweisen, haben sie einen Einreisestempel?“ Das konnte ich natürlich nicht. Wir waren ja einfach durchgefahren! Die Sache schien sich eher zu verkomplizieren, als dass wir eine Lösung fanden. So etwas hatte ich geahnt! Gehe nicht zu den Bullen, es sei denn du hast Handschellen… André unterhielt sich inzwischen mit einem der anderen Polizisten. Sie schienen sich schmutzige Witze zu erzählen, denn ihr lautes Lachen erfüllte die verraucht Bude. Nach einer Weile fiel ihnen keine neue Schikane mehr ein und sie meinten, das wäre alles, ich könne gehen. „Und nicht vergessen, die Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen! Das dauert ein paar Monate!“ „Und mein Kumpel, und der Suchhund?“ „Für den Suchhund müssen sie nach Castillon. Und der Kumpel… Hippies gibt es so viele in der Gegend. Für einen, der verschwindet, tauchen zwei neue auf!“
Also fuhr ich mit dem Bauern nach Castillon. Die dortige Gendarmerie war ebenso hässlich wie die in Orgibet und ebenso angeordnet. Hier angekommen verließ mich der Bauer. Denn er erwartete einen Viehhändler, der seine letzten noch verbleibenden Tiere abholen wollte. Die gleiche Prozedur wie zuvor begann von neuem, angefangen mit dem Aufnehmen der Personendaten. Es stellte sich heraus, dass der Suchhund nur auf Lawinen getrimmt war. Langsam ging es auf Mittag zu. Das schien die Gendarmen zu motivieren, mein Verhör zu beenden. Aufatmend, aber um keinen Schritt weiter, stand ich wieder auf der Straße. Ich war froh, noch auf freiem Fuß zu sein! Zum Glück hatten die noch nicht von den im Dorf umlaufenden Gerüchten Wind bekommen! Oder doch, und wollten nur keine zusätzliche Arbeit haben?
Ich fuhr also wieder zurück, um mich nochmals auf die Suche nach Ludwig zu machen. Und wer kommt mir da entgegen, als ich den Berg hinauflaufe? Die Bullen aus Orgibet! Fast kommt es mir vor, als wäre ich zu früh zurückgekommen. Bestimmt hatten die in Castillon mich so lange hingehalten, damit ihre Kollegen hier erst mal ungestört rumschnüffeln konnten! Na ja, ich hatte ja nichts zu verbergen, aber Schnüffler mochte ich ganz und gar nicht! Sie grüßten zackig und wollten wissen, was wir hier einmal machen wollten. „Landwirtschaft natürlich!“ „Als Kommune?“ „Eher mit meiner Familie!“, antwortete ich. Sie klärten mich noch auf über die Anzahl der Fahrzeuge, die wir einführen durften: „1 Auto, 1 Anhänger. Alles andere muss verzollt werden!“
Vorm Wohnwagen stand die übliche Milchflasche. Jean-Paul war nicht in Sicht. Hatte er die Gendarmen gesehen? Bestimmt! Dem und seiner Oma unten im Dorf an der Kurve entging nichts! Da werden die was zu reden haben! Ich zwang mich, ein Müesli zu essen und machte mich wieder auf Vermisstensuche. Gegen Abend kam ich zum Haus zurück und sah schon von weitem, dass Jean-Paul da rumschnüffelte. „Eines Tages wird man ihn finden...!“, meinte er vieldeutig. Ich zog es vor, eine Mischung Mörtel zu machen und die letzten drei Reihen Hohlblocksteine für die Odelgrube hochzuziehen. Heute hatte ich noch gar nichts am Haus gemacht!
Als es dunkel war, fuhr ich ins Dorf. Die Kneipe war nur schwach besetzt. Man fragte mich, ob Ludwig wieder aufgetaucht sei. Jean-Paul hatte sie bestimmt über alles informiert. Außerdem hatte ja jeder die Bullen durchfahren gesehen! Jemand meinte, einer vom Dorf hatte Sonntagnachmittag einen Tramper neben der Straße gesehen, war sich aber nicht sicher, ob es Ludwig gewesen war. Das half mir auch nicht weiter. Nach zwei Bieren fuhr ich wieder zum Wohnwagen und verbrachte eine unruhige Nacht. Am nächsten Morgen machte ich erneut eine Runde, diesmal oberhalb des Hauses, wo der Wald das meiste Kulturland zurückerobert hatte. Ich entdeckte einige eingefallene Scheunen, einen verlassenen Weiler, ein ganzes System von Wegen. Ich schaute in alle Gebäude. Darin lag stellenweise noch Heu, vergilbt und auf der Wetterseite geschwärzt von den verflossenen Jahrzehnten. Der Mist war zu einer Torfschicht zusammengeschrumpft. Das Innere der Häuser ähnelte einem Freilichtmuseum. Doch nirgendwo eine Spur von meinem Kumpel!
Als es gegen Mittag war stieg ich zum Haus runter. Es musste was geschehen! Klarheit muss geschaffen werden. Ich würde jemanden von seiner Familie anrufen! Doch wen? Seinen Vater? Ich hatte manchmal bei ihm gejobbt und wir waren per du. Oder doch besser seine Freundin? Solange man ihn nicht gefunden hatte, bestand noch eine Chance, dass er am Leben war! Und schließlich war Jesus ja auch erst am dritten Tage auferstanden! Ich fuhr ins Dorf hinunter. Die Kneipe war offen. Die Wirtin spülte die Gläser. Ich bat sie, die Zähluhr auf Null zu stellen und ging zum Klo. Ich wählte die Nummer seiner Freundin.
Nach längerem Tuten hob jemand ab. Es war sie. Ich wusste nicht, wie ich ihr das Verschwinden Ludwigs beibringen sollte. Ich machte es auf französische Art. „Wie geht’s? Gut? Habt ihr auch so schönes Wetter?“ Doch dann wusste ich nicht mehr weiter. „Warum rufst du eigentlich an?“, wollte sie wissen. „Hast du Neuigkeiten von Ludwig?“, fragte ich, um langsam an das Thema ranzukommen. „Wieso Neuigkeiten? Der liegt in der Stube auf dem Sofa und pennt!“ Ich traute meinen Ohren nicht. Eine unermessliche Erleichterung durchströmte mich. Er lebte! Doch dann kam so etwas wie Entrüstung auf. „Ja seit wann denn?“, wollte ich wissen. „Was stellst du für blöde Fragen? Seit nach dem Essen natürlich!“ „Seit wann ist er denn zu Hause?“ „Seit Montagmittag, so ungefähr.“ „Das kann doch nicht angehen! Hier suchen wir überall nach ihm!“ „Da hast du wenigstens was zu tun!“, kam mir als Antwort entgegen. „Gib ihn mir mal!“ Nach einer kurzen Weile hörte ich seine Stimme am anderen Ende der Leitung. „Na, hallo! Was gibt es Neues in Frankreich?“ „Die letzte Neuigkeit ist, dass man hier seit drei Tagen nach dir sucht!“ „Warum denn das, mir geht’s doch gut?!“ „Warum bist du denn so plötzlich verschwunden?“ „Ooch, ich bin da den Hang hochgelaufen, da kam dann noch die Frau Knoblauch (so nannten wir die Mutter Jean-Pauls) an und wir haben uns mehr schlecht als recht unterhalten. Als ich dann oben auf dem Berg angekommen war, hatte ich mir gedacht, jetzt wäre es fein, einen Espresso zu trinken, und ich bin auf der anderen Seite ins Tal gestiegen. Ich war bald an der Straße und hab den Daumen rausgehalten. Und der erste, der hielt, fuhr zufällig nach Paris. Der kannte dich sogar, hatte dich mal in der Kneipe gesehen. Das war echt toll! Um acht Uhr abends war ich in Paris, schlürfte ein paar Espresso und fuhr dann schwarz mit der Metro aus dem Kaff raus. Dann wieder neben die Straße. Du, Frankreich ist wirklich das ideale Tramperland! Am nächsten Mittag war ich schon zu Hause, gerade recht zum Essen!“ „Du hättest wenigstens was sagen können!“ „Du warst ja nicht da!“ „Oder einen Zettel schreiben!“ „Ich werde doch wegen sowas nicht wieder den Berg runtersteigen!“ „Ich hatte befürchtet, dir sei etwas passiert! Jean-Paul hat schon rumerzählt, ich hätte dich umgebracht!“ „Mir was passiert!? Mich umgebracht!? Dass ich nicht wiehere! Unkraut vergeht nicht! Außerdem bin ich aus freien Stücken gekommen, da kann ich auch jederzeit wieder gehen, wenn es mir gefällt!“ Bei einer solchen Logik blieb mir nichts anderes übrig, als aufzulegen. Erleichtert, aber auch wütend!
Ich erzählte der Wirtin von dem Gespräch. Die würde schon dafür sorgen, dass es die Runde machte! Als Jean-Paul am nächsten Morgen seine grüne Milch brachte, mir mit seinen Schweinsäuglein zublinzelte und sagte: „Irgendwann werden sie ihn finden!“, erwiderte ich, dass ich Ludwig gestern am Telefon gesprochen hatte und dass er daheim sei. „Das ist nicht wahr, seine ganzen Sachen sind ja noch hier!“ Bei einem solchen Starrsinn musste ich vorbeugen! Ich fuhr zur Gendarmerie und teilte diesen mit, dass mein Kumpel daheim sei. Doch das erstaunte diese nicht. „Ihr Hippies kommt und geht, gerade wie es euch einfällt. Würden wir uns um deren Verschwinden kümmern, hätten wir viel zu tun! Alleine schon mit denen, die da sind haben wir genügend Arbeit!“
Endlich war ich wieder am Haus und konnte weiterarbeiten! Für eine Woche noch würde ich alleine sein, dann würden ein anderer Freund aus dem Dorf und Doris‘ Bruder für zwei Wochen hierher kommen. Mein Ziel war, in dieser Zeit die Fußböden beider Etagen zu verlegen, die Treppe einbauen und ein provisorisches Bad einzurichten. Mit guter Organisation könnte es klappen! Ich besorgte alles Material, ließ es aber in den Fahrzeugen, um es mit den Freunden zusammen hoch zu schaffen. Ich hatte nämlich mit Jean-Paul an der Deichsel versucht, eine Fuhre hochzuschaffen. Doch das ging schief und er landete damit im Bach. Nachher fragte ich mich, ob das nicht Absicht gewesen war, denn so schwierig war das nun auch wieder nicht! Ich arbeitete mit dem vorhandenen Material weiter. Ich zog die Wände von Klo und Badezimmer hoch, verputzte die Jauchengrube. Einmal trocken, könnte ich die Teeranstriche auftragen und später die Abdeckplatte gießen.
Ich hängte die Waschbecken auf und schloss sie an. Hierbei erwiesen sich Plastikrohre als ideal, weil leicht und einfach zu verlegen. Anstatt Gewindeschneideapparate zu benutzen, wurde alles leicht mit Schmirgelpapier angeraut und anschließend verklebt! Nur war nicht genug Druck vorhanden, damit das Wasser bis hoch in die Küche stieg. Ich besorgte eine Rolle mit 50 Metern Polyurethan-Schlauch und ein Anschlussstück mit Sieb. Ich besaß noch ein 100 Liter Plastikfass mit Deckel. Dieses sollte als Auffang- und Speicherbecken an der Quelle dienen, aus der weiter oben am Hang das kleine Bächlein hinterm Haus entsprang, welches wir schon provisorisch gestaut hatten. Zuerst bohrte ich mit dem Kurbelbohrer drei 10 Millimeter dicke Löcher nebeneinander die ich dann mit einer Raspel so vergrößerte, dass der 25mm Schlauch mit Kraft gerade da hineinging. So war er wenigstens dicht! An diesen schraubte ich das Sieb. Unterhalb davon, knapp über dem Boden, bohrte ich ein größeres Loch, in das ich ein längeres 32mm Plastikabwasserrohr einschob und mit einem Stopfen verschloss. Dieses würde zum Entfernen des Bodensatzes dienen. Von der Fassmitte bis oben bohrte ich auf der Rückseite 5mm große Löcher, durch welche das Wasser in das Fass sickern könnte. Oben unterhalb des Randes ein weiteres 32mm Loch, in welches ich einen Überlauf einschob. Nun hob ich die Quelle etwas aus und setzte das Fass ein. Ich musste es mit etwas Wasser beschweren, damit es nicht schwamm. Jetzt konnte ich vorne mit Lehm auffüllen, gut darauf bedacht, dass kein Wasser seitlich oder davor ablaufen konnte, dahinter schüttete ich feinen Kies. Durch diesen konnte nun die Quelle zum Fass sickern und durch die Löcher auf der Rückseite reinlaufen. Langsam stieg zu meiner Freude das Wasser immer höher. Ich stampfte den nassen Lehm rundherum gut fest. Natürlich war das erste Wasser trübe. Ich ließ es unten ablaufen und schon bald war das zufließende Wasser klar. Ich setzte den Deckel oben drauf, fertig! Zwar war das keine sehr große Reserve, aber man könnte später noch weitere Speicherfässer dahinter setzen. Ich war das erste Mal wieder zufrieden mit dem Geschaffenen!
Ich könnte am Haus ein großes Becken bauen, um genügend Reserve zu speichern und damit bei Bedarf eine Turbine betreiben, zumindest stundenweise, und damit Strom erzeugen. Zugleich könnte dieses Becken als Swimming-Pool dienen. Ich sah in Gedanken schon die Kinder darin herumpantschen und hörte ihr Lachen!
Reiner und Rolf waren da. Wir konnten also alles Material hochschaffen. Das Innere des Hauses glich einem schwarzen Loch mit einem doppelten Spinnennetz, dem Gebälk der zwei Fußböden. Wir stellten ein paar Pfeiler auf, verschraubten sie und schnitten das Loch für die Treppendurchlässe. Inzwischen hatte ich auch die Treppenstufen bekommen. Im Sägewerk hatten sie einen Vorrat von trockenen 32mm Kastanienbrettern, die uns ein Schreiner im Nachbardorf hobelte. Wir entfernten die lange Ausziehleiter, die vom Kellerboden bis auf den Dachboden reichte und setzten die zwei Zargen der unteren Treppe. Mit dem Handbohrer bohrten wir vor und befestigten die Zargen oben mit dicken Nägeln am Gebälk, unten an einem in einem Betonguss im Boden eingelassenen mit Nägeln gespickten Balken. Nur an strategischen Stellen benutzten wir Schlüsselschrauben. Nun hatten wir die genaue Höhe und Neigung und konnten uns an das Ausrechnen des Stufenabstandes machen. Der sollte so um die 20 Zentimeter liegen. Da die Treppen, bedingt durch einen querliegenden Balken, verhältnismäßig steil gerieten, verzichteten wir auf die Setzstufen (senkrechtes Brett hinter der Stufe), um eine breitere Trittfläche zu haben. Mit der Wasserwaage zogen wir in gleichem Abstand parallele Linien auf der Innenseite der Zargen, unter denen wir Kanthölzer, die wir zuvor mit Leim bestrichen hatten, anschraubten. Bevor der Leim anzog, legten wir noch die Stufen darauf und befestigten sie vorerst nur mit schräg in die Seiten eingeschlagenen Nägeln. Jetzt musste der Leim 24 Stunden anziehen.
Waren bisher alles Abrissarbeiten gewesen, so hatte heute der Aufbau begonnen! Jetzt sah die Bude fast schon wie eine Wohnung aus! Am Abend begossen wir das gehörig mit einem guten Bier, das die Freunde aus Deutschland mitgebracht hatten. Am nächsten Tag begannen wir mit dem Verlegen der Bodenbretter. Dieses waren Kiefernbretter von zwei Metern Länge, zu Bündeln verschnürt, rundum mit Nut oder Feder versehen. Ich kannte die deutschen Fußbodenplanken. Diese kaufte man etwas länger als vorgesehen und schnitt sie dann auf die richtige Länge ab. Somit hat man dort nur durchgehende Planken. Wir fingen mit dem Verlegen an. Dabei bemerkten wir bald, dass Nut oder Feder nicht genau in der Mitte verliefen, sondern etwas versetzt. Das führte zu leichten Kanten in der glatten Fläche. Wir mussten sie wieder rausreißen. Was war nun die richtige Oberseite? Wir einigten uns auf diejenige, wo der Rand der Nut am dicksten war. Das schien die richtige zu sein! Wir legten die erste Reihe, richteten sie aus und nagelten sie fest. Da kam die nächste Überraschung: Die Nägel verbogen sich und weigerten sich, in die Balken einzudringen! Wir hatten ‚versteckt‘ nageln wollen, also in den Rand der Feder. Das war unmöglich! Die Federn brachen uns weg! Also blieb uns nur die Möglichkeit, offen zu nageln, also durch die Oberfläche! Damit man die Nägel weniger sah, kauften wir Nägel mit einem winzigen Kopf, ‚tête homme‘ auf Französisch, also ‚Männerkopf‘. Nicht gerade ein schmeichelnder Name… Aber auch bei dieser Nagelung bogen sich manche Nägel krumm, und wir mussten sie mühselig mit dem Kuhfuß rausziehen. An deren Stelle schlugen wir später Stahlnägel, die wir extra bestellen mussten. Nachdem wir die erste Reihe verlegt hatten, blieb uns das Abschnittsstück übrig. Was machen damit? Da kam uns die Erleuchtung: Das diente als Anfang für die nächste Reihe! So wurde auch vermieden, dass die Ansatzfugen an derselben Stelle waren! Genial, das Parkett ohne Abfall! Stellenwiese mussten wir unterkeilen, denn die meist von Hand geglätteten Balken waren nicht sehr eben. Dazu nahmen wir die Leisten, die zwischen den einzelnen Lagen von Bretterbündeln auf der Palette gelegen hatten. Mit einem kurzen Abschnittsrest, der zu kurz zum Verlegen war, schlugen wir die Bretter dicht aneinander, um nicht die Nut zu verletzen. Manchmal waren diese leicht krumm. Wir hatten dritte Wahl genommen, die billigeren. Das waren anscheinend die mit leichten Fehlern und vielen Ästen! Da musste man ein Ende annageln und dann das Brett belasten, damit es nicht wieder wegrutschte und durch Schlagen mit einem Fäustel parallel neben das vorige zwingen. Jetzt schnell den Nagel hinein, damit es sich nicht mehr bewegen konnte! Erste Wahl kostete mehr als das Doppelte. Wir wollten ja keinen Tanzboden verlegen! Wichtig war auch, zu vermeiden, dass zwei Anschlussstücke sich zu nah nebeneinander befanden. Bald roch es in der Küche wie beim Holzfällen, nach Harz und Holz. Mit jeder verlegten Reihe wurden wir geschickter und arbeiteten immer mehr Hand in Hand, so dass wir am Abend vor der offenen Feuerstelle eine drei Meter breite Fläche geschaffen hatten. Da bot sich ein erstes Kaminfeuer an! Während ich mich darum kümmerte, holten die anderen Proviant und Schlafsäcke aus dem Wohnwagen und bald lagen wir um das Feuer und ließen es uns gutgehen. Wir schauten in die wärmenden Flammen, beobachteten das sich erst in Kohle, dann in Glut verwandelnde Holz, aus dem hier und da brennendes Gas strömte wie aus einem Feuerzeug, und erlagen bald seiner hypnotischen Magie! Uns wurde bewusst, dass das Feuer, seitdem die Menschheit besteht, das Zentrum des Zusammenlebens gewesen ist! Es war uns wie ein Symbol der uns alle durchströmenden Lebenskraft. Erinnerungen kamen in uns hoch, von anderen Feuern an anderen Orten, wo wir zusammen gewesen waren. Von nun an schliefen wir im Haus.
Die Freunde waren seit über einer Woche da. Wir hatten inzwischen den Fußboden vom Dachboden angefangen. Schlechtes Wetter hatte Kälte gebracht und machte alles etwas ungemütlich. Doch bei der Arbeit wurde uns wieder warm. Es war Abend, wir saßen im Wohnwagen und kochten. Der Regen trommelte leicht auf das Dach. Draußen stand das Wasser in den Radspuren, nur die Käuzchen waren unterwegs. Von überall her schallten ihre etwas schaurigen Rufe und Antworten. Ich öffnete die Wohnwagentür um mich draußen zu erleichtern, denn das deutsche Bier verursachte einen chronischen Blasendruck. Da sah ich plötzlich durch das Dunkel eine Gestalt sich nähern. Mit Zick-zack-Sprüngen versuchte sie, die Pfützen auf dem Weg zu vermeiden. Wer konnte das sein? Ich machte die Taschenlampe an. Da erkannte ich den Springer: Es war Rudi, unser österreichische Freund! Mit dem hatte ich nicht gerechnet. „Hallo!“, rief er, „so ein Mist! Ich wollte euch überraschen. Doch Ludwig hat mich schon erkannt und euch mein Kommen gemeldet!“ „Ludwig – dein Ankommen?“ Ich blickte nicht ganz durch. Da schrie wieder ein Käuzchen. „Hörst du? Er ruft wieder! Der muss irgendwo da am Hang sitzen!“ „Komm erst mal rein ins Trockene!“, sagte ich. Wir begrüßten uns. Die Anderen rückten etwas zusammen und ich legte einen weiteren Teller auf den kleinen Tisch. Jemand stellte ihm ein Bier hin, ich verteilte das Essen. „Wo bleibt Ludwig, warum kommt der nicht rein?“, wollte er wissen. „Ludwig ist schon seit 10 Tagen nicht mehr da. Er war plötzlich heimgetrampt, ohne was zu sagen!“ Und ich erzählte ihm kurz die Geschichte. „Und ich fahre 1300 Kilometer, um ihn abzuholen! Wir hatten vorgehabt, noch eine Woche durch Frankreich zu fahren, wie Asterix und ‚Die Tour De France‘!“ „Und ich dachte, er hätte dich benachrichtigt!“, gab ich zurück. Wir aßen erst mal und tauschten die Neuigkeiten aus. „Wisst ihr was?!“, meinte er nach einer Weile, „Spanien ist, laut meiner Karte, nicht weit. Morgen fahren wir alle dorthin! Bei dem Sauwetter könnt ihr eh nicht arbeiten!“ Nach dem Essen holte er seinen ‚Musterkoffer‘ aus dem Auto und seine Rollmaschine und baute einen Joint. Er reichte ihn mir zum Anrauchen. „Nein danke!“, lehnte ich ab, „Mit der Baustelle brauche ich einen klaren Kopf. Vorerst bleibe ich noch Abstinenzler!“ Er zündete ihn selber an. Bald verdickte der Rauch die Luft des Wohnwagens. Die Stimmung stieg um ein paar Grade! Er holte sein Tonbandgerät mit den Dubliners aus dem Auto. Später überließen wir ihm den Wohnwagen und stiegen zum Haus hoch.
Am nächsten Morgen machten wir eine Baustellenbesichtigung und schauten unser Land an. Darüber wurde es Mittag. Dann fuhren wir alle vier mit seinem roten Simca über den Pass nach Spanien. Der Regen hatte wieder eingesetzt und oben auf dem Pass befanden wir uns voll in den Wolken. Schade, denn von hier oben hatte man sonst einen sehr schönen Blick auf unseren Hof! Rudi tastete sich langsam die schmale, kurvige Straße hinunter. Schemenhaft sahen wir die von Flechten behangenen Bäume mit dem Unterwuchs aus Buchsbaumboschen. Langsam wurde die Sicht wieder besser. Klar, dass die spanischen Zöllner ein paar Fragen an uns hatten. Im zweiten spanischen Dorf hielt Rudi an. „Ich lade euch alle zum Essen ein!“, meinte er und steuerte ein Gasthaus an. Doch es war schon drei Uhr nachmittags vorbei, selbst für Spanien etwas spät! Man vertröstete uns auf abends. Doch das war zu spät für uns. Wir schlenderten durch die wenig belebten Straßen. Souvenirläden wechselten mit Modebutiken und Zigaretten- und Alkoholläden ab. Wir zogen uns vor dem Nieselregen in eine Kneipe zurück, bestellten vier Gläser Rotwein und knabberten Erdnüsse. Plötzlich klirrten die Gläser in den Regalen und die Flaschen tanzten. Alle rannten hinaus, nur wir blieben, weil wir dachten, hinterm Haus sei ein Zug vorbeigefahren. Ein Mann kam zurück und zog uns an den Ärmeln hinaus. Er sprach irgendwas von ‚Terremoto‘, ‚Seismo‘. Wir hatten verstanden! Alle redeten aufgeregt durcheinander. Als eine Weile alles still blieb, gingen die ersten wieder zurück in die Bar. Wir folgten ihnen und wir alle tranken ein Glas auf das Überleben! Doch bei so einem Wetter ist selbst der sonst so sonnige Süden grau. Mit leeren Mägen fuhren wir wieder zurück nach Frankreich.
Der Regen verwandelte sich langsam in dicke Flocken. Je näher wir der Passhöhe kamen, desto mehr blieb der Schnee auf der Straße liegen. Tief neigten sich die dick mit Schnee beladenen Äste über die Fahrbahn. Das Auto rutschte in den Kurven und wir hatten immer mehr Mühe, vorwärts zu kommen. Wir waren nur 100 Meter von der Passhöhe entfernt, als es immer langsamer wurde und dann zum Stehen kam, aber nur ganz kurz, bis es dann plötzlich rückwärts rutschte. Wir drei schnell raus und schieben, während Rudi vergeblich auf das Bremspedal trat! „Was hast denn du da für Gurken auf den Felgen, das sind ja keine Reifen mehr!“, staunte Rolf. „Ich hatte extra die alten Sommerreifen drauf gemacht, weil ich dachte, hier im sonnigen Süden tun die’s noch gut!“, meinte Rudi. So war das also, und wir konnten nun schauen, dass wir die Karre auf den Pass schoben! Und wir schafften es!
Oben hielt Rudi an, holte seinen Fotoapparat aus dem Handschuhfach und meinte theatralisch: „Solche Momente verdienen es, für die Nachwelt festgehalten zu werden!“ Und bums, hatte er einen Schneeball im Gesicht! Wir ließen ihn alleine runterfahren. Uns war es zu riskant, in seinen Schlitten einzusteigen. Wie weiße Dünen lagen die Berge unter uns. Leider versteckten sich die höchsten in den Wolken. Und auf einer dieser weißen Dünen musste auch unser Hof liegen! Doch all die Hügel sahen sich so ähnlich… „Ich lade euch alle zum Essen ein!“, meinte Rudi. „Das ist schon das zweite Mal, dass du uns heute einlädst, das können wir nicht annehmen!“, frotzelte Reiner. Wir hielten Ausschau nach einem Restaurant-Schild. Im ersten Nest, durch welches sich die enge Straße schlängelte, sahen wir nichts. Doch im zweiten erkannten wir ein Schild: ‚Auberge de l‘Izard‘. Es war aber nur die Bar offen, es war anscheinend Aperitif-Zeit. Fragen kostet nichts… Die Wirtin schaute uns an und überlegte, ob sie uns sagen sollte, dass heute Ruhetag ist. Doch dann siegte ihr Wertschätzungsgefühl und sie schloss eine Seitentür auf. Sie knipste das Licht an und führte uns in einen langen, etwas muffig riechenden Raum, wo zwei Reihen mit Wachstuch bedeckter Tische standen. Sie platzierte uns in der Nähe des offenen Kamins, der jedoch nicht brannte. Sie stellte eine Gasflasche mit einem Heizaufsatz neben uns und fragte, was wir trinken wollten. Alle wollten natürlich einen Pastis, nur ich zog ein Bier vor. Rudi, der gut Französisch sprach, verhandelte schon mit ihr wegen des Essens.
„Die gute Frau fragt, ob wir mit etwas Einfachem zufrieden wären, da sie im Augenblick nicht groß auf Gäste eingestellt sind!“, erklärte uns Rudi. „Egal was!“, meinten wir, „Hauptsache, man kann es essen!“ Inzwischen machte sich ihr Mann am riesigen Kamin zu schaffen, und bald züngelten die ersten Flammen. Von den Wänden schauten Jagdtrophäen auf uns herab. Ein enormer Hirschkopf, mehrere hakenförmige Geweihe, wohl von Gämsen, und der mit Stoßzähnen bewaffnete Kopf eines Wildschwein-Ebers. „140 Kilo!“, meinte der Wirt, als er unseren Blick darauf gerichtet sah. Es entspann sich ein Gespräch, während langsam die Flammen das dicke Holz annagten und etwas Wärme zu uns strahlten. Rudi schien sich mit Jagd etwas auszukennen, und wir erfuhren, dass das Gasthaus ‚Zur Gams‘ hieß, und die Pyrenäengämsen, die etwas kleiner sind als die der Alpen, ‚Isard‘ hießen.
Die Freunde bestellten einen neuen Pastis. Inzwischen hatte die Wirtin eine enorme Terrine dampfender Suppe vor uns gestellt, holte vier tiefe Teller aus einem Wandregal und schöpfte uns voll ein. Tat das gut! Bald schon strömte wohlige Wärme bis in unser Knochenmark! Klar, dass wir uns nochmal nachschöpfen ließen! Wir ließen einen kleinen Rest, nicht aus Anstand, sondern weil wir dachten, dass die Wirtsleute ja auch noch essen mussten! Bald folgte eine Schüssel mit Leberpastete, eine Platte mit Hartwurstscheiben und Schinken darauf, garniert mit winzigen sauren Gürkchen, genannt ‚Cornichons‘, und sie entschuldigte sich, dass sie keinen Salat hatte. Dazu einen Korb mit aufgeschnittenen Baguettes und eine Karaffe Rotwein und eine andere mit Wasser. Klar, dass wir bei diesem Wetter das Wasser unberührt ließen! Uns wurde plötzlich klar, dass wir seit dem Frühstück außer den spanischen Erdnüssen nichts gegessen hatten und machten uns über die ‚Brotzeit‘ her. Die Wirtin schaute bisweilen durch die Tür und schien sich über unseren Appetit zu freuen. Wir wussten nicht, ob es außer dieser ‚Brotzeit‘ noch etwas anderes gab und hauten rein, bis nichts mehr auf den Platten war. Wir fühlten uns wieder wie Menschen!
Der Wirt kam wieder herein, in der Armbeuge ein paar Scheiter, und legte nach. Funken stoben hoch und verschwanden mit den züngelnden Flammen in der Esse. Vor dem Hinausgehen sammelte er noch die Teller ein. „Das wars wohl!“, meinte Rolf, ich bin jedenfalls gut satt!“ Wir waren seiner Meinung. Da kam der Wirt zurück und deckte flache, wie wir merkten, vorgewärmte Teller auf. „Das scheint noch weiter zu gehen!“, stellte einer von uns fest. Und so war es! Eine riesige Schüssel mit dampfenden Salzkartoffeln wurde mitten auf den Tisch gewuchtet und eine Terrine, randvoll mit einer dunklen Sauce, aus der Fleischbrocken herausragten, folgte. Sie verbreitete einen Duft, der uns sogleich wieder vergessen ließ, dass wir eigentlich schon satt waren. Und sogar ich als Vegetarier war bereit, eine weitere Ausnahme zu machen! Und als dann der Wirt uns mitteilte, dass dieses Ragout von einem erst vorgestern von ihm in den Bergen geschossenen Wildschwein stammte, da fühlten wir uns wie die unbeugsamen Gallier in ihrem Dorf beim Schlussbankett! Die Karaffe leerte sich, ebenso wie die Terrinen. Die Wirtin schaute des Öfteren rein. War sie wirklich so besorgt um unser Wohlergehen oder hatte sie Bedenken, dass wie all ihre Vorräte aufaßen? Als wir uns wohlig zurücklehnten und die Beine ausstreckten, kam noch eine Käseplatte, mit einem halben Laib etwas weichlichem, kleinlöchrigem Käse auf den Tisch. Als man uns feierlich erklärte, das sei Käse aus dem Dorf, der ‚Pic de la Calabasse‘, so benannt nach dem höchsten Berg der Gegend, überwanden wir unser Sattheitsgefühl und schnitten uns jeder eine dicke Scheibe davon herunter. Er hatte etwas die Konsistenz des ‚Räskäses‘ aus dem Bregenzer Wald, nur schmeckte er noch übler. Rudi fragte nach etwas Knoblauch, und wir belegten das Käsestück mit dünnen Scheiben davon und bestäubten das Ganze mit etwas Pfeffer und Salz. Das war ein Genuss! Rudi fragte nach einem guten Rotwein. Nach einer Weile kam der Wirt mit ein paar verstaubten Flaschen zurück und hielt sie uns unter die Nase. Was verstanden wir schon von Wein, außer vielleicht Rudi, der umständlich seine Brille raussuchte und die Etiketten studierte! Bei Käse und Rotwein gedachten wir all der Gegenden, wo wir schon zusammen beides genossen hatten: Girlan, das Sarntal, beim Hiesel, im Lecknertal… „All das sind ‚kosmische Schnittpunkte‘, auch St. Lary!“, klärte Rudi uns auf.
Nach einer Weile ersetzte die Wirtin die fast leere Käseplatte durch eine warme, nach Butter und Schnaps duftende Blätterteig-‚Croustade‘, der hiesigen Spezialität, gespickt mit Backpflaumen. Wer wollte, bekam dazu einen dicken Kaffee. Da tauchte der Wirt wieder auf, diesmal aber nur eine Flasche in der einen Hand und fünf Gläser in der anderen, und setzte sich zu uns. Er stellte vor jeden ein Glas und füllte es randvoll mit der klaren Flüssigkeit aus der Flasche. Wir prosteten uns zu und probierten. Wir bekamen rote Köpfe und Atemnot. Außer Rudi, dem Österreicher setzten wir alle die Gläser gleich wieder ab. Der zeigte dem Wirt, dass ein Vorarlberger einem Arièger in keinster Weise nachsteht! Der Wirt bot uns seinen Tabak an. ‚Bergerac‘ stand auf dem Paket, vielleicht war das der Tabak der ‚Bourgeoisie‘, der ‚Caporal‘ der Tabak der Schäfer. Doch waren auch seine Papiere nicht gummiert.
„Was macht ihr hier um diese Zeit?“, wollte er wissen, das ist doch wirklich kein Touristenwetter!“ „Wir haben einen Hof in der Nachbargemeinde gekauft und wollen uns hier niederlassen!“, erklärte ich.“ „Also eine Kommune“, folgerte er, „das hatten wir hier in der Gemeinde auch schon gehabt!“ Ich erkannte die Ursache des Missverständnisses und klärte ihn auf. „Nein, das sind alles Freunde, die beim Herrichten des Hauses helfen. Später wird meine Familie nachkommen!“ Natürlich hatte er schon von uns gehört. Alle schienen nur noch von uns zu reden. Vor allem Jean-Paul hatte auch im hiesigen Café seine Storys erzählt. „Il faut être fou pour venir ici!“, meinte er. Ich fasste es als Anerkennung auf. Jedenfalls kannte er Marinette, die frühere Besitzerin und auch unseren Hof. Er war schon öfter dort gewesen, zum Pilze sammeln. „Sehr steil und ziemlich verwildert!“, stellte er fest, „aber ein gutes Eck für Steinpilze und Lorchel!“ Doch irgendwann war die Flasche dann leer, was uns als Anlass diente, aufzubrechen. Doch das war gar nicht so einfach, denn plötzlich spürten wir die Folgen der französischen Mahlzeit! Rudi bezahlte und gab noch ein gutes Trinkgeld. Denn getrunken hatten wir wirklich mehr als gut und als gut tut!
Mit vereinten Mühen, Witzen und Hinweisen an den Fahrer schafften wir es, das Auto auf den Berg zu bringen. Der Schneefall hatte aufgehört und die glatten Reifen fanden auf dem schotterhaften Untergrund nun auch etwas zum Beißen. Am Ende der Straße angekommen, quälten wir uns aus den Sitzen. Die drei schliefen unten im Wohnwagen, ich kroch den Hang hinauf, denn mein Schlafsack lag in der Küche. Zum Glück hatte ich zusätzlich eine von Rudis Kamelhaardecken dabei, mit denen er neben seinen Garnen zusätzlich handelte (siehe Hippie Trail 2). Diese, mit kleinen Webfehlern versehen, waren nicht teuer und er hatte all seine Freunde damit ausgerüstet. Am nächsten Tag brach er wieder auf. Ohne Ludwig. Der lag schon daheim auf dem Kanapee. Doch hatte Rudi nicht bereut, hierhergekommen zu sein in das kleine gallische Dorf…
Alle Fußböden waren verlegt, die Treppen gesetzt, die alten Fenster rausgerissen und neue Rahmen eingesetzt, die zugleich die Fensterstürze, die etwas durchhingen, verstärken sollten. Reiner und Rolf waren abgereist. Ich war wieder allein. Außer Jean-Paul oder seiner Mutter. Die hüteten jetzt auf unserem Land ihre Schafe. Ich hatte es ihnen erlaubt. Im Tausch sollten sie unser Feld mit ihrem Kuhgespann umpflügen, denn mit ihrem Traktor, einem riesigen, roten und russischen AVTO, kam man hier nicht hoch. Sie hätten ihn umgeworfen. Rund dreihundert Meter vom Haus hatte ich eine starke Quelle entdeckt und überlegte, wie ich sie zum Haus leiten könnte. Denn die Idee von einer Turbine zum Stromerzeugen ging mir nicht aus dem Kopf.
An einem Abend, als ich hungrig mit Material aus der Stadt zurückkam, sah ich das Gasthaus erleuchtet und die Tische gedeckt. Ich hielt an und fragte, ob ich heute hier essen könnte. Die Wirtin druckste etwas herum, sprach von geschlossener Gesellschaft. Als ich wieder fahren wollte, kam einer von den Anwesenden und sagte, ich könne mit ihnen essen. Es sei das Jahresessen der Jäger und ich sei willkommen, da sie ja auch auf meinem Land jagten. „Vielleicht wirst du ja auch einmal Jäger!“, fügte er lachend hinzu. Da saß ich nun, zwischen rund 50 anderen, meist Unbekannten, an den U-förmig aufgestellten Tischen. Ich erkannte Yvon, den Bürgermeister, Jean-Louis, der ihn immer eingewiesen hatte, wenn er mit seinem LKW Sand hochfuhr, und manch anderen, den ich schon in der Kneipe getroffen hatte. Es ging hoch her, das Essen war sehr gut, natürlich Wildschwein in all seinen verschiedenen Zubereitungen. Später wurden die Tische dann übereinander an einer Wand aufgestapelt, die Stühle rundherum an die Wände gestellt für die älteren Leute, und wer von den Anwesenden noch konnte, drehte sich zu den Klängen eines Akkordeons, gespielt von einem älteren Mann. Diesen hatte ich schon des Öfteren gesehen. Es war der Postbote des oberen Teiles des Tales. Er kam bald mehr ins Schwitzen als die Tänzer und kühlte sich mit Bier ab. Jetzt verstand ich, warum er immer auf dem Hintersitz seines ‚Ami 6‘ eine Kiste Bier stehen hatte. Er litt an Schweißausbrüchen!
Am nächsten Tag ölte ich noch alle Fußböden mit einer Mischung aus 2/3 Leinöl und 1/3 Terpentin ein, denn tags darauf wollte ich heimfahren. Bis zu unser aller Ankunft wäre alles gut eingezogen! Ich hatte mit den Streifen einer Plastikplane eine Passage auf dem leicht angeschliffenen Boden gelegt, damit ich den Boden nicht beschmutzte und fing am entfernten Ende an, mit einem Malerquast alles dick einzustreichen. Da hörte ich eine Frauenstimme sprechen. Es war Jean-Pauls Mutter, sie sprach zu sich selbst. „Bou diu! Da ist ja schon eine Treppe, und die Fußböden sind drin!“ Ich hörte ihre Schritte die Treppen hochkommen. „Die fehlt mir gerade noch!“, dachte ich und strich weiter. Ihre Schritte näherten sich. „Ach da bist du! Ist das aber sauber hier. Alles neu! Heute ist Palmensonntag, da darf man nicht arbeiten!“, rief sie und stand schon hinter mir, um mich mit Küsschen zu begrüßen. Ich legte den Pinsel weg und stand auf. Ich traute meinen Augen nicht: Sie war mit ihren kackigen Holzschuhen über das saubere, weiße Parkett gelaufen! Ich stieß einen Schrei aus: „Ist sauber… War sauber, willst du wohl sagen! Ich habe extra die Plane ausgelegt, damit man darauf laufen soll!“ „Die hab‘ ich schon gesehen, aber ich wollte sie nicht schmutzig machen!“ Ich führte sie die Treppe hinunter vor die Tür uns sagte: „Ab jetzt: Betreten der Baustelle verboten! Außerdem ist die Farbe sehr giftig, 14 Tage darf man da nicht rein!“ Ich sagte das, um sicher zu gehen, dass sie nicht in meiner Abwesenheit hier rumschnüffeln würden. „Heute ist Palmensonntag, da darf man nicht arbeiten!“, fing sie wieder an. „Und was tust du?“, fragte ich sie. „Ich hüte nur die Schafe!“ Ich bereitete einen Putzlappen und Wasser, um den Dreck wegzuwischen. Sie nahm den Eimer, stellte ihre Holzschuhe auf die Seite und wollte wieder hochgehen. Sie war barfuß. Und ihre Füße sahen aus wie ihre Schuhe! „Das mach ich schon!“, sagte ich und nahm ihr den Eimer ab. „Wie gesagt, in der Farbe ist Gift, das ist zu gefährlich für dich, so barfuß!“
Am Abend war ich fertig. Das Haus duftete wie ein Kiefernwald! Ich zog eine Kette hinter dem Türrahmen durch, steckte sie durch ein Astloch in der Tür, und hängte ein Schloss darein. Ich schlief die Nacht im Wohnwagen. Am nächsten Morgen fuhr ich zurück nach Deutschland.