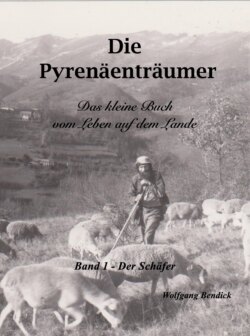Читать книгу Die Pyrenäenträumer - Der Schäfer - Wolfgang Bendick - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
FRÜHLING
ОглавлениеOstern feierten wir alle zusammen in unserem alten Holzhaus. Die Nachbarn wussten, dass wir bald abreisen würden und fragten nach so manchen Sachen. Das Mostfass rollten wir drei Häuser weiter, als Spielhaus für die Kinder des Nachbarn. Unsere aus Baumstämmen gefertigten Möbel schienen gerade in Mode zu kommen und fanden Abnehmer. Unseren dreitürigen Holzbackofen, den wir beim Sperrmüll gefunden hatten, verkauften wir, ebenfalls den VW-Pritschenwagen, der erst seit kurzem TÜV hatte. Martin hatte eine Überraschung für uns bereit: Er hatte auf dem Schrottplatz eine Turbine gefunden, genauer gesagt, ein ‚Pelton-Rad‘. Das war ein Blechkasten, in dem sich auf einer Achse ein Eisenrad befand, dessen äußerer Rand mit löffelförmigen Schäufelchen besetzt war. Durch eine oder mehrere Düsen trifft ein Wasserstrahl unter hohem Druck auf die Schäufelchen und versetzt das Rad in Drehung. Mittels eines Keilriemens kann man nun die Drehung auf einen Generator oder die Lichtmaschine eines Autos übertragen. Das war genau das, was wir brauchten!
Das gab natürlich zusätzliches Umzugsgut. Wir erhöhten die Bordwände des Anhängers mit dem Rahmen unseres selbstgebauten Bettes und machten uns ans Laden. Was nicht mehr reinging, packten wir auf das Autodach, denn das Innere des Busses wollten wir zum Schlafen freihalten, denn wir rechneten wieder mit drei Tagen Fahrt. Ich ging ein letztes Mal durch alle Räume, um sicher zu sein, nichts übersehen zu haben. Diesmal war wirklich alles leer, anders als damals, als wir eingezogen waren! Fast öde sah es aus. Jedes Zimmer hatte einen anderen Geruch, bemerkte ich plötzlich und wie Momentaufnahmen erschienen vor meinem inneren Auge Erinnerungen aus der Zeit in diesem Haus. Ein paar Tränen stiegen mir in die Augen… Ich ging ein letztes Mal durch den Stall. Schwach roch es dort noch nach unseren Geißlein. Wie mochte es denen gehen? Nochmal um das Haus, durch den Garten und zurück zum Tor. „Adé! Es muss sein! Danke dir, du trauter Ort, dass du uns ein paar Jahre beherbergt hast! Segen für die, welche nach uns hier wohnen werden!“ Mein Blick fiel auf die Inschrift, die ich oberhalb der Tür angebracht hatte. Als wir noch im ‚Blumenhäuschen‘ (siehe ‚Grün ist das Leben‘) gewohnt hatten, wurde ich oft von Leuten gefragt, ob ich nicht auch etwas auf ihr Haus malen könnte. Einmal gab mir jemand eine Schablone, um sie ihnen als Türinschrift zu malen. Ich benutzte sie auch bei uns:
Dies Haus ist mein und doch nicht mein.
Dem nach mir wird es auch nicht sein.
Den vor mir trug man auch hinaus -
Drum sag mir: wem gehört dies Haus?
Fast alle Nachbarn, mit denen in Kontakt zu kommen oft lange gedauert hatte, standen am Weg und winkten. Ich fühlte mich das erste Mal als hier zugehörig! Aber es half nichts. Eine Seite unseres Lebensbuches war dabei, umgeblättert zu werden. Wir stiegen ein, Gang rein, und los ging’s! Wir hielten kurz bei Martin an. Er machte noch ein Foto von unserem ‚Zigeunerwagen‘, wie er unser Fuhrwerk nannte.
Wir zuckelten am Bodensee entlang, durch den ewigen Stau, durch den Schwarzwald und Lörrach zur französischen Grenze. Dort winkte man uns auf die Seite. „Les papiers, s’il vous plait!“ „Was denn für Papiere? Das ist doch alles altes Zeug! Wie sollen wir davon Papiere haben?“ „Dann muss man sie halt anfertigen! Jedenfalls sind die Büros für heute schon geschlossen. Morgen ab 9 Uhr sind sie wieder geöffnet!“
Wir verbrachten die Nacht auf einem halbfertigen Parkplatz zwischen Fernlastern, die anscheinend auch auf das Öffnen des Zollbüros warteten. Während Doris die Kinder abfütterte, ging ich in eines der Büros. Man gab mir eine Liste. In dreifacher Ausführung sollte ich da alles Umzugsgut eintragen und dessen Wert. Eventuell müssten wir noch Zoll dafür zahlen. Ich war vor allem froh, dass ich nicht abladen musste! Ich setzte mich auf eine Bank und fing an, aus meinem Gedächtnis alles niederzuschreiben. Als die erste Liste voll war, fragte ich nach einer weiteren. Der Beamte war entsetzt über meine Genauigkeit. Nein, so sei das nicht gemeint gewesen, halt nur in groben Zügen, die größten Gegenstände! Außerdem stellten sie für uns eine Einreisebestätigung aus, die notwendig war für das Beantragen der Aufenthaltsgenehmigung in der Präfektur des Wohnortes. Es war Mittag, bis alles ausgefüllt und gestempelt war. Wir machten uns also wieder auf die Landstraße. Die Autobahn war noch im Bau; außer der von Paris nach Marseille, über Lyon, durch das Rhone Tal gab es noch keine andere. Und prompt hielt, als wir gerade Rast machten, ein ziviles Auto an, mit nicht Zivilen, die uns ihren Ausweis unter die Nase hielten. Klar, dass so eine Fuhre nicht unbemerkt bleiben konnte! Was wir da transportierten, wollten sie wissen. „Umzugsgut!“, antwortete ich und hielt ihnen meinerseits die vom Zoll gestempelte Liste vor. Das schien sie zu beeindrucken, damit hatten sie wohl nicht gerechnet! Mit der Liste in der Hand gingen sie einmal um die Fahrzeuge rum und schienen zufrieden. Und das waren auch wir, als sie wieder wegfuhren!
Eigentlich wollten wir die Autobahn vermeiden, denn bei unserer ersten Reise hatten wir festgestellt, dass man an den Mautstellen einen Mechanismus überfuhr, der automatisch die Achsen zählte. Mit drei Achsen war man wie ein LKW eingestuft oder Sattelschlepper. Zu unserem Leidwesen führten uns vor Lyon alle Fernverkehr-Wegweiser auf die Autobahn. Es blieb uns nichts anderes übrig, als diese zu nehmen. Zum Glück war diese kostenfrei, wohl um die Stadt vom Durchgangsverkehr zu entlasten! Doch das merkten wir erst hinterher. Wir atmeten erleichtert auf, als wir das Mittelmeer sahen. Wir suchten einen Platz, wo wir alles abstellen konnten, krempelten uns die Hosen hoch und rannten durch das Wasser. Die Mandelbäumchen blühten violett, gelbe Ginsterbüsche zeigten an, dass wir uns endlich im Süden befanden!
Als erstes stiegen wir zum Haus hoch. Alles war, wie ich es vor zehn Tagen zurückgelassen hatte. Dass aber jemand da oben gewesen war, zeigte uns die Schafskacke vor dem Haus. Auch war das kleine Feld gepflügt. Wir stellten fest, dass die Erdkrume nicht dick war. Sie hatten praktisch mit dem Pflug nur die Grasnarbe umgelegt, darunter lag schwarz-grauer Schiefer. Die Kinder schwärmten aus und entdeckten bald den Sandhaufen. Martins Mutter hatte jedem vorm Wegfahren aus ihrem ‚Tante-Emma-Laden‘ ein Netz mit Sandkasten-Utensilien geschenkt. Damit nahmen sie den Sandhaufen in Angriff. Ich schärfte ihnen ein, den Sand nicht zu weit zu verteilen. Denn bis dieser hier oben war, hatten wir ihn schon dreimal umgeschaufelt! Jedenfalls hatten wir die Kinder so im Auge. Wir setzten uns an die Mauer und genossen die Frühlingssonne. Wir verschoben das Abladen auf den nächsten Tag. Die 1300 Kilometer hatten uns ganz schön geschafft! Nur die Kinder schienen nach dem langen Eingesperrtsein in Höchstform. Es war der 16. April 1980.
Die erst Nacht schliefen wir alle im Wohnwagen. Dann zeigte ich Doris, wie man den Motormäher anmachte und wie die Winde betätigt wurde. Wir schafften unser letztes Umzugsgut den Berg hoch. Langsam nahm alles Gestalt an und die Räume wurden gemütlich. Vor allem, als der Küchenherd angeschlossen war. Anfangs kam das Badeofenrohr aus dem Keller durch den Fußboden in die Küche und ging dann zusammen mit dem Rohr vom Herd durch die Wand nach draußen. Doch schon bald baute ich vor der Außenwand einen Schornstein. Das war sicherer und ergab einen besseren Zug. Dort, wo vorher das Ofenrohr die Wand durchstoßen hatte, brach ich weitere Steine heraus und schuf eine zusätzliche Fensteröffnung.
Den Dachboden verkleideten wir mit gehobelten Kiefernbrettern, um ihn wohnlicher zu gestalten. Hier waren sie Fenster noch einigermaßen brauchbar. Doch die Scheiben fehlten. Ich sägte das Kreuz heraus und setzte ganze Scheiben an die Stelle der kleinen. Unten in der Küche nagelten wir aus Dachlatten Rahmen, bespannten sie mit Plastik und setzten sie in die Fensteröffnungen, um es behaglich zu haben. Denn trotz des Südens konnten die Nächte noch kalt werden, geschweige denn die Tage, wenn es regnete und stürmte!
Das Haus war wohnlich. Nun machten wir uns daran, den Stall auszumisten, um für die ersten Tiere Platz zu schaffen. Mit Pickel und Zinkenhacke ging ich der kniehohen Mistschicht zu Leibe und kippte diese die Böschung hinunter, wo Doris sich daranmachte, den Mist im Garten zu verteilen. Darunter kam ein in den Felsen geschlagener, fast ebener Boden zum Vorschein, mit Gräben darin und einem Ablauf unter der Wand nach draußen. Alles war natürlich durch den Zahn der Zeit und den Urin der Tiere gut angenagt. Mit ein paar Mischungen Beton machten wir alles wie neu. Im Mist fanden wir sogar noch ein paar Anbindungen für Kühe. Anfangs wussten wir nicht, was das war. Jean-Paul erklärte uns das System, denn sie hatten es ebenfalls in ihren Stall unterhalb von uns. Aus den Lianen von ‚Chevrefeuille‘, diesen Ranken, die sich die Bäume hochwanden und deren weiße Blüten im Frühjahr diesen wunderbar betörenden Duft aussenden (wir als Kinder hatten sie ‚Judenstrick’ genannt und geraucht), hatten unsere Vorgänger Kettenglieder geflochten und zu einer Kette verbunden. Das letzte Glied war gleitend an einem senkrechten Pfosten vor der Raufe angebracht, das erste hing um ein u-förmiges, zweifingerbreites Holzteil, das um den Hals des Tieres befestigt wurde. Das ließ dem Tier genügend Bewegungsfreiheit zum Liegen oder Aufstehen und hinderte es, die Nachbarinnen zu belästigen. Um das Tier loszubinden, musste man den Halsring unten leicht zusammendrücken, wodurch der Holzbolzen, der es abschloss, frei wurde und nach einer Vierteldrehung herausgezogen werden konnte. Somit war das hölzerne Halsband offen und das Tier frei. Genial! ‚Stackdetsch‘ nannten die Alten dieses Halsband. Nur wenige wussten es noch anzufertigen. Mit ihrem ‚Opinel‘-Taschenmesser schnitzen sie das große Teil aus frischem Eschenholz und biegen es über Dampf in die Form eines U. Dahingegen nehmen sie für den Bolzen, der das Ganze geschlossen halten soll, trockene Esche. Der Bolzen wird genau an die zwei Öffnungen angepasst, durch die er gesteckt wird. Ist einmal das Halsband getrocknet, bleibt der Bolzen bei geöffnetem Zustand mit dem Halsband verbunden und kann nicht verloren gehen.
Doch bevor es an das Umgraben des Gartens gehen sollte, wollten wir die Kartoffeln setzen. Wir versuchten eine Weile, mit den Hacken die umgelegten Grasoden auf dem Feld zu zerkleinern. Bald gaben wir auf. Das Ganze glich eher dicken Streifen Filz, dermaßen dicht war das Wurzelwerk. Doch die Kartoffeln mussten in die Erde, der Winter würde lang sein! Also hob einer den Wurzelfilz an, der andere legte die Kartoffel darunter. Wir erwarteten gar nichts. Um so mehr waren wir erfreut, als bald darauf die ersten Triebe aus dem Boden sprossen! Nun gingen wir durch die Reihen und hackten das nachwachsende Gras ab oder deckten es mit Mist zu. Kartoffeln lieben nun mal Dünger. Ob der von unten oder von oben kommt, ist denen egal!
Jetzt konnten wir uns um den Kauf von Tieren kümmern. Wir hatten uns für Kühe und Ziegen entschieden, Tierarten, die wir genügend zu kennen glaubten. Natürlich auch Geflügel, für uns selber und auch später zum Verkaufen. Wir sprachen mit Jean-Paul darüber, vor allem, weil wir wollten, dass sie ihre Tiere nicht mehr auf unser Land trieben, damit das Gras für unsere nachwachsen könnte. Er sagte, dass er Ziegen gehabt hätte, die er aber vor ein paar Wochen an einen Viehhändler verkauft hatte. Gute Tiere, schöne Tiere, von der Pyrenäenrasse. Vielleicht hätte dieser die Tiere noch und wir könnten sie kaufen! „Erschrick nicht, wenn du den siehst. Der ist enorm dick, wohl 200 Kilo, deshalb nennt man ihn Bourguiba, wie den tunesischen Präsidenten!“ Es war gegen Abend, als ich mit ihm hinfuhr. Es saßen mehrere Leute in der Stube um einen langen Tisch herum, der den ganzen Raum einnahm. Die Platte bestand aus einem einzigen Edelholzstück, wohl 12 Zentimeter dick. Wie der wohl von Afrika bis hierhergekommen war? Sie waren alle dabei, einen Aperitif zu trinken, und schon stand auch ein Glas vor jedem von uns.
Nach Jean-Pauls zutreffender Beschreibung kannte ich den Hausherrn gleich aus den anderen heraus. Die Stimmung war ausgelassen. Sie waren sicher nicht mehr bei ihrem ersten Glas oder der ersten Flasche! Ich bewunderte den Tisch. „Wetten, dass du ihn nicht anheben kannst?“, meinte der Hausherr. „Wetten dass doch!“, entgegnete ich, stellte mich rückwärts an die Stirnseite des Tisches, ging leicht in die Knie, und mit den Händen auf dem Rücken hob ich die Platte an, so dass die Gläser wackelten. ‚Bourguiba‘ war beeindruckt und schenkte mir das Glas wieder voll. Dann beauftragte er seine Frau damit, uns die Tiere zu zeigen. Wir schauten sie an. Langes schwarzes, an der Brust und den Beinen leicht helles Fell schmückte die mit stattlichen, gekrümmten Hörnern bewaffneten Tiere. Was verstanden wir schon von Ziegen und deren Rassen? Jean-Paul versicherte, dass sie tragend seien. Gemolken hatte er sie aber nie, er hatte ihnen immer die Jungen gelassen. Als wir ins Haus zurückkamen, schlug uns eine Welle von Heiterkeit entgegen. Bourguiba erklärte gerade, wie sie es im Bett trieben. Genauer gesagt, trieben sie es auf dem Boden, denn kein Bett würde das überstehen! Da er ja zu schwer sei, würde seine Freundin auf ihn klettern. Darum habe er sich auch von seiner Frau getrennt, weil diese den Aufstieg nicht mehr schaffte! Lachen schallte durch den Raum. Jeder stellte sich bestimmt die Szene vor. Beim Anziehen ginge das ähnlich. Auf jeden Fall könnte er sich nicht mehr so weit bücken, um die Hosen in seine Stiefel zu stecken. Er stand auf, nahm einen Besen und steckte mit dem Besenstiel die Hosenbeine in die Stiefel. Grölendes Lachen drang bis hinaus in das kleine Dorf. Seiner Freundin schienen diese detaillierten Schilderungen zu gefallen.
Man versicherte uns, dass dieses die besten Tiere weit und breit seien. Er verkaufte nur beste Tiere! Ansonsten nähme er sie wieder zurück. Noch weniger als von Ziegen verstanden wir von der Gattung Viehhändler. Einmal war mir in Deutschland bei einem Schneetreiben ein solcher mit seinem Mercedes und Anhänger in das Fahrzeug gerutscht. „Bei einer solchen Bagatelle braucht man doch keine Versicherung einschalten, dass regeln wir unter uns!“, schlug er vor. Dieser Meinung war ich auch! Doch da er kein Geld einstecken hatte, gab er mir seine Visitenkarte und sagte mir, am Montag bei ihm vorbei zu kommen. Natürlich war und blieb er unerreichbar und sein Geld auch.
Hier jedenfalls schienen die Viehhändler eine unbeschwerte Lebensweise dem Geschäft vorzuziehen. Jean-Paul hatte mir zuvor zugeflüstert, wieviel ich höchstens zahlen solle. Und nach kurzem Verhandeln waren wir uns einig. Währenddessen hatte Yvonne, die Freundin des ‚Maquignons‘, wie hier diese Händler genannt werden, angefangen, Teller auf den Tisch zu stellen. Und alle die, welche aufbrechen wollten, wurden genötigt zu bleiben. Auch wir. Spät in der Nacht kam ich zurück zum Haus, wo alle schon schliefen. Die Tiere holte ich tags darauf ab.
Die Ziegen hatten wir also. Wir pflockten sie mit langen Ketten draußen an. So konnten sie keinen Unsinn machen und würden außerdem alles gründlich abfressen und das Gelände saubermachen! Manchmal, wenn wir sie abends holten um sie einzusperren, hatten sie ihre Kette dermaßen um einen Brombeerbusch oder Baum gewickelt, dass sie in Atemnot waren! Liefen die immer nur in dieselbe Richtung, wie das Wasser in der Badewanne, wenn man den Stöpsel rauszog? Das wäre ein Thema für eine Doktorarbeit! Auf dem Viehmarkt in Saint Girons, der jeden zweiten und vierten Montag stattfand, kauften wir ein paar Legehühner für unsere zukünftigen Eier, Perlhühner, weil sie so schön aussahen und zwei junge Gänse als Wächter. Denn diese hatten damals Rom gerettet und würden uns wohl in Zukunft Jean-Pauls Besuche melden! Es fehlte nur noch eine Kuh!
Wieder war es unser klettengleicher Milchlieferant, der Rat wusste. Zwei Dörfer unterhalb von Bourguiba betrieb ein anderer Maquignon dasselbe Geschäft. Viehhändler waren anscheinend keine Mangelware, wie man an der schwarzen Kleidung und den schwarzen Mänteln auf dem Viehmarkt feststellen konnte. Man kam sich dort vor wie auf dem Petersplatz in Rom! Dieser Händler hatte ein Holzbein, wie Jean-Paul uns erklärt hatte. Dieses hinderte ihn zwar am Laufen, nicht aber am Autofahren. Wie er sagte, hatte er die Kuh die wir brauchten! Klein, jung, und daran gewöhnt, an der Leine geführt zu werden wie ein Hund, oder angepflockt zu sein. Das klang schon mal gut. Außerdem hatte sie gerade erst ein weibliches Kälbchen geboren. Als wir sie sahen, und sie uns mit ihren langwimperigen Augen anschauten, gaben wir dem Händler recht. Es war unsere Kuh! Blieb nur noch der Preis. Jean-Paul hatte mir zuvor in einem unbeobachteten Moment eine Zahl zugeflüstert. Kannte der sich wirklich so mit Tieren aus, oder hatte er schon zuvor mit dem Maquignon einen Preis ausgemacht und ein Trinkgeld für sich selber? Denn bestimmt würde er auch etwas abbekommen! Nach einer halben Stunde Handeln, wobei die Kuh immer mehr gute Eigenschaften bekam, die eigentlich einen höheren Preis gerechtfertigt haben würden, wurden wir uns einig. Sogleich luden wir die Kuh und ihr Kleines in den Lieferwagen und der Händler fuhr hinter uns her bis unterhalb von unserem Hof an das steile Stück. Wir zahlten die Tiere, der Maquignon gab uns den Pass des Tieres, und wir führten sie zu uns hoch. Das dauerte natürlich eine gute Weile, weil die Kuh immer wieder leckeres Gras am Wegrand fand oder auf ihr Kälbchen warten musste, das eine Blume oder einen Schmetterling angeschaut hatte.
Oberhalb des Hauses befand sich inmitten einer Wiese ein großes Gehege aus Gitterzaun, welches dem früheren Besitzer wohl zum Einsperren seiner Schafe über Nacht gedient hatte. Darin stand das Gras höher als außerhalb, sicher wegen dem guten Dünger. Dahinein sperrten wir die Kuh, das Kleine ließen wir im Stall, damit wir etwas Milch für uns hätten. Wir molken sie zweimal am Tag, nahmen unsere Milch und gaben den Rest dem Kälbchen in einer Flasche, damit es später, wenn wir es raus ließen, nicht weiterhin an der Mutter saugen würde! Anfangs sperrten wir die Kuh nachts ein. Die Nächte waren noch kalt und das Wetter oft schlecht. Auf einer Seite des Stalles hing eine Raufe. Es fehlten manche Stäbe, die ich durch Haselstecken ersetzte. Und das uralte Heu vom Dachboden schmeckte unserer ‚Marie‘, wie wir sie getauft hatten, vorzüglich, wenn sie mal nicht rauskam.
Zugleich ging die Arbeit am Haus weiter. Zum Glück war nicht alles, was ich anfangs als dringend angesehen hatte, wirklich so dringend! Denn das Gebäude hatte schon Jahrhunderte überstanden und würde wohl nicht in den nächsten vierzehn Tagen einfallen. Sogar ein weiteres Erdbeben hatte es überstanden! Wir schliefen, als mich ein Stöhnen der Erde aus dem Schlaf riss. Ich weckte alle und drängte sie, schnell in den Hof zu gehen. Nur Doris war so müde, dass sie meinte, „sag mir Bescheid, wenn alles vorbei ist!“ Doch auf unser aller Drängen ging sie dann doch hinaus.
Was sich aber wirklich als dringend notwendig erwies, waren Zäune. Denn unsere Marie hatte nach zwei Tagen den Pferch leer gefressen. Da drinnen nichts mehr zum Rupfen blieb, hatte sie einfach den Kopf über das Gitter gestreckt und weitergefressen. Dabei hatte sie den morschen Zaun, fast ohne es zu merken, zu Boden geklappt und war drübergestiegen. Jetzt lief sie dorthin, wo das saftigste Grün wuchs. Aber das waren die Wiesen, wo wir später Heu machen wollten. Wir pflockten sie ein paar Tage lang an. Nur frisst eine Kuh viel mehr als eine Ziege. Außerdem braucht sie Wasser zum Trinken. Es musste ein Elektrozaun her! Also ab in die Stadt, zur Genossenschaft, und mal sehen, was die haben! Es gab welche mit Batterie. Diese, einmal leer, wird weggeworfen. Nichts für uns! Es gab noch alte Modelle, die mit einer Autobatterie betrieben wurden, mit einem Kondensator drinnen und einer hin-und herdrehenden Metallscheibe, die den Rhythmus der Stromimpulse regelte. Sowas gab es in meiner Kindheit schon. Also hatte sich das Gerät bewährt! Da wir keinen Strom am Haus hatten, konnten wir die Batterie im Auto laden. Zusätzlich kauften wir einige Rollen verzinkten Draht und zäunten ein großes Stück Wiese ein. Anfangs war die Kuh zufrieden.
Es wuchs aber nicht nur Gras bei uns. Und außerdem war das irgendeine Art von Wildgras, ziemlich dünn und mit wenig Blättern, welches sich hier mangels Düngung und Nutzung breitgemacht hatte. Von wegen, das Land eine Weile brachliegen lassen, damit es sich regenerieren kann! Hier jedenfalls war das Gegenteil eingetreten und die Wiesen waren degeneriert! Und überall schoben sich so hasenpfotenähnliche Triebe aus der Erde, viel schneller als das Gras! Einmal den harten Boden hinter sich gelassen, entrollten die sich zu zartgrünen Blättchen und schossen auf einem fingerdicken Stängel in den Himmel. Farn! Wo möglich, wenn er sich auf unserem Weg fand, zertraten wir ihn oder köpften ihn mit unserem Stock. Anfangs ging das einfach, war es doch nur grüne Masse mit viel Wasser darinnen. Später wurden die Pflanzen faseriger und man brauchte eine Sense oder den Motormäher, um sie zu killen. Und killen mussten wir sie, denn bald würden sie alles Gras unter ihren Wedeln ersticken und ihm das Licht rauben! In dem Masse, wie der Farn unsere Wiesen in Besitz nahm, wurde uns klar, dass hier ein langjähriger Kampf bevorstand. Entweder er oder wir! Und ich war mir sicher, dass wir hierblieben. Also musste er gehen! Ich rechnete so mit drei Jahren, dann würden hier wieder saftige Weiden wachsen! „Du musst ihn im Winter, wenn er vertrocknet ist, anzünden. Dann bist du ihn los!“, meinte Jean-Paul. „Und für wie lange?“, wollte ich wissen. „Eh be, bis zum nächsten Frühjahr!“, gab er zurück. „Dazu brauche ich ihn nicht anzünden. Ich muss ihn im Sommer loswerden!“ Ein hellgrüner Hauch lag über unseren Hängen. Von weitem sah das sogar schön aus. Nur wenn man bis zu den Knien da drinnen stand, wurde einem klar, dass hier sofort gehandelt werden musste und ich baute den Messerbalken an den Mäher. Mindestens zwei Mal während der Wachstumsperiode mähen, das würde ihm ‚guttun‘!
Unser Land befand sich auf zwei verschiedenen Katasterplänen. Diese hatte ich mit der Schere so ausgeschnitten, dass die Parzellen aneinanderpassten und mit Kleber zu einer Karte zusammengefügt. Alles, was außerhalb von uns lag, schnitt ich weitgehend weg. Mit diesem Plan und einem Topf Farbe machte ich mich an einem Morgen daran, unsere Grenzen abzuschreiten. Daraus wurde eher ein Klettern mit Hindernissen! Nicht nur, dass es steil bergauf und später bergab ging, versperrten allerlei Bäumchen oder Gestrüpp mein Vorschreiten. Ich sah, dass das Land hauptsächlich von außen her von der Vegetation eingenommen worden war, und die steilsten Parzellen zuerst! Es schien, als ob diese als erste nicht mehr genutzt worden waren. Meist bildeten Hecken oder auf Heckenhöhe gestutzte Bäume die Grenze zu anderen Grundstücken. Diese, da niemand mehr da war, um sie zu kürzen, waren in die Höhe geschossen und auch in die Breite. Von dort ausgehend hatten sie sich dann ausgesät und so nach und nach die Parzellen erobert. Zugleich hatten, wohl durch Vögel vertragen, sich Brombeeren inmitten der Wiesen ausgesät und riesige Sträucher gebildet. Zugleich muss auch der Farn sich, ebenfalls von außen kommend, auf dem Land ausgebreitet haben. Jedenfalls wuchs er oft in Parzellenmitte etwas spärlicher. Auch waren fast alle Böschungen von Brombeeren besiedelt. Mit der Farbe malte ich Zeichen auf dicke Stämme, auf Steine, die, wie ich erkannte, bisweilen an Kreuzpunkten von Parzellengrenzen eingegraben waren. Doch bisweilen war der Bewuchs so dicht oder die Parzellen so klein, dass es mir nicht möglich war, mit Sicherheit unsere zu erkennen. Also erst mal saubermachen und dann eventuell mit einem langen Metermaß erneut versuchen, die Grenzen zu finden!
Bei dieser Expedition fand ich einen Elektrodraht, meist im Gestrüpp eingewachsen oder auf dem Boden, weil das Wachsen der Bäume den Befestigungsdraht der Isolatoren gesprengt hatte. Es muss also noch jemand anderes unser Land benutzt haben! Jean-Paul wusste wer. Es war jemand aus dem Dorf, der als Fernfahrer unterwegs war und hier, da er selber wenig Land hatte, seine Kühe hingetrieben hatte, weil der Eigentümer, der auf die Rente zuging, selten mehr hierherkam. Diesem also hatten wir mit unserem Kauf ‚sein‘ Land ‚gestohlen‘! Das hatte ihm, wie er mich merken ließ, als ich ihn mal ansprach, nicht gerade gefallen! Den Zaun bräuchte er noch, da dürfe ich nicht dran. Oder doch, wenn ich ihn ihm abkaufen würde! Er nannte eine astronomische Summe. Ich dachte anfangs, er rede in alten Francs, wie das so üblich war. „Der spinnt wohl!“, sagte ich mir, „vielleicht will er auch von unseren Deutschen Mark profitieren!“ Da soll er ihn sich lieber abbauen! Ich zäunte nun mit neuem Draht unsere Wiesen ein, in dem Maß, wie wir sie für die Kühe brauchten.
Denn inzwischen hatten wir eine weitere Kuh und ein zweites Kälbchen erworben. Oma hatte etwas Geld geschickt und eine ‚Patenschaft‘ übernommen. Zweimal täglich molken Doris und ich diese. Meist waren die Kinder dabei und freuten sich, wenn sie Kälbchen spielen durften und wir ihnen ein paar Strahlen in den Mund molken. Einen Teil der Milch nahmen wir für uns, machten Quark, rührten unsere Müeslis damit an. Den Rest bekamen die Kälber. Die Milch der Ziegen wurde von deren Jungen gesaugt. Irgendwann im Sommer tauchte jemand aus dem Nachbardorf auf und wollte sie uns abkaufen. Er hatte selber auch Ziegen und verkaufte die Zicklein geschlachtet an Städter, die eine Zweitwohnung im Dorf hatten. Er selber hatte nicht genügend Tiere. Sein Preis war korrekt und deshalb überließen wir ihm die Männchen. Die weiblichen Tiere behielten wir, um die Herde aufzustocken.
Eines Morgens fand ich Federn von unseren Perlhühnern hinterm Haus. Kamen unsere Hühner regelmäßig in den Stall zum Legen und zum Übernachten, so hatten die Perlhühner die dumme Angewohnheit angenommen, unter freiem Himmel zu übernachten. Wie ich später an ihren Nestern sah, im Schlehdorngestrüpp oberhalb unseres Hauses. Das hatte der Fuchs ausgenutzt. Unterhalb von uns, auf halbem Weg zum Dorf, hatte ein Toulouser eine kleine Ferienhütte am Bach. Er war Jäger und Angler und handelte auch mit Gewehren. Als er vom Missgeschick unserer Perlhühner hörte, bot er mir als Lösung ein doppelläufiges Jagdgewehr an und verschiedene Patronen. Schrot für den Fuchs, große Kugeln für die Wildschweine. Doch zuerst musste ein freies Schussfeld geschaffen werden! Mit Hackmesser und Motorsäge ging ich dem Dickicht zu Leibe. Mit wenig Erfolg, denn ich kam nicht nahe genug an die Stämmchen des Gestrüpps heran und hatte bald überall Dornen in der Haut. Als ich diese rauziehen wollte, brachen deren Spitzen ab. Ich versuchte, diese mit der Nadel heraus zu pulen. Manche saßen so tief, dass sie erst nach Wochen rausgeeitert warten. Ich musste anders vorgehen! Seit kurzem wurden ‚Motorsensen‘ oder ‚Freischneider‘ auf dem Viehmarkt von den Händlern angeboten. Ich hatte so ein Ding mal bei der Arbeit gesehen und war überzeugt, dass es das ideale Gerät für unseren Hof wäre. Ich wählte ein Gerät, das auch zur Motorsäge umgebaut werden konnte. Als Messer unten dran wählte ich eine dreieckige Klinge hauptsächlich für die Brombeeren, und ein Kreissägeblatt, mit dem ich die Schwarzdorne problemlos in Bodenhöhe absägen konnte. Langsam schrumpfte das Dickicht unter dem Singen der Säge zusammen und ich fand sogar die Nester der verspeisten Perlhühner! Die Stämmchen warf ich mit der Mistgabel, um nicht noch mehr Dornen abzubekommen, auf einen immer grösser werdenden Haufen. Da das Zeug nicht brennen wollte, ließen wir alles erst mal trocknen und verschoben das Anzünden auf Johanni. Es tauchten sogar zwei überlebende Perlhühner wieder auf. Hatten diese inzwischen gelernt, auf Ästen zu übernachten? Es waren also nur die brütenden verschleppt worden! Mir gelang es mehrmals, sie nachts zu fangen und in den Hühnerstall zu sperren. Doch zogen sie das Schlafen unter freiem Himmel vor. Wie ich auch, wenn sich die Gelegenheit bot. Nichts Ergreifenderes, als nachts unter dem Glitzern der Unendlichkeit aufzuwachen!
Was wir außerdem dringend brauchten, war ein Hund! Als Wachhund fürs Haus, um uns rechtzeitig Jean-Paul zu melden, gegen den Fuchs, als Hütehund. Wenn ich manchmal einen Hund mit der Herde arbeiten sah, wurde ich richtig neidisch! Bisweilen kam der Vater oder die Mutter Jean-Pauls zu uns hoch. Irgendwie war immer einer aus dem Clan in der Gegend. Natürlich hatten sie manchmal Tiere in der Nähe. Mir kam es vor, als dienten diese nur als Alibi. Wir waren der wahre Grund ihres Hierseins! Sie saßen irgendwo und beobachteten uns, manchmal mit dem Fernglas. Oft waren es ihre Hunde, die ihren Beobachtungsort verrieten, weil sie umherliefen. In mehreren Episoden erzählten die Eltern uns Jean-Pauls Leben. Er sei nicht richtig im Kopf. Man hatte ihn früh von den Eltern weggenommen und bei einer Tante untergebracht. Er war nie zur Schule gegangen und hatte mehrere Jahre in einer psychiatrischen Anstalt verbracht. Sie hatten erreicht, dass er für unmündig erklärt wurde und deshalb eine Rente bekam. „Wenn wir mal nicht mehr sind, braucht er nicht mehr zu arbeiten…“ Er durfte keinen Alkohol trinken, weil er Medikamente nahm. Das erklärte auch, warum man ihn so wenig im Wirtshaus sah. Sicher hatte der Wirt dementsprechende Anweisungen! Bevor wir das alles erfahren hatten, war er uns gar nicht so sehr wie der ‚Dorfdepp‘ vorgekommen. Man sah ihm zwar irgendwie an, dass er nicht der Hellste war, doch was seine Tierkenntnisse anbetraf war er unschlagbar! Außerdem merkten wir bald, dass er eine Menge ‚Bauernschläue‘ besaß, eine gewisse Hinterlistigkeit, dass er seinen Ruf, der Dorftrottel zu sein, zu seinem Vorteil ausnutzte!
Jedenfalls war er es, der gehört hatte, dass in einem Tal in Richtung Spanien jemand einen jungen Hund zu vergeben hatte. Wollte er nur einen Ausflug machen? Denn er meinte, er hätte Zeit und würde mitfahren. Also fuhren wir zwei los. Zuerst über den Pass von Portet d’Aspet, dann, fast unten, bogen wir nach Süden ab und ein anderes Tal in Serpentinen hoch. Wir sahen, dass oberhalb eine Skistation im Bau war. ‚Le Mourtis‘ stand auf den Schildern. Kurz zuvor bogen wir in ein kleineres Tal ein, die Straße verwandelte sich in einen ausgewaschenen Kiesweg und führte durch einen hohen Buchenwald. An der einzigen breiteren Stelle standen ein paar Autos und Autowracks. „Da muss es sein, ich bin schon mal hier gewesen!“, meinte er, und wir stellten das Auto ab. Unterhalb eines Stahlseiles, das als Lastseilbahn diente, stiegen wir einen Zickzack-Pfad hinauf. Wo das Seil endete stand ein etwas hergerichtetes, altes Haus. Hier wohnten ein paar junge Leute. Sie hatten ein knappes Dutzend Schweizer Kühe und machten Käse. Sie hielten auch ein paar Schafe, aber keine Milchschafe, um das Land besser zu nutzen, wie sie sagten. Sie rauchten gerade einen Joint und boten ihn uns ab. Wir lehnten ab. Wir kamen auf die Hunde zu sprechen. Niedliche, tollpatschige Tiere, die uns schon zu Beginn begrüßt hatten und nun an unseren Schuhen knabberten. Wir schauten die Seilbahn an und erzählten von unserem System. Ich sah, dass hinterm Haus das Land flacher wurde. Ihr Hauptproblem war der Zugang zur Straße. Und, dass sie nicht an das Dorfwassernetz angeschlossen waren! Deshalb dürften sie auch offiziell keine Käse verkaufen. „Irgend so eine europäische Regelung, von den Großkonzernen durchgesetzt! Seit Menschengedenken haben Menschen an Quellen getrunken. Jetzt ist das plötzlich verboten! Wahrscheinlich, weil inzwischen anderswo alles so verschmutzt ist, dass man Wasser nicht mehr trinken kann! Das große Geschäft der Zukunft!“, erklärten sie. Doch niemand würde das je kontrollieren. Die Hunde waren uns auf unserer Hofbesichtigung gefolgt. „Such dir einen aus! Das macht schon mal einen weniger!“ Ich suchte ein Männchen aus, wenngleich Jean-Paul meinte, Hündinnen seien besser. Ich gab ihnen 50 Francs, obwohl sie eigentlich nichts haben wollten. Mit dem Hund auf dem Arm machten wir uns an den Abstieg.
Im Auto fragte ich Jean-Paul, was er von dem Hund halte. „Hast du die Pfoten gesehen? Der wird mal groß! Die Eltern sind auf jeden Fall gut! Du hast ja gesehen, wie sie an die Kühe rangegangen sind! Das ist gut, wenn ein junger Hund keine Angst hat. Nur hatte ich einen sagen hören, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass die Mutter des Kleinen schon mal Schafe gerissen hat. Das kann im Blut liegen, also erblich sein, muss aber nicht! Tu ihn auf jeden Fall gut überwachen, dass er nicht zu herb rangeht, vor allem, dass er nie Blut schmeckt!“ „Was soll das heißen?“, wollte ich wissen. „Halt, dass er nie bei der Arbeit ein Tier verletzt, so dass es blutet. Und gib ihm nie rohes Fleisch zu fressen, vor allem nicht von den Tieren, die er hüten soll! Wenn du mal ein Schaf schlachtest, gib ihm nie die Eingeweide zu fressen oder andere Abfallstücke. Grabe sie immer so tief ein, dass der Hund sie nicht riechen kann. Wenn sie einmal verwest sind und er sie dann ausgräbt, ist das egal!“ Nun ja, vorerst war er noch ein unschuldiges Wollknäuel, an dem die Kinder große Freude hatten…
Solange unsere Kühe nachts noch im Stall waren, molken wir sie drinnen. Natürlich waren die Kinder immer dabei oder irgendwo in Sichtweite. Sie versuchten sich ebenfalls an den Eutern. Die Kühe ließen es sich zum Glück gefallen. Dem Großen gelang es bald, ein paar Tropfen, bald sogar einen dünnen Strahl heraus zu quetschen. Zuerst molk er sich in den Mund, besser gesagt, voll ins Gesicht. Lachend wischte er sich trocken. Das brachte ihn auf den Gedanken, sein Schwesterchen anzuspritzen, die daraufhin heulend davonrannte.
Einmal behandelten wir die Ziegen mit der Rückenspritze gegen die Krätze. Sie verloren Fell und wir hatten den Tierarzt gefragt, was zu tun sei. Er hatte uns ein Mittel gegeben, was auf Thymianbasis war. Jedenfalls roch es nicht unangenehm. Trotzdem wollten wir nicht die Kinder in der Nähe haben und sagten ihnen, sie sollen vor dem Haus spielen. Doris hielt die Tiere fest, während ich ihnen das Mittel aufsprühte. Als wir nach einer halben Stunde damit fertig waren und vors Haus gingen, spielte nur noch Emanuel dort im Sand. Er wusste nicht, wo sein Schwesterchen war. Wir bekamen einen schönen Schreck! Wo sollten wir sie suchen? Da kam Jean-Paul außer Atem den Hang hochgekeucht. „Eure Kleine ist alleine unten an der Bachbrücke. Ich habe sie mit der Mobylette hochnehmen wollen, aber sie hat sich geweigert!“ Wir sagten ihm, er solle bei dem Buben bleiben, rannten den Hang hinunter und rasten mit dem Bus ins Tal. Da stand sie nicht weit vom Bach und schien nicht mehr zu wissen wo sie war. Als sie das Auto sah, drehte sie sich vom Bach weg und lief uns entgegen. Wir sprangen hinaus und sie rannte geradewegs in unsere Arme!
Ein paar Meter vor dem Stall pickelte ich die Böschung weg, goss eine armierte Platte und baute aus Hohlblocksteinen ein 2,5 x 3,5 Meter großes Becken, so 1,5 Meter tief, welches ich mit Bitumen für Fundamente ausstrich. Dieses konnte abwechselnd als Jauchengrube für die Kühe dienen, oder als Wasserspeicherbecken für die zukünftige Turbine. Diese Grube bedeckten wir mit einer Lage Balken und schichteten den Kuhmist darauf. Die Jauche lief durch eine Rinne quer über den Hof in das Becken hinein. Sofort machten sich die Hühner daran, alles zu verteilen. Sollten wir die Hühner einsperren? Wir zäunten lieber den Misthaufen ein, denn wir wollten, dass die Hühner überall hinkämen, wegen der Schlangen. Sahen sie eine, ein kurzes Zucken mit dem Hals, und schon befand sich diese im Schnabel. Gleich darauf fielen zwei Hälften zu Boden, von denen jede sofort von den anderen herbeieilenden Hühnern wiederum in zwei Teile gestückelt wurde. Das Finderhuhn hatte Mühe, auch einen Teil der Beute abzubekommen! Selbst wenn das Kopfstück der Schlange versuchte, das Huhn zu beißen, so scheiterte der verzweifelte Versuch am Federkleid des Huhnes, welches wie eine Ritterrüstung wirkte. Leider war die Mehrzahl der Reptilien, die so in Eier verwandelt wurden, kupferfarbene Blindschleichen, selten Vipern. Manchmal überraschten wir im Garten oder im Gelände bis zu 1,5 Meter lange grüne Schlangen, doch waren diese nach Jean-Pauls Aussagen ungefährlich.
Um die Hühner etwas aus dem Hof fern zu halten, um nicht dauern Kacke an den Schuhen zu haben, erwies sich unser neuer Hund, den wir Frodo getauft hatten, als nützlich. Er zeigte, dass er den Hüteinstinkt geerbt hatte und beschäftigte sich mit den Hühnern, indem er sie vor sich hertrieb. Doch als wir ihn dann mal dabei überraschten, dass er seelenruhig mit seinen Milchzähnen ein totes Huhn knabberte, mussten wir erzieherisch eingreifen. Jean-Paul hatte das auch mitbekommen und riet uns, Hund und Huhn sofort in einen Kartoffelsack zu stecken und den Sack gehörig mit einem Stock zu behandeln und dabei dauernd das Wort ‚Non‘, also ‚Nein‘ zu rufen. Das würde den Hund ein für alle Mal korrigieren! Und so machten wir es, unter Ausschluss der Kinder natürlich. Uns tat der Hund leid. Aber wir mussten es machen, jetzt sofort, sonst wäre es für immer zu spät! Als wir dann Hund und Huhn aus dem Sack befreiten und das Huhn neben ihn legten, drehte er den Kopf weg. Wir ließen das Huhn im Hof liegen, versteckten uns und beobachteten den Hund. Der ignorierte das tote Huhn und machte einen Bogen darum. Am Abend gruben wir es dann ein. Hatte unsere orthodoxe Erziehungsmethode also gewirkt?
Für die Viehhändler der Umgebung schienen wir das gefundene Fressen zu sein. In fast jedem Dorf gab es einen, meist war das zugleich ein Bauer. Für die Märkte und ihre Transaktionen zogen sie sich einen schwarzen Mantel an und glichen eher einem Bestattungsunternehmer. Sie waren jovial, luden zu einem Glas ein und sprachen mehr nebenbei von ihren Tieren. Dadurch, dass wir die Preise nicht kannten, noch das Alter eines Tieres zu bestimmen wussten, dachten sie, es leicht mit uns zu haben. Vielleicht war es unser unterbewusstes Misstrauen, welches sie glauben ließ, wir würden mehr von Tieren verstehen! Ziegen und Schafe hatten grundsätzlich keine Papiere oder offizielle Ohrenmarken. Kühe hatten ein Begleitpapier und eine metallene Ohrenmarke mit einer Nummer, später eine Tätowierung in einem, dann in beiden Ohren, die mit der im Begleitpapier übereinstimmen musste. Darin konnte man zumindest das Alter des Tieres erkennen. Doch war auch da Schummeln möglich, da man für eine Kuh, die keine Papiere hatte, welche anfertigen lassen konnte. Darin konnte man z.B. ein anderes Geburtsdatum angeben. Bei Pferden verhielt es sich ähnlich. Zum Glück war Jean-Paul oder sein Vater Elie oft dabei, wenn wir Tiere anschauten. Sie flüsterten uns zu, welcher Preis korrekt war oder ob ein Tier Fehler besaß. Denn eines war uns klar: Ein gutes Tier behält man und verkauft es nicht!
Einer dieser ‚Maquignons‘ war Maurice aus dem Dorf unterhalb, an die 60 Jahre alt. Er hatte mit Bergbauernzuschüssen zwei große Hallen bauen lassen, worin er wohl 400 Schafe unterbrachte. Er brauchte für eine solche Anzahl einen Knecht, Claude, der eigentlich alles machte, außer Traktor fahren. Es wurde erzählt, dass Claude, als er jünger war, die Polizistenlaufbahn eingeschlagen hatte, um aus dem ländlichen Elend herauszukommen. Er schaffte es bis nach Paris, wo er als Verkehrspolizist eingesetzt wurde. Er trank damals schon gerne und liebte die Geselligkeit. Eines Tages wurde er zu seinem Chef vorgeladen, der ihm vorwarf, keine Strafanzeigen zu schreiben. Von irgendwas müsse die Polizei ja leben. Das müsse sich ändern! Er müsste rigoroser durchgreifen, sich nicht auf Diskussionen einlassen! Das war verständlich genug ausgedrückt, er nahm es sich zu Herzen.
Als er wieder den Verkehr regelte raste eine schwarze Limousine über die Kreuzung, ohne sich an seine Weisungen zu halten, und hielt auch bei seinem Pfeifen nicht an. Er notierte sich die Nummer und erstattete Anzeige. Nach ein paar Tagen wurde er erneut in das Büro seines Chefs gerufen. Erfreut, in der Erwartung eines Lobes, trat er ein. Doch sein Chef war wütend. Es war der deutsche Botschafter, den er da angezeigt hatte. Er solle sofort seine Anzeige zurückziehen! Doch er weigerte sich, nach dem Grundsatz: ‚Vor dem Gesetz sind alle gleich!‘. Warum sollte der deutsche Botschafter Sonderrechte haben? Das trug mit dazu bei, dass seiner Laufbahn als Gendarm ein Ende gesetzt wurde. Bald schon war er zurück in seinem heimatlichen Tal und half bei den Nachbarn aus, wobei es dann auch blieb. „Paris? Kannste vergessen! Nirgendwo ist es schöner als hier im ‚schönen langen Tal!‘“
Der Viehhändler, der uns die erste Kuh verkauft hatte, ließ uns durch Jean-Paul mitteilen, dass er das ideale Pferd für uns hätte. Jung, abgerichtet und zudem hochträchtig. ‚Calina‘, die Anhängliche, war ihr Name. Wir fuhren am Abend hin um sie anzuschauen. Denn ein Trage-und Zugtier brauchten wir, um nicht immer den Motormäher umbauen zu müssen! Sie war braun, von mittlerer Größe, nicht sehr breit. Doch stark genug und vor allem brav, was wichtig war wegen der Kinder. Dressiert war übertrieben. Doch machte sie diesen Mangel wett durch ihr ruhiges Wesen und ihre Gelehrsamkeit. Nie scheute sie und schien richtig bemüht, einem alles recht zu machen! Elie schenkte uns ein ‚Kummet‘, das Halsgeschirr zum Ziehen und einen ‚Zugbalken‘. Ich kaufte auf dem Viehmarkt Ketten und wir machten die ersten Transportversuche. Alles verlief bestens. Vielleicht kam mir dabei auch die Erfahrung als Kind bei den Nachbarn zugute, wo alle schweren Arbeiten noch mit dem Pferd gemacht worden waren. Bald darauf brachte sie ihr Junges zur Welt, ein Hengstfohlen, das wir Claudius nannten.
War ich mehr im Gelände und mit den Tieren beschäftigt, so war Doris mit den Kindern und im Garten zugange. Hier war etwas mehr Erde als auf dem Feld, bestimmt, weil er auch in der Vergangenheit mehr Dünger abbekommen hatte, da er unterhalb des Stalles lag. Auch hatten wir den riesigen Altholzhaufen abgefackelt, um Anbaufläche zu haben. Uns war gar nicht wohl zumute, als die Flammen plötzlich mehrere Meter hoch in den Himmel züngelten, nur wenige Meter von unserem Haus entfernt! Das trockene Holz brannte wie Zunder! Wir hatten ein paar Eimer Wasser bereit, und das Gartenschläuchle. Zum Glück war unser Angstschweiß das einzige Wasser, das wir vergossen! Hier ließ sich der Boden gut umgraben und bald aßen wir die ersten Radieschen und den ersten eigenen Salat. Außerdem sammelten wir in den Wiesen Löwenzahnblätter und Ampfer und Marcelle, die Mutter von Jean-Paul, zeigte uns den wilden Knoblauch und wilden Spargel, die vielerorts wuchsen, von dem wir die Stängel in den Salat schnitten.
Rundum erstrahlten bald an den noch kahlen, grauen Waldhängen die ersten weißen Blütenfackeln der wilden Kirschbäume. Es folgte die Schlehen- und die Pflaumenblüte und bald schimmerte hier und da ein Hauch von zartem Grün, die Birken. Als hätten die anderen Bäume nur darauf gewartet, entfalteten auch sie langsam ihre Blätter und nach einer Woche leuchteten die Talränder in allen möglichen Grünschattierungen. Die Zugvögel waren zurück und weckten uns schon beim ersten Dämmern. Wir öffneten die Fenster um ihnen zu lauschen. Ihr Gesang kam uns hier viel intensiver vor. Bald schon rief der erste Kuckuck, während das Grün immer weiter die Hänge hochstieg. Nur an einzelnen Stellen der Nordhänge lagen noch letzte Schneereste. Der Frühling war endlich da!
Das Gras hatte, wohl bedingt durch die Wärme, auch angefangen zu wachsen, und unsere Kühe und Ziegen hatten grüne Hörner, weil sie die Halme unter dem schon stattlichen Farn suchen mussten. Die lange Brache hatte dem Boden nicht gutgetan. Es schien, als sei der Boden tot. Die einzigen Regenwürmer, Zeichen der Bodenfruchtbarkeit, befanden sich in unserem Misthaufen! Sprachen die Leute im Tal davon, dass ihre Tiere schon den Drang hatten, nach oben auf die Sommerweiden zu steigen, so hatten unsere Tiere den Drang, hinunterzugehen, weil es weiter unten viel grüner war! Auch ließen Jean-Paul und seine Eltern in unbewachten Momenten immer noch ihre Tiere auf unser Land. „Bald kommen die auf die Almen. Und dann geht es ans Heumachen. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns helfen und wir geben euch die Hälfte vom Heu für den Winter!“ Das klang jedenfalls gut. Mal sehen, wie es in Wirklichkeit aussehen würde…
Der Farn stand dort, wo ich nicht gemäht hatte, inzwischen einen Meter hoch und hinderte das spärliche Gras am Wachsen. Ich wollte den großen Hang überm Haus in Angriff nehmen. Das war eine Fläche von rund fünf Hektar, mit hier und da riesigen Brombeergebüschen darin und einzelnen Bäumchen, die sich ausgesät hatten. Der Motormäher, ein Schweizer Fabrikat, besaß eine starre Achse, also ohne Differenzial. Er hatte einen 4-Takt Motor, stank also weniger und verbrauchte weniger als zwei Liter in der Stunde. Es dauerte nicht lange und ich hatte den Dreh raus, wie man wendete. An den steilen Hängen war dieses umso einfacher, da das Talrad am meisten belastet war. Durch Niederdrücken der Handholme hob ich das Mähwerk an und wendete schnell um das Talrad, während das Bergrad durchdrehte. In diesem Augenblick war der Mäher fast schwerelos, war im Gleichgewicht, auf nur einem Rad. Doch musste ich vorsichtig vorgehen, um nicht umzuschmeißen. Und das geschah! Plötzlich lag er auf dem Rücken wie eine riesige rote Schildkröte. Ich machte sofort den Motor aus, den Benzinhahn zu. Doch lief trotzdem Benzin aus und verzischte auf dem Auspuff. Ich holte Doris und zusammen schafften wir es, ihn wieder umzudrehen. Nur die Zündkerze war abgebrochen, aber im Werkzeugkasten befand sich ein Ersatz. Darum bestellte ich bald einen Spurverbreiterungssatz einschließlich Grasabweisern beim Landmaschinen-Händler in St. Girons.
Ich hatte die Kufen des Mähbalkens, die zur Höhenregelung dienten, erhöht, um so möglichst wenig Gras zu mähen, sondern hauptsächlich den Farn. Zuerst mähte ich, wenn es ging und es nicht zu steil war, eine oder zwei Bahnen um das Wiesenstück herum. Dann war es einfacher zu wenden und die neue Bahn in Angriff zu nehmen. Die Mähbreite war 1,50 Meter. Mehr wäre nicht praktisch gewesen, in diesem unebenen Gelände! Die Brombeerboschen mähte ich seitlich mit der halben Messerbreite an. Kleinere waren dann schnell abgeschnitten und rollten manchmal als Kugel den Hang hinunter. In die größeren fuhr ich vorwärts hinein, um möglichst tief drinnen abzuschneiden, mit dem Ergebnis, dass sie sich oft am Messerbalken verhängten oder um die Räder wickelten. Dann musste mein Opinel-Taschenmesser herhalten, um das Gerät wieder fahrfähig zu machen. Auch die kleinen Bäumchen fielen dem klappernden Mähbalken zum Opfer. Natürlich brachen dabei öfters eine dreieckige Messerklingen ab. Ich hatte immer drei scharfe Messer bereit. War eines stumpf oder beschädigt, kam ein anderes rein. Das Wechseln ging eigentlich verhältnismäßig schnell: Vorne etwas aufbocken, die Klinge seitlich so verschieben, dass man die zwei mit Muttern versehenen Bolzen in Klingenmitte nach unten entfernen konnte, Grasabweiserstab mitsamt Befestigungsschuh abnehmen, Klinge seitlich rausziehen. Möglichst etwas Fett auf die Gleitflächen und das neue Messer, alles reinschieben und zusammenschrauben. Nun noch ein paar Stöße Fett mit der Presse aus dem Werkzeugkasten in den Antriebsmechanismus und weiter!
Das Erneuern der abgebrochenen Klingen machte ich in der Werkstatt, die ich in einem hölzernen Anbau eingerichtet hatte: Die Messereinheit, bestehend aus den vielen, auf eine Metallschiene genieteten Dreiecksmessern, auf den leicht geöffneten Schraubstock legen und zwar so, dass die defekte Klinge im Schlitz der leicht geöffneten Backen steckt und die Metallschiene auf den Backen aufliegt. Mit einem oder zwei trockenen Hammerschlägen auf die hintere Klingenkante zerschneidet diese die Nieten und man kann sie entfernen und auswechseln. Wegen der an verschiedenen Stellen angebrachten Gleitplättchen sind zwei verschiedene Nietenlängen erforderlich. Zum Verschlagen der Nieten die Klinge auf den zugedrehten Schraubstock legen, besser noch, man hat ein Stück alte Eisenbahnschiene vom Schrottplatz, die als Amboss dient. Auch sollte man, vor allem, wenn man einen Baumstumpf berührt hat, die Balkenfinger verbogen sind oder die Klinge schwer läuft, mit einem Hammer diese Finger wieder ausrichten oder wechseln. Dazu das Messer entfernen und mit einem Auge durch den ‚Messerkanal‘ peilen.