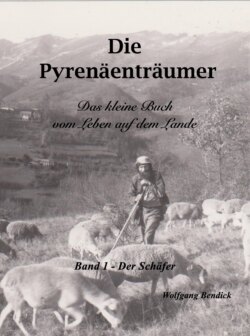Читать книгу Die Pyrenäenträumer - Der Schäfer - Wolfgang Bendick - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SOMMER
ОглавлениеAls der ganze obere Hang gemäht war, machten wir uns an das Zusammenrechen des Farns zu Schwaden, also Reihen. Unseren Kindern hatte ich aus Haselstecken einfache Rechen und Gabeln gebaut und sie halfen uns dabei. Auch unser Hund. Doch der verteilte eher Erde anstatt Farn zu sammeln, wenn er mal ein Mauseloch gefunden hatte. Es gab also doch noch Bodenleben! Wir wollten später den Farn in die Scheune schaffen, als Streu für den Winter. Doch wurden wir damit nicht fertig, denn Elie kam den Berg hochgestapft, und fragte, ob wir nicht lieber sein Gras mähen würden anstatt des Farns, den eh kein Viech frisst! Sein Motormäher sei außerdem kaputt, und er sei herzkrank und dürfe nicht arbeiten. Da er meinte, er würde uns dafür fünf Tonnen Heu geben, ließen wir alles liegen, luden den Motormäher auf den Hänger und fuhren mit ihm ins Tal.
Da unten war die Vegetation schon weiter fortgeschritten und das Gras stand dicht und über kniehoch. Meist waren das kleine Parzellen, wo Elie mit seinem rieseigen AVTO-Traktor nicht fahren konnte. Er fuhr, einmal das Heu trocken, mit dem Traktor die Bindemaschine her und wir schoben die Heuschwaden als große Haufen zur Presse oder trugen sie auf der Heugabel hin. Oft war das flaches Gelände. Meist Wiesen, die jemand anderem gehörten, wie ich erfuhr. Manchmal waren Bäume in den Wiesen gepflanzt, meist Pappeln, und das Gelände musste sauber gehalten werden, bis die Bäume groß genug waren. Diese störten erheblich beim Mähen und Trocknen. Oft kam der Eigentümer und wackelte an den Bäumchen, um zu sehen, ob ich keinen angemäht hatte. Das kam natürlich vor, denn ich fuhr so nahe es ging ran. Um die Bäumchen herum mähte anschließend noch jemand mit der Sense. Ebenfalls rund um die Wiese, dort, wo der Mäher nicht hinkam, weil das Gelände zu steil war. Was für ein Aufwand! Das Gras stand ziemlich hoch. Ich lief hinter dem Motormäher her, Marcelle schob mit einer Heugabel einen schmalen Streifen gemähten Grases beiseite, damit es mir bei der nächsten Passage nicht die ‚Eckzähne‘ des Messerbalkens verstopfte. Das Gras fiel, weil es zu hoch war, über die Schwadbleche, die es eigentlich zusammenschaffen sollten. Mit der Zeit wurden wir zwei zu einem eingespielten Team. Erst roch es nach frischem Gras. Doch mit jedem Tag, fast jeder Stunde, änderte sich der Geruch, bis es schließlich wunderschön süß nach Heu duftete, ein Duft, der auch meine Kindheit ausgefüllt hatte und den ich, neben dem des Kuhmistes, für den schönsten der Welt halte!
Gewendet wurde, als das Gras leicht angetrocknet war, mit Gabeln von Hand. Es wurde regelrecht umgeschichtet, auf eine Weise, dass die vom Trocknen leicht erstarrten Halme das noch grüne Gras in die Höhe stützten. Die Rechen strichen flink, aber sacht über den Boden, ohne sich festzuhaken. Das Gras wurde mit jeder Bewegung leichter und verwandelte sich immer mehr in duftendes Heu. Die Gabeln warfen es in die Luft, wenn es zu dicht lag, drehten es nur um, wenn es wenig war, oder kratzten es zugleich abwärts, wenn es am steilen Hang lag. Jede Bewegung saß, war tausendmal geübt, überliefert von einer Generation auf die folgende. Unsere Kinder waren natürlich mit ihren primitiven Werkzeugen dabei und machten, dass das Heu nur noch so in die Luft flog, wie sie es bei den immer und überall anwesenden Hunden gesehen hatten, wenn diese auf Rattenjagd gingen. Wir sahen, dass sich ihre Werkzeuge nicht viel von denen der Bauern unterschieden. Deren Gabeln waren oft auch irgendwelche Astgabeln, die sie beim Hüten ihrer Herden gesehen und entsprechend zurecht geschnitzt hatten. Auch die Rechen waren aus Holz, meist Esche, und der Stiel ein gespreizter Haselnussstock. Was Maschinenbedienung und Wartung anging, waren wir im Vorteil, doch in Bezug auf Handarbeit waren sie wahre Meister!
Abends wurde das Gras wegen des nächtlichen Taus zu Reihen gerecht, was den Vorteil hatte, dass auch das restliche, manchmal durch die Räder an den Boden gepresste Gras eingesammelt wurde. Standen drohend Gewitterwolken am Himmel, schichtete man es mit der Gabel zu Haufen. Das war gar nicht so einfach. Wichtig war, dass es in flachen Schichten aufeinandergelegt wurde und obenauf eine Art Dach, welches über die Flanken hinabhing. Ließ die Zeit es zu, strich man mit dem Rechen oder den Gabelspitzen die äußeren Halme nach unten, ‚kämmte‘ den Haufen, so dass der Regen auch gut ablaufen konnte. Es war klar, dass bei einer solchen Gründlichkeit täglich nur kleine Flächen gemacht werden konnten. Am nächsten Tag wurde alles wieder aufgeschüttelt und erneut ausgebreitet. Selbst nach ein paar Tagen Regenwetter war so ein Heu noch grün, also brauchbar. Fing es an, schwarz zu werden oder gelb, war das mindere Qualität und bedurfte einer gründlicheren Trocknung, damit es später, einmal eingefahren nicht verschimmelte oder sich gar erhitzte und den Heustock entzündete. Elie ‚le Pauvre‘, ‚der Arme‘, wie ihn seine Mutter nannte, seit er herzkrank war, lag dabei meistens auf einer Plane im Schatten oder kümmerte sich um etwas zum Essen. Es lag eine schwere Hitze über den Wiesen. Sein ganzer Clan war bisweilen anwesend, seine Schwester aus Orgibet, deren Tochter und Freund, und wer sonst aus der Familie gerade im Tal war. Da ging es oft ausgelassen her, man erzählte Witze oder lustige Begebenheiten aus anderen Jahren. War Esther, Elies Mutter dabei, führte sie das Kommando und fasste mit an. So war sichergestellt, dass selbst das letzte Hälmchen noch eingesammelt wurde. Sogar größere Flächen, die mit Maschinen gewendet und zu Reihen gemacht wurden, mussten nochmals von Hand nachgerecht werden!
War das Gras trocken, hob Elie seinen Spitz auf den Traktor und kletterte hinterher. Dann startete er den Motor. Wie ein Bulldozer röhrte der Traktor durch das Tal. Hungrig verschlang die seitlich hinten angehängte Presse Gabel auf Gabel von dem duftenden Heu, oder leckte die Reihen vom Boden auf, um sie hinten in mittelgroßen Ballen wieder auszuspucken. Das Ganze in einer Wolke aus Staub und dem rhythmischen Lärm des Pressmechanismus der Maschine. Manchmal fehlte eine Schnur. Dann schnitt man die andere auch auf und warf das Heu vorne wieder vor. Die fertigen Ballen, ‚Bottes‘ genannt, gruppierten wir und stellten sie hochkant aneinander, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen und um sie letztlich auch schneller laden zu können, weil so der Traktor weniger oft anhalten musste. Elies Mutter, von dunklem Teint, immer ganz in Schwarz gekleidet, trotz der Hitze, ihr weißes Haar zu einem Knoten gebunden, gab Anweisungen und fasste auch selber mit an, obwohl sie schon auf die Achtzig zuging. Schier ohne Unterlass gab sie Kommentare, vor allem, wenn sie jemand anderen sah. Keiner kam gut bei ihr weg!
War sie nicht am Arbeiten, stand sie vor ihrem Haus, in dem sie mit ihrem Enkel Jean-Paul wohnte und was die Straße in einer Kurve wie eine Aussichtsplattform überragte und beobachtete, wer den Weg hinauf- oder hinunterging oder fuhr. Von ihrem Beobachtungsposten aus hatte sie auch das restliche Dorf im Auge, hatte zu allem und jedem eine Bemerkung auf Lager. Die Jüngeren, vor allem die Kinder, die mit ihren Eltern ein Ferienhaus im Dorf hatten, fürchteten sie und nannten sie eine Hexe. Niemand traute sich, ihr einen ‚Tustet‘, einen Streich zu spielen. Die Älteren nannten sie eine ‚mauvaise langue‘, ein Schandmaul.
Langsam füllte sich die Scheune neben Esthers Haus mit Heu. Hier waren sonst die Schafe untergebracht, die sich jetzt auf dem Berg befanden. Sie bekamen das feinere Heu. Das längere, gröbere, gabelten wir in die zwei anderen Scheunen, unweit der Departements-Straße, die nach St. Lary führte, gelegen. Hier hielten sie mehrere Kühe, zwei davon abgerichtet, unterm Joch den einachsigen Karren zu ziehen. Diese wurden eingesetzt, wenn die Passagen zu eng für den russischen Traktor und den umgebauten, abgeschnittenen LKW, der als Anhänger diente, waren. Mit einem fast zehn Meter langen Lederriemen, der kreisförmig aus einer einzigen Kuhhaut geschnitten wird, wie Elie mir erklärte, wurde das den zwei nebeneinander stehenden Kühen aufgelegte Joch an deren Hörnern festgezurrt. Ähnlich wie man ein Boot an einem Poller oder einer Klampe festbindet. Selten waren Kühe für beide Seiten abgerichtet. Es gab ‚rechte’ und ‚linke‘ Kühe. Am massiven, der Form der Köpfe angepassten Jochbalken, wurde in der Mitte mit einem eisernen Bolzen die Wagendeichsel befestigt, so dass die Tiere beidseitig von ihr standen. Der Wagen war ein pastellblau gestrichenes massives Gestell aus Eschenholz, seitlich versehen mit zwei Gattern, neben denen sich die fast mannshohen Speichenräder drehten.
Meist lief Elie vor den Zugtieren her, sie mit Worten oder einem leichten Tippen mit seinem Stock lenkend. Schwerfällig, im Gleichmarsch, folgte ihm das Gespann. In jedem Dorf gab es noch einen Bauern, der mit dem Kuh-Gespann arbeitete. Pferde waren zu schnell für das Gelände, waren für flaches Land. Und Ochsen hatten nur die Großbauern gehabt, die viel Futterfläche besaßen. Hier in den Bergen, wo jeder nur wenig Land besaß, brauchte man ein ‚Mehrnutzungsrind‘, wie heute der Fachausdruck heißt. In der Freizeit sozusagen, produzierte die Kuh noch Milch und mästete ein Kälbchen für den Metzger. Damit die Kühe sich nicht über das noch frische Heu hermachten und Pansenstörungen bekämen, hatte Jean-Paul ihnen einen selbstgefertigten Maulkorb aus Hühnerdraht umgebunden. Gegen die Stechfliegen hatte er mit einer Gänsefeder an empfindlichen Stellen einen Hauch von Holzteer, genauer genommen Wachholderteer, aufgetragen. Fast fühlte ich mich auf ein Schiff zurückversetzt, wo alles Tauwerk einen ähnlichen Geruch besitzt! Dieses Wachholder-Teer scheint ein Allheilmittel der Bauern zu sein, denn in jedem Stall riecht es danach und man findet eine Dose mit Pinsel darin. Leider schmierten wir uns selber nicht damit ein.
Am ersten Tag waren wir in Shorts und kurzärmeligem Hemd zum Helfen gekommen. Das hatte allgemeine Heiterkeit hervorgerufen und wir merkten bald warum. Alle machten Stielaugen wegen Doris nackter Beine, so was war anscheinend hier ungewohnt. Dicke, für die Rüssel der Bremsen (‚Taouas‘ genannt) undurchdringbare Kleidung war angesagt. Je höher die Sonne stieg, umso mehr erwachten oder schlüpften diese Biester und stürzten sich, in Ermangelung anderer Blutspender (die Tiere waren ja fast alle auf der Alm), auf uns. Anfangs kamen wir kaum mehr zum Arbeiten, weil man immer irgendwo eine erschlagen oder wegjagen musste. Hatte man eine übersehen, so bildete sich bald an der Einstichstelle eine Beule, die einen tagelang zum Kratzen veranlasste, was dazu führen konnte, dass sich die Stelle entzündete, durch Heustaub oder anderes. Ja kein Parfüm auflegen oder Rasierwasser! Aber diese Gefahr bestand für mich ja nicht. Wir bemerkten, dass die Alten sogar lange Unterhosen und langärmlige Unterhemden trugen, und das sicher nicht, weil ihnen kalt war! Auch trugen alle hohe Schuhe oder Stiefel wegen den Vipern, von denen wir etliche aufscheuchten oder beim Wenden unterm Heu noch in nächtlicher Starre fanden. Langsam gewöhnten wir uns an ihren Anblick. Und trotz deren großer Zahl wurde nie jemand von einer gebissen! Doch wurden oft Geschichten von Leuten, die gebissen worden waren erzählt. Meist lag das aber schon weit zurück.
In der Nähe von St. Girons hatten die Bauern das Heu schon vor einem Monat, also Ende Mai, angefangen einzubringen. Das sahen wir, wenn wir mal in die Stadt fuhren. Nach und nach machte man sich auch in den weiter oben gelegenen Dörfern daran. Eigenartigerweise hatten die unteren Lagen ein trockeneres Klima. Vielleicht waren es die Berge, die die Wolken hier oben zum Abregnen brachten. Gras-Silos, wie in den Alpen, kannte man hier nicht. Alle machten nur Heu. Die reicheren Bauern besaßen Pressen, die das Heu häckselten und zu länglichen, eckigen Ballen zusammenpressten, die bis zu 30 Kilo wiegen konnten. Die zwei zusammenhaltenden Schnüre verliefen in Längsrichtung. Dazu brauchte man starke Traktoren und starke Arme! Diese Ballen hatten den Vorteil, dass sie auch mal einen kurzen Regen überstehen konnten, vor allem, wenn man sie aufrecht aneinandergestellt hatte.
Die anderen Bauern benutzten Bindemaschinen, die das Heu wie eine Ziehharmonika zusammenpressten. Die Schnüre verliefen hier in Querrichtung, also an der schmalen Seite. Diese Ballen wogen 15 bis 20 Kilo und hatten den Vorteil, dass sie nachtrocknen konnten, wenn das Wetter einen zwang, früher zu pressen. Oft streuten wir dann zwischen die einzelnen Lagen Viehsalz und lagerten die schwereren Ballen am Außenrand des Heustockes, damit die Hitze, die beim Fermentieren entsteht, abgeleitet werden konnte und das Heu nicht Feuer fing. Leider waren diese nicht regenfest und oft mussten wir sie wieder aufschneiden und erneut trocknen, wenn es uns nicht gelungen war, sie rechtzeitig einzufahren. Für diese Bindemaschinen genügte ein Traktor mit weniger Kraft.
Dort, wo keine Traktoren mehr fahren konnte, mähten die Bauern ihre Steilhänge mit der Sense oder stark verbreiterten Motormähern, oft mit Zwillingsrädern aus Eisen, deren Stollen sie am Wegrutschen und Umfallen hindern sollten. Manchmal lief jemand oberhalb und sicherte den Mäher mit einem Seil. Oder stützte ihn von unterhalb mit einer Heugabel. Das Wenden ging hier nur von Hand oder speziellen, an die Motormäher anflanschbaren Geräten. Statt zu wenden, rechte man das Heu langsam immer weiter nach unten, um es dann an einer flacheren Stelle zu pressen, oder trug es auf dem Kopf in Bündeln zur Scheune. Diese Bündel, ‚Fajot‘ genannt, waren manchmal ein großes Leinentuch, das man zusammenband, meistens jedoch ein langes Seil, durch ein 40 Zentimeter langes Holzstück geschoren, das man als Schlaufe parallel auf dem Boden auslegte. An einer Seite befand sich das Holzstück, vom vielen Gebrauch glänzend gescheuert, an der anderen die beiden Seilenden. Man schichtete sorgfältig das Heu auf das doppelte Seil, so dass es gleichmäßig auf jeder Seite überstand, zu einem hohen Haufen. Dann führte man die beiden Enden um das Holzstück und zog sie so fest es ging an. Anschließend verknotete man sie daran, ähnlich wie man ein Tauende auf einem Schiff an einer Klampe befestigt. Zwei Männer hoben nun das Bündel an und der Träger, erkenntlich an einem über der Stirn zusammengeknoteten Tuch, das ihm bis über den Nacken hinabreichte, stellte sich da drunter und ergriff die Seile. Einmal im Gleichgewicht ließen die anderen los, und der Träger torkelte in Richtung Scheune, wo er sich rückwärts am meist erhöhten Einwurf anlehnte. Hier nahm man ihm die Last ab.
Helle, rhythmische Schläge erfüllten das Tal, wenn die Bauern ihre Sensen dengelten. Ließ sich eine Sense nicht mehr mit dem Wetzstein (oft ein feinkörniger, länglicher Stein, hier Schiefer) schärfen, der in einem mit Wasser gefüllten Kuhhorn um den Bauch getragen wurde, musste das Blatt gedengelt werden. Dazu schlug man (möglichst im Schatten) den ‚Amboss‘ in den Boden. Das war in dieser Gegend ein länglich geschmiedetes Eisenstück, das im unteren Drittel mit einer Rosette versehen war, damit es nicht im Boden versank, oben in einem schmalen, leicht gerundeten Kopf auslief. Man setzte sich mit gestreckten und gespreizten Beinen auf den Boden, so dass der ‚Amboss‘ vor einem war. Nun legte man das ausgebaute Sensenblatt mit der Krümmung nach oben darauf, so, dass die Schneide zu einem zeigte. Mit den Oberschenkeln konnte man zusätzlich das Blatt stabilisieren. Mittels eines breiten, in der Schlagfläche leicht konvex gerundeten, kurzstieligen Hammers treibt man nun durch leichte Schläge das Blech der Schneide nach außen. Meist in drei Durchgängen. Beim ersten tut sich nicht viel. Doch dann sieht man, wie sich die Schneide mehr als rasierklingenfein verdünnt und schier nach außen ‚fließt‘. Wichtig ist, nicht zu viel in jedem Durchgang zu ‚verdünnen‘, da sich sonst die Schneide wellt oder einreißt. Das beste ist, sich an einer alten Sense zu üben oder an einer kaputten, denn eine gute Sense ist sehr teuer. Lässt sich die gedengelte Schneide durch den darunter gleitenden Fingernagel leicht verformen, ist sie perfekt. Nun noch kurz mit dem Wetzstein drüber und es kann losgehen! Doch beim Schneiden mit der Sense gilt das gleiche, wie beim Dengeln oder Wetzen. Erst die viele Übung macht den Meister! Erst, wenn man sich dabei entspannen kann, ist gute Arbeit möglich. Keine große Kraftanstrengung, keine Hektik! Nur Geduld…
Ich selber zog das Dengeln zu Hause auf einem speziell vorbereiteten Baumstumpf vor. Dabei saß ich bequemer und der Amboss konnte nicht im Boden versinken. Anfangs ist man verkrampft. Doch mit der Zeit lockert sich die Hand und man hört schon am Klang, ob das Blatt richtig liegt und ob man richtig schlägt. Das Dengeln der Sensenspitze verlangt mehr Anstrengung als der Bart.
In manchen Gegenden ist der Amboss flach und der Hammer vorne schmal. In diesem Fall muss man die Sense so darauf legen, dass die ‚Öffnung‘ nach oben zeigt. Ich selber hatte beide Systeme, dengelte aber lieber mit dem breiten Hammer auf einem schmalen Amboss.
Beim Zusammenbau der Sense ist darauf zu achten, dass sich die Spitze tiefer als der Bart befindet. Dazu legt man die Sense auf den Boden und legt einen Gegenstand an den Bart, die breiteste Stelle neben dem Stiel. Nun beschwert das Stielende mit dem Fuß und dreht die Sense so weit nach rechts, bis die Spitze an diese Stelle kommt. Diese muss so ausgerichtet werden, dass sie sich zwei bis drei Finger tiefer als diese Stelle befindet.
Je nach Größe des Mähers muss auch der Winkel des Sensenblattes am Stielende eingestellt werden. Entweder durch Unterlegen von Keilen oder Anschrägen des Stielendes. Am einfachsten geht das Mähen, wenn das Gras noch feucht vom Tau ist. Außerdem ist es dann noch kühler. An Hängen ist es besser, sich parallel zum Hang zu bewegen und mit der Sense nach unten zu mähen. Schädlich für die Sense sind Steine, die in der Wiese liegen und Maulwurfshaufen. Schneidet eine Sense nicht mehr gut, und will man eine Wiese unbedingt fertigmähen, kann man sie ‚aufboosten‘, indem man in das Kuhhorn, was den Wetzstein beinhaltet, pinkelt.
Durch unsere Tiere waren wir morgens und abends an den Hof gebunden. Doch ansonsten waren wir, vor allem ich, in den nächsten drei Wochen jeden Tag im Tal zum Helfen. Denn es war nicht nur Elies Familie, die uns in ‚Besitz‘ genommen hatte, auch andere fragten mich um Hilfe, um einen ‚coup de main‘, weil anscheinend kein einziger Motormäher im Dorf funktionierte! Dabei lud man mich zum Mittagessen ein und zahlte mir zudem noch die Arbeit, obwohl ich nichts nehmen wollte! Brauchen konnten wir es natürlich, denn es ging mehr raus als reinkam.
Wir erfuhren, dass man hier in der Regel nur einen Schnitt macht, einen zweiten nur in tieferen Lagen. Hier lässt man das Gras, was nachwächst, den ‚Regain‘, von den Tieren abweiden, wenn diese von der Alm zurückkommen. Und wir hatten gedacht, dass man, wie im Allgäu, auch hier vier Schnitte machen kann! Das brachte mich zum Rechnen: Im Allgäu hielt man zwei Kühe auf einem Hektar, bei vier Heuschnitten. Hier macht man nur einen. Das hieße umgerechnet, wir benötigten vier Hektar für zwei Kühe zum Füttern, oder zwei Hektar Land pro Kuh! Wir besaßen rund zwanzig Hektar Fläche, das hieße, wir könnten zehn Kühe halten. Doch fing ich langsam an, daran zu zweifeln. Vielleicht weiter unten, wo das Gras dicht stand. Aber nicht bei uns, wo man die Hälmchen zählen konnte! Ich fragte Esther, die ja von unterhalb von uns herstammte, wie viele Kühe wir ihrer Meinung nach da oben halten könnten. Sie überlegte eine Weile, dann fragte sie: „Wollen sie es wirklich wissen?“ Ich bejahte. „Zwei, maximal drei!“, war ihre Antwort.
Einer der Viehhändler bot uns zwei schwarz-weiße Rinder an. Wir dachten, es wären Holsteiner, eine Rasse, wie ich sie von Norddeutschland kannte. Wir warteten darauf, dass sie größer wurden, doch sie gingen nur in die Breite. Wie sich später herausstellte, waren es ‚Bretonen‘, also eine Rasse aus der Bretagne. Hinter unserem Hausberg hatten sich zwei Brüder niedergelassen, die ein paar Kühe dieser Rasse hielten und angefangen hatten, die Milch zu verkäsen. Ihre Kühe waren im Vergleich zu anderen eher Zwerge. Wir wollten sie besuchen. Wir fuhren soweit es ging die Forststraße hoch, ließen, als es zu steil wurde, den Bus zurück und stiegen zum Col de la Croix hoch. Uns stockte der Atem! Vor uns tat sich ein grandioses Bergpanorama auf, das den ganzen Horizont einnahm. Wir drehten uns um und schauten zurück in das Tal, aus dem wir gekommen waren. Auch hier rundum nur Berge! Dadurch dass wir so hoch waren, überschauten wir die Kette, die unser Tal nach Norden abgrenzte, bis hinein in die dunstige Ebene, in der irgendwo Toulouse liegen musste. Wir kletterten auf eine letzte Erhebung und ließen uns in eine Mulde voller Heidekraut fallen. Dann schauten wir eine Weile die Berge an, glücklich, dass es nicht weit von unserem Hof einen solchen Platz gab! Die Kinder hatten schon ein paar Schieferstücke mit Pyrit darinnen entdeckt und ich musste sie aus dem Fels lösen. Sie würden sie zu Hause zu ihrer schon beachtlichen Steinsammlung legen!
Wir liefen langsam weiter. Wir schauten mehr auf die majestätischen Berge, die Kinder auf alles, was sie am Wegrand und in den Böschungen entdeckten. Der Weg, anfangs ein tiefer Hohlweg, führte bald über stufenartige Felsen in Richtung Tal. Das erste menschliche Wesen, das wir trafen, war Clement, ein langhaariger Franzose, der mit seiner Familie hier oben in der Bergeinsamkeit lebte. Er rauchte gerade eine sehr nach Gras riechende Zigarette. Unweit grasten zum Geläut ihrer Halsglocken ein paar Fjordpferde, eher exotisch anzusehen, hier in den Pyrenäen, mit ihren hellbeigen Fell und den schwarz-gelben, nur auf einer Seite herabhängenden Mähnen. Wie er sagte, machte er bisweilen Materialtransporte mit seinen Tieren. Wenn nicht der Hubschrauber ihm die Arbeit wegnahm. Er erklärte uns den Weg zu den Käsebrüdern.
Wir stiegen langsam den Pfad weiter abwärts. Bestimmt hatte man hier früher auch Holz gezogen, weswegen er bisweilen so tief eingeschnitten war, den Rest hatte wohl das Regenwasser verursacht. Unsere Augen wurden immer wieder von den Bergen angezogen. In einzelnen Rinnen lag noch ein letzter, wohl von Sandstaub schmutziger Schnee. Diese Weite, die auf dieser Seite herrschte! Unser Hausberg war auch schön, aber nahe dran. Er engte die Weite ein. Diese Berge hier schufen erst die Weite! Unter unseren Füssen erstreckte sich ein von Wiesen bewachsenes, heckendurchzogenes Tal südwärts, das sich hier und da aufteilte, kleinere Berge umging, mit Wald bedeckt zu den felsigen Gipfeln anstieg, um dann als Zacken an der hellblauen Himmelslinie zu enden.
Vögel mit weitausladenden Schwingen kreisten fast bewegungslos im klaren Blau des wolkenlosen Himmels. Wir hielten sie für Adler. Doch waren es Bartgeier, wie man uns aufklärte. Bald sahen wir am Wegrand eine schwarzglänzende Plastikleitung. Wir folgten ihr und gelangten zu einer länglichen Scheune, wie alle Gebäude in den Tälern aus Feldsteinen, meist ohne Mörtel errichtet, mit Schiefer gedeckt. Sie war zur Hälfte umgebaut als Wohnung, die andere Hälfte diente als Stall. Davor standen drei schwarz-weiße kleine Kühe mit großen Eutern. Zwei junge Burschen waren mit Heugabeln beschäftigt, auf einer kleinen Wiesenparzelle das Heu zu wenden. Ein Duft von Kräutertee wehte uns entgegen. Sie begrüßten uns und stellten die Werkzeuge an die Hauswand. Sie pflückten ein paar Halme ‚Serpolet‘, wilden Majoran am Wegrand und setzten im kühlen Halbdunkel der Wohnküche Wasser auf die Gasflamme. Sie kamen aus Paris, hatten aber eine Weile in der Bretagne gewohnt, bevor sie hier in Ariège strandeten. Von dorther kannten sie schon diese Kuhrasse, klein, anspruchslos, ideal für die Berge. „Aber die Höhe, der magere Boden?“, gab ich zu bedenken. „Ihr und wir kommen auch von anderswo, und haben uns angepasst; die Tiere können das ebenfalls!“ „Meint ihr nicht, dass sie im Verhältnis zu anderen Kühen weniger Milch geben?“ „Wir sind jedenfalls zufrieden. Doch wieviel sie genau geben, wissen wir nicht, da wir zwei Kälble haben, die wir saugen lassen. Aus der restlichen Milch machen wir Käse. Wollt ihr mal probieren?“ Sie holten aus einem winzigen Anbau, der hinterm Haus in die Erde gegraben war, einen kleinen runden Käse hervor und schnitten ihn an. Er erinnerte uns etwas an die Käse, die wir in Deutschland gemacht hatten. Noch nicht perfekt, aber gut! Natürlich nicht zu vergleichen mit den Hartkäsen, wie sie in den Alpen hergestellt wurden. „Dieses ist eine Art laktischer Käse. Wir versuchen noch, ihn zu verbessern. Wenn er mal weniger gut ist, dann verkochen wir ihn halt. Nichts geht verloren!“ Dieses war auch unsere Meinung.
Sie erzählten uns, dass nicht weit weg ein anderer Freak lebte, Daniel, der mehrere Pferde der Castilloner Rasse besaß, mit denen er Transporte unternahm. Nach dieser Kostprobe mussten sie wieder ins Heu und wir machten uns auf den Rückweg, denn zum Abend mussten unsere Kühe gemolken werden. Hoffentlich waren sie noch da!
Die Gendarmen mochten uns anscheinend gerne, denn sie hatten uns wieder einen Besuch abgestattet! Nur mal so, da sie gerade in der Gegend waren… Natürlich hatten wir die Aufenthaltsgenehmigung nicht, nach der sie fragten. Und das wussten sie genau! Klar, wir hatten diese bei der Präfektur in Foix beantragt. Aber Behörden arbeiten auch in Frankreich langsam. Sie brauchen Zeit. Sie leben von der Verzögerung. Das gibt ihnen die Existenzberechtigung. Gut, wir waren schon über drei Monate hier. Aber zwischendrin waren wir in Spanien gewesen, also aus- und wieder eingereist. Wie die sich das vorstellten! Wenn das so weitergeht, müssen wir eine Wanderherde aufbauen und mit ihr alle drei Monate über die Grenze gehen!
Auch hatte eine andere Behörde, die DDA, uns eine Vorladung zu einem Gespräch geschickt, die Direction Departementale de l’Agriculture. Weiterhin hatte die MSA, die Mutualité Sociale Agricole, also die Bauernkrankenkasse Neuigkeiten für uns. Ich fuhr alleine hin, denn was sollte die ganze Familie mit mir durch die Behörden hetzen? Und jemand musste nach den Tieren schauen!
Zuerst begab ich mich zur Präfektur. Ein Pförtner, der den Schlagbaum des kleinen Parkplatzes öffnete, bewachte das Gebäude. Da Behörden im Gegensatz zu Bauern spät anfangen, war ich zu früh da und musste warten. Dadurch aber war ich der erste, der drankam. Zum Glück war es kein Montag, und der Empfang war freundlich. Man gab mir eine provisorische Aufenthaltsgenehmigung für sechs Monate. Bis dahin müsste die endgültige fertig sein!
Bei der Bauernkasse hingegen glich das Ergebnis einer kalten Dusche. Man teilte mir mit, dass wir nicht als Bauern anerkannt werden konnten, weil nicht die Fläche des Hofes, sondern dessen ‚Katastereinkommen‘, der ‚Revenue Cadastral‘ zählte. Das waren 95 Francs und wir bräuchten mindestens 120! Also Land pachten oder dazukaufen oder mir eine Arbeit suchen und somit bei einer anderen Kasse versichert zu sein! Das hieß, dass wir weiterhin keine Krankenkassendeckung hatten und weiterhin keinen Anspruch auf Kindergeld.
Es war noch nicht Mittag, genügend Zeit, um im Landwirtschaftsamt reinzuschauen, das nicht weit von der Kasse entfernt lag. Ich erwartete eigentlich nichts. Nachdem ich in zwei falschen Büros gelandet war, führte man mich in das richtige. Es saßen da ein paar junge Berater, erzählten sich Witze und tranken einen Kaffee. Man bot auch mir einen an und fragte nach dem Problem. Ich suchte die Korrespondenz der Krankenkasse raus, die Eigentumsurkunden, und erklärte die Lage. Sie besaßen Mikrofilme mit Auszügen vom Katasteramt und von den früheren Eigentümern. Sie gingen alles durch. Und dabei fanden sie heraus, dass die Unterlagen der Kasse seit über zehn Jahren nicht dem neuesten Stand des Katasteramtes angeglichen worden waren. Vielleicht, weil unser Anwesen seit langem als unbenutzt geführt wurde, wohl, weil die Eigentümer Gebühren sparen wollten. Und nach dem neuesten Stand hatte unser Land einen ‚Revenue Cadastral‘ von 124 Francs, also mehr als das Minimum! Sie sicherten mir zu, sich darum zu kümmern, in ein paar Tagen könnte das geregelt sein! Notfalls könnte man durch Hinzufügen einer ‚Spezialkultur‘, wie Bienenvölker oder Holzverkauf etwas ‚arrangieren‘! Ich atmete auf. Ich konnte mir nicht vorstellen, in solchen Büros zu arbeiten, ohne morose zu werden oder zu einem Paragraphenreiter wie die in der MSA. Hier kümmerte man sich und tat alles, um einem zu helfen!
Es blieb noch der Gang zur DDA, dem Amt, das hauptsächlich für die Zuschüsse zuständig war. „Zuschüsse – was sollen denn die? Ich will von meiner Hände Arbeit leben!“ Doch mein Gegenüber, ein älterer Mann, sicher nicht mehr weit von der Rente, war anderer Meinung. „Sind sie auf dem Laufenden, was den Milchpreis betrifft, oder den Fleischpreis, vor allem den für Lämmer? Leider kann ein Bauer davon, vor allem hier in den Bergen, wo die Arbeit meist nicht von Maschinen gemacht werden kann, niemals leben! Und kennen sie die Preise für einen Bergtraktor? Das Dreifache eines normalen! Nehmen sie die Zuschüsse mit ruhigem Gewissen, und so viel wie möglich!“, riet er mir. Er studierte eine Weile meine Unterlagen. Als er mein Gärtnerdiplom sah, wurde er stutzig und telefonierte mit jemandem. Dann teilte er mir mit, dass es dem französischen BPA entsprach, und ich Anspruch auf die Installationsprämie für Jungbauern hätte, 45 000 Francs, da ich noch jünger als 35 Jahre war. „Das ist bestimmt mit irgendwelchen Auflagen verbunden, und ich möchte auf meinem Hof frei handeln können!“, warf ich ein. „Ich kann ihnen die Adressen mehrerer Jungbauern in ihrer Nähe geben. Schauen sie bei denen rein, sagen sie, ich habe sie geschickt. Die werden bestätigen, dass sie weiterhin freie Hand haben! Die einzige Auflage, die sie haben, ist das Abführen der TVA, der Umsatzsteuer für ihre Verkäufe.“ Ich wollte wissen, was das genau bedeutete, war die MWSt doch auch kürzlich in Deutschland eingeführt worden. Und die hatte alles teurer gemacht. „Das ist einfach: Egal, was auch immer man kauft, man zahlt darauf eine Steuer. Die beträgt in Frankreich 16,8%. Wenn sie eine Motorsense für 1000 Francs kaufen, haben sie darauf 144 Francs Steuern bezahlt. Die sind weg. Wären sie der TVA angeschlossen, würden sie diese Summe wieder zurückbekommen.“ Ich wollte es nicht glauben. „Der Staat gibt nichts! Der nimmt doch nur!“, warf ich ein. „Natürlich müssen sie dafür auf ihre Verkäufe auch eine Steuer abführen. Doch ist diese auf landwirtschaftlichen Produkten 5,5%. Es bleiben ihnen also rund 90 Francs!“, erklärte er. „Das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen! Und außerdem braucht man dazu bestimmt irgendeine Buchführung. Denn ohne Kontrolle wird das doch nicht gehen!“ „Bald werden alle Betriebe buchführungspflichtig sein!“, meinte er. „Die ersten 5 Jahre müssen sie das von einer anerkannten Organisation machen lassen. Es gibt da die CEGERA, die sich um die Bauern kümmert, nachher können sie die Buchhaltung auch selber machen.“ „Die machen das doch nicht umsonst!“, zweifelte ich. „Je nach Anzahl der ‚Zeilen‘ kostet das von 6000 bis 10000 Francs im Jahr.“ „Ne schöne Summe!“, erwiderte ich. „Die ersten 5 Jahre bekommen sie dafür einen Zuschuss. Es kostet sie also wenig. Und nach 5 Jahren machen sie die Buchführung selber…“ Mir schwirrte der Kopf. All diese Abkürzungen, die ich heute schon gehört hatte… Doch er war noch nicht am Ende: Ihr Hof liegt in der ‚zone montagne‘, das heißt, sie haben Anspruch auf die ISM, die ‚Indemnitée Special Montagne‘. Diese richtet sich nach der Hektarzahl und der Art der Kulturen auf dem Land. Und sie haben Kühe? Wenn sie die Milch nicht an eine Molkerei liefern, können sie die ‚Prime Vache Allaitante‘ bekommen. Sie haben den Hof im Januar gekauft. Ich bin sicher, dass sie für dieses Jahr noch diese Prämien bekommen können, zumindest aber ab dem 1. April, dem Beginn des neuen Landwirtschafts-Jahres!“
Darüber war der Nachmittag vergangen. Er erzählte mir, dass er dabei sei, im Tal von Riberot eine Scheune herzurichten. Schwarz natürlich, denn eine Baugenehmigung bekomme er dafür nie! Wenn ich mal Arbeit bräuchte, also genauer gesagt Geld, könnte ich für ihn dort schaffen! Doch im Augenblick hatte ich genügend Arbeit und das Heu war auch noch nicht fertig… Anschließend ging ich in einen Laden du kaufte ein paar Orangen für die Kinder, um ihnen eine Freude zu machen. Ich stellte die Tüte hinten in den Laderaum. Dann machte ich mich auf den Rückweg.
Wenn man Foix in Richtung Westen verlässt, schlängelt sich die Straße ein paar Kilometer den Berg hinauf, zum Col del Bouich. Da nicht viel Verkehr war, nahm ich die Kurven großzügig, vielleicht etwas zu…, denn ich war in Eile, die Tiere warteten daheim auf mich. Aber ich glaube, es war eher mein Auto, was die Aufmerksamkeit des Auges des Gesetzes auf sich zog. Denn zwei seiner Vertreter standen sich langweilend auf der anderen Straßenseite und hielten Ausschau auf Kundschaft. „Scheiße, Bullen!“, ging es mir wie jedem anständigen Bürger beim Anblick dieser Wegelagerer durch den Kopf, und schon hob der Jüngere die Kelle und eilte auf meine Straßenseite, um mir den Weg zu versperren. Was blieb mir anderes übrig als auf die Gegenseite zu fahren und anzuhalten! Handbremse gut fest und zur Sicherheit noch den Gang rein. „Bonjour! Bitte Motor ausmachen und aussteigen! Können wir ihre Papiere sehen?“ Als sie sahen, dass ich Deutscher bin, ging ein Leuchten über ihr Gesicht. „Haben sie eine Aufenthaltsgenehmigung?“, fragte der Ältere hämisch. Ich kramte in meinem Ordner und hielt ihnen das begehrte Papier unter die Nase. Sichtlich enttäuscht gaben sie es mir zurück. „Haben sie Waren dabei?“ „Eh euh, eine Tüte Orangen“, gab ich zur Antwort. „Laderaumtür aufmachen!“, wies der Ältere an. Ich zögerte, denn ich wusste was mich erwartete: die Orangen hatten sich in der Tüte zu eingeengt gefühlt und sich in den vielen Kurven daraus befreit. Durch mein Zögern wurde der Polizeiinstinkt des ‚Altbullen‘ geweckt und er näherte sich erwartungsvoll. Und da rollte auch schon die Orangenlawine aus der Öffnung! Die Früchte hüpften leicht auf dem Teer auf und verteilten sich fächerförmig auf der abschüssigen Straße. Der ‚Jungbulle‘, wohl Fußballfan, hatte den richtigen Reflex und hielt mit einem Fuß den Lauf zweier Bälle auf, während ich den anderen hinterherhechtete, um sie vor den saftpressenden Rädern eines sich nähernden Autos zu bewahren. Endlich hatte ich alle Früchte aufgelesen und in meinem schnell zu einer Schürze verwandeltem Hemd verstaut. Der ältere Polizist hatte die Gelegenheit ergriffen, das sich nähernde Fahrzeug auf die Seite zu winken, um nun den darinsitzenden Fahrer zu ärgern. Ich befreite den Jüngeren von den Orangen zu seinen Füssen, verstaute sie im Auto und durfte auf seinen Wink hin wieder auf die Straße.
Als bei Elie auf den um das Dorf liegenden Wiesen alles Heu eingefahren war, zeigte er mir eine fast flache Parzelle in der Nähe der Kirche. Diese lag oberhalb vom Dorf unweit der Straße zu uns hoch, in Terrefete. Das war eigentlich ein passender Name für den Platz, wo der Friedhof lag: ‚Erdgemacht‘. „Das da ist dein Heu. Das gebe ich dir. Da kann ich mit meinem Traktor nicht reinfahren, der ist zu groß dafür. Aber du mit dem Motormäher und dem Auto kommst da gut durch!“ „Kann man denn nicht von der anderen Seite hier rein, wo der windschiefe Schuppen mit den Maschinen steht?“ „Früher ist das gegangen. Da muss man über eine Parzelle rüber, die der Gemeinde gehört. Aber die hat sich der dort unter den Nagel gerissen!“ Er zeigte zu einem Haus hinüber vor dem zwei alte Leute im Schatten saßen. „Deren Sohn, der Fernfahrer, du hast ihn schon gesehen, hatte, als er vor ein paar Jahren Bürgermeister war, sich diese Parzelle auf Lebzeiten überschrieben. Keiner darf da jetzt noch drüber, nicht einmal zu Fuß! Der denkt, dass er so mein Land und das der anderen benutzen kann, weil wir nicht hinkommen. Aber da hat er sich getäuscht! Du wirst das Heu machen!“
Anschließend fuhren wir in Richtung unseres Hofes. Auf etwa halbem Weg, hinter der hölzernen Brücke, die den Bach überspannte, deutete er auf eine andere Wiese. „Die da gebe ich dir auch, und die Parzelle hinter der Hecke. Doch die erste Parzelle gehört dem Fernfahrer!“ „Der wird mich wohl nicht darüberfahren lassen!“, entgegnete ich. „Ich denke schon, gegen dich hat er ja nichts! Wenn es geht, helfe ich dir etwas beim Pressen oder Einfahren.“ „Das ist wohl das Mindeste!“, dachte ich mir, „eigentlich müsste er auch beim Heumachen helfen.“ Ich kapierte nicht ganz. Er hatte mir ebenso viel Heu versprochen, wie wir für ihn gemacht hatten. Und jetzt gibt er mir nur Gras! Ich sprach ihn darauf hin an. „Das ist doch dasselbe. Du brauchst es dir nur zu machen! So fleißig, wie ihr seid, habt ihr es bald fertig!“ Ganz schön gerissen! dachte ich mir.
Glücklicherweise war die alte Frau, die in der Kurve der engen Zufahrt zu der Wiese in Kirchennähe wohnte, bereit, ihren Zaun wegzumachen, damit wir dort mit dem Auto und Anhänger durchkämen. Sie war wirklich freundlich, lud uns auf ein Bier ein und erzählte uns ihre Sorgen. Und ihre Hauptsorge war eben dieser Nachbar. Sie hatte ihn an ihrem Haus Reparaturen machen lassen, und seitdem ‚spukte‘ es im Haus. Des Öfteren, so gegen Mitternacht, waren da Geräusche, so als ob da ein Elektromotor wo eingebaut sei und summte. Sie hatte davon zu ihrem Nachbarn gesprochen, welcher dann im Dorf rumerzählt hatte, dass sie verrückt sei und Gespenster sehe. Jedenfalls hatten wir nach vier Tagen das Heu fertig und fuhren es auf dem Autoanhänger hoch. An unserer Talstation luden wir es ab und fuhren es nach und nach mit dem Windenwagen zum Haus empor. Da wir den Wohnwagen hätten verzollen müssen, schenkten wir ihn Peter, dem ‚Salonökologen‘, der damals unsere Nachfolge beim Biobauern angetreten hatte (siehe ‚Grün ist das Leben‘). An der Stelle, wo der Wohnwagen gestanden hatte, bauten wir ein Wellblechdach, um das Heu aus dem Dorf darunter zwischenzulagern.
Doris Mutter und Bruder wollten uns besuchen kommen. Die Kinder waren ganz aufgeregt, denn Oma hatte ihr Auto immer bis unters Dach mit Überraschungen und Leckereien vollgestopft. Natürlich außer Gummibärchen meist biologische Schmankerl oder Sachen aus dem Reformhaus. Wir waren gerade dabei, die Wiese hinter der Bachbrücke zu mähen, als wir ein Auto hörten. Die Kinder hatten es als erste erspäht und erkannt und rannten hin. War das eine Freude, sich wiederzusehen! Wir saßen im Gras, erzählten uns die Geschehnisse der letzten Zeit und tranken ein Weizenbier aus Omas unergründlichem Kofferraum. Anschließend fuhren alle zum Haus hoch, nur Doris Bruder Reiner und ich machten das Heu weiter.
Zum Glück kam Elie mit seiner Presse und machte die Ballen. Das machte den Transport einfacher. Der Fernfahrer, dem die anschließende Wiese gehörte, hatte noch nicht einmal unten im Dorf seine Wiesen gemäht. Es war schon Juli, und wenn wir nicht bald mähen würden, wäre statt Heu nur noch Stroh übrig! Denn wenn das Gras einmal Samen gebildet hat, werden die Stängel hart und es vertrocknet. Der beste Moment zum Schneiden ist vor der Samenbildung. Und natürlich wenn das Wetter günstig ist. Ich mähte also eine Schneise durch seine Wiese, um an unsere zu kommen. Elie war entsetzt und weigerte sich, mit seinem Traktor da durchzufahren. „Der bringt es fertig und hetzt mir die Gendarmen auf den Hals, wenn ich über sein Land fahre!“ Also trugen wir alles Heu auf die vordere Wiese und pressten es dort. Die paar Ballen mit dem Heu der Passage stellten wir aufrecht in diese hinein und deckten einen Plastiksack darüber. So sah er, dass wir nichts davon mitgenommen hatten.
Nun endlich konnten wir uns an die Wiesen rund um unser Haus machen. Der Farn, den wir oben am Berg gemäht hatten, um ihn als Einstreu zu benutzen, war inzwischen von der Sonne völlig vergilbt und zerfiel beim Rechen. Also zündete ich die Schwaden an, damit wieder Licht auf die Erde fallen konnte. Beinahe wäre das schiefgegangen, denn die anfangs leichten Windböen entfachten die kleinen Flämmchen zu lodernden Flammen, die glühende Partikel in die Luft wirbelten und in Richtung Wald abtrieben. Ich hatte noch nicht einmal eine Schaufel dabei, um diese auszuschlagen, nur meine Heugabel! Hoch stiegen diese, im Spiel mit der flimmernden Luft empor und ließen hier und da auf dem ausgetrockneten Waldboden neue Brandherde entstehen. Feine, bläuliche Rauchfähnchen krochen stellenweise aus der vorjährigen Laubschicht, bereit sich weiter auszubreiten. Ich hetzte von einem zum anderen und trat sie mit einer Drehbewegung des Schuhes aus. Die Hitzestrahlung des Feuers, meine Panik vor einem Waldbrand und mein Gerenne brachten mich an den Rand der Erschöpfung. Und plötzlich fiel das Feuer in sich zusammen, die Schwaden waren verbrannt und der Wind fand nur noch schwarze Asche, die er enttäuscht zum Boden zurückfallen ließ. Nachdem ich sicher war, dass kein versteckter Brandherd mehr im Laub schlummerte, setzte ich mich im Schatten einer Birke nieder und lehnte mich an ihren Stamm. Die Luft roch noch nach Rauch. Doch da sah ich plötzlich unser Tal in einer solchen Klarheit unter mir liegen, wie ich sie vorher nur beim Tauchen erlebt hatte! Der Wald hatte sich mit seinem Frühsommergewand bekleidet, die grünen Hügel reihten sich hintereinander, der blaue Himmel spannte sich wie eine Halbkugel darüber. Es erschien mir wie eine Miniaturwelt, hier oben von meiner Warte aus. Und von da unten, wo ich das Dach unseres länglichen, leicht bogenförmigen Hauses erkannte, klang Kinderlachen und Hundegebell zu mir herauf. Ich kraulte die Erde, streichelte den Birkenstamm und war glücklich. Ich dankte dem Himmel und der Erde, dass sie mich hervorgebracht hatten und dass ich hier sein durfte. Und ich wusste: Die Arbeit war der Preis, den ich dafür zu zahlen hatte. Denn alles in diesem Weltall ist stetes Geben und Empfangen!
Wir hatten verschiedene Geräte zum Heumachen billig gekauft oder mit Arbeit bezahlt. Eines war eine Mähmaschine, ganz aus Gusseisen, die normalerweise von zwei Tieren gezogen wird. Wir hatten aber nur eines. Die mit eisernen Stollen versehenen Räder treiben hier den Mähmechanismus an, ähnlich wie der Motor den Motormäher. Doch war diese Maschine so schwer, dass wir sie kaum den Hang hinaufbekamen. Wir mussten uns mit dem Pferd anspannen. Als wir sie endlich oben hatten, legte sich das Pferd schaumbedeckt erschöpft auf den Boden und wir auch. Uns wurde klar, dass wir damit nicht unsere Wiesen mähen könnten. Wir parkten das Gerät in einem Eck, wo es dann auch stehen blieb.
.
Ein anderes Gerät, auch mit zwei den Mechanismus antreibenden Rädern ausgerüstet, war ein Heuwender. Dieser war aber um vieles leichter. Der Vorbesitzer hatte ihn schon für Traktorbetrieb umgebaut gehabt. Wir schraubten zwei Metallrohre an die Stelle der morschen Deichsel und führten Calina rückwärts dazwischen. Das gefiel ihr schon besser! Quer im Rahmen war eine ‚Kurbelwelle‘ gelagert, die über Gestänge mehrere mit Federzinken ausgestattete Heugabeln antrieb. Diese wirbelten das Heu vom Boden in die Luft und wendeten es so. Die Kinder tauften dieses Gerät den ‚Frodofüßler‘, weil es ähnlich arbeitete wie unser Hund. Dieser ließ es sich nicht nehmen, hinterher zu rennen und nach dem durch die Luft sausenden Heu zu schnappen. Da das Gelände zu steil war, zog ich es vor, nicht auf den Sitz zu klettern, sondern daneben zu laufen und das Pferd zu lenken.
In einem Weiler entdeckte ich in einem Brombeergebüsch eine Schwadmaschine. Diese war wohl 2.50 Meter breit und über die ganze Breite mit halbkreisförmigen Zähnen ausgerüstet, die beim Fahren über den Boden glitten und das Heu zu dicken Würsten sammelten. Die Kinder nannten sie die ‚Heuwurstmaschine‘. War genügend Heu vor den Zähnen angesammelt, hoben sich auf Hebeldruck, bedingt durch das Drehen der Räder, die rechenartigen Zähne und ließen eine fast hüfthohe ‚Wurst‘ aus Heu auf der Wiese liegen. Die Kunst bestand darin, diese ‚Würste‘ so abzulegen, dass sie alle eine Reihe bildeten, die wir dann auf den Schlitten laden konnten. Doch oft zogen wir die Handarbeit vor, weil durch geschicktes, planvolles Rechen manche Arbeitsschritte verkürzt werden konnten.
Mit dem Motormäher nahm ich die Wiesen in Angriff. Hier oben stand das Gras so licht, dass es nicht den Messerbalken verstopfte. Und anstatt des Wendens genügte oft schon etappenweises Zusammenrechen. Aus zwei leicht gebogenen Eschenstämmen und ein paar Brettern schraubte ich einen langen Schlitten zusammen, auf dem wir das Heu zwischen zwei vorne und hinten schräg angebrachten Gattern ablegten und mit einem Seil nach unten pressten und befestigten. Wir rechten das Heu zu verschiedenen Haufen zusammen, da wir so besser laden konnten. Doch unser Fohlen schien eine Freude daran gefunden zu haben, sich in diesen Haufen zu wälzen und sie wieder zu verteilen. Es blieb uns nichts anderes übrig als es zeitweise einzusperren. Unsere Calina schien nur darauf gewartet zu haben, uns zu zeigen, wozu sie fähig ist, warf sich ins Geschirr und zog die Ladung zum Haus. Dort schafften wir das duftende Heu mit einer langen Gabel hinauf auf den Boden.
Wie oft dachten wir abends, „jetzt ist alles voll!“, und am nächsten Morgen war es soweit zusammengesackt, dass wir fast verzweifelten. Wir fühlten uns wie Sisyfos. Na ja, nicht ganz. Denn wir taten es freiwillig, und irgendwann hatte unsere Maloche ein Ende. Das letzte Heu war drinnen!
Die Tage waren lang. Nicht nur, weil es Sommer war. Es war die Arbeit, die die Tageslänge regelte. Der Hahn weckte uns. Wir aßen ein Müesli mit eigener Kuhmilch und Honig vom Roger. Dann molken wir die Kühe. Jeder von uns zweien hatte irgendwie seinen Bereich geschaffen, auch wenn er dem Anderen oft zur Hand gehen musste. Doris‘ Bereich war in erster Linie Kinder, Kochen, Haus und Garten. Ich machte mich an die ‚Hofarbeit‘: Tiere versorgen, Heu, Zäunen, Land freischneiden und zugleich Brennholz machen, das Haus renovieren, und vieles mehr wie Baustellen außerhalb, um etwas Geld zu verdienen, oder jemandem aus dem Dorf zur Hand gehen. Dadurch war ich bisweilen den halben Tag nicht da.
Abends dann wieder gemeinsames Melken. Meist standen die Kühe schon wartend am Melkplatz, zwei Bäumen, an denen wir sie anfangs anbanden. Später reichte es, ihnen ein Seil über den Hals zu legen. Wenn sie mal nicht da waren, artete das oft in ein längeres Versteckspiel aus, das aber meistens der Hund gewann. Trotz ihrer Glocken verhielten sie sich mucksmäuschenstill! Wenn möglich, rannte ich mit ihm zu den Kühen, wiederholte laut die verschiedenen Befehle, kreiste sie mit ihm ein, damit er es lernte. Aber lange rannte ich nie bergauf. Mir ging bald die Puste aus! Da war der Hund im Vorteil, allein schon wegen seiner vier Beine! Aber wenn die Kühe nicht wollten, dann lagen wir bald nebeneinander im Farn, alle viere von uns gestreckt, und unsere Atem pfiffen um die Wette. Waren die Tiere versorgt, kamen die Kinder dran. Meist aßen wir zusammen, bevor sie ins Bett gingen. Doris las ihnen Geschichten vor oder sang leise Lieder, die sich mit dem Sternenhimmel wie eine Decke aus Frieden auf unser Land legten. War sie nicht schon mit ihnen eingeschlafen, setzte sie sich nachher zu mir hinaus an die warme Hauswand, unsere Hände fanden sich, und zusammen schauten wir auf die vom glitzernden Sternenhimmel eingerahmte Bergkulisse und freuten uns über das geschaffte Tagwerk. Leise schwebt das Rauschen des Baches zu uns herauf, von fern klingt das Bellen eines Hundes, ein Reh blökt gegenüber im Wald, was den Hund aufspringen lässt. Sein Fell sträubt sich leicht unter meiner Hand und er lässt ein warnendes Knurren hören. Grillen zirpen, ihr Gesang scheint von überall zu kommen und geben uns das Gefühl, wirklich in Südfrankreich zu sein. Die Katze streicht sanft schnurrend um unsere Beine.
Manchmal laufe ich bei Vollmond auf den gegenüberliegenden Hang, setze mich an einen Baum und schaue auf unseren im Mondlicht schwebenden Hof. In diesen Momenten bin ich überglücklich, fühle mich entschädigt für die Mühen des Tages und bin bereit, noch größere auf mich zu nehmen! Glück ist oft ein Moment-Zustand. Damit es dauerhafter wird, muss man seinen Preis zahlen, und der heißt Mühe.
Zweimal die Woche kam ein LKW mit Zuchthengsten das Tal heraufgefahren und hielt bei Bedarf an. Das waren Tiere vom Armee-Gestüt in Tarbes, welches eine Zweigstelle in St. Girons hatte. Hierhin konnte man auch eine Stute in ‚Pension‘ geben. Da wurde sie täglich, während sie rossig war, einem Hengst vorgeführt. Doch war das ziemlich teuer. Wir besuchten, als wir wieder in der Stadt waren, den ‚Harras‘, das Gestüt, um die Hengste zu sehen, die zur Auswahl standen, die Preise zu erfahren und die Tage, an denen der LKW unser Tal abfuhr. Das Gebäude lag am Stadtrand. Von weitem schon roch es süßlich nach Pferd. Das Innere bestand aus einer großen, mit Sägemehl ausgestreuten Halle, deren Flügel mit etlichen hochwandigen Boxen ausgestattet waren. Auf der einen Seite ‚wohnten‘ die Hengste, wunderschöne, stolze Tiere, erregt schnaubend oder in den verschiedensten Tonlagen wiehernd. Eine Tafel an der Wand zeigte Namen, Rasse und ihre Daten an. Auf der anderen Seite waren die Pensionäre, also die zu deckenden Stuten untergebracht.
In der Halle befanden sich verschiedene, fast pferderückenhohe hölzerne Barrieren, die sehr solide aussahen, eine davon wie ein Gang angelegt. Gerade führte ein Pferdehalter seine Stute vor. Sie war ziemlich erregt. Er führte sie auf Anweisung in den Gang und hielt sie kurz. Ein Angestellter des Gestütes, in Uniform, brachte einen Hengst herbei. Dieser tänzelte erregt, schnaubte, sicher aus Vorfreude, während er sich seitlich der zwischen den Wänden stehenden Stute näherte. Er schnupperte am Hinterteil der Stute und legte seinen Kopf auf ihren Rücken. Schneller, als wir schauen konnten, hatte die Stute ihr Hinterteil erhoben und drohend wiehernd ausgekeilt! Empört zog sich der Hengst zurück. War wohl nichts. „Warte ab, bis zum nächsten Mal!“, schien er zu denken. Entweder war die Stute trächtig, oder noch nicht richtig rossig, was sich alle 21 bis 23 Tage wiederholt. Die Rosse selber, also die Periode, in der sie aufnehmen kann, dauert 5 bis 7 Tage. Es heißt, gegen Ende dieser Zeit nimmt sie besser auf.
Die Stute wurde weggeführt, eine andere nahm ihren Platz zwischen den Bretterwänden ein. Der Hengst machte wieder seine Annäherungsversuche. Nichts geschah. Also führte der Pferdehalter seine Stute vor eine der einfachen Barrieren und stellte sich dahinter, die Stute kurzgehalten. Der Hengst näherte sich, ungeduldig an der Longe zerrend, sein ‚Teil‘ schon halb ausgefahren. Und schon hob er seine Masse von fast einer Tonne vorne in die Höhe und lehnte sich auf die Stute, während sein enormer, gefleckter Penis ungeduldig sein Ziel suchte. Ein anderer Uniformierter näherte sich von der Seite, ergriff den Schwanz der Stute und half dem Pfeil ins Ziel. Haben Stiere es beim Decken eilig, so nimmt sich ein Hengst Zeit. Einmal drinnen, bewegt er sich langsam und rhythmisch, fast wie um möglichst spät zum Höhepunkt zu kommen! Dann schlafft er schier in sich zusammen und bleibt wie erschöpft auf dem Rücken seiner Geliebten liegen. Langsam lässt er sich zurückrutschen, sein noch zuckendes Glied wird frei und lässt einen Rest Sperma ablaufen, während die Stute regungslos und breitbeinig steht. Was für ein Schauspiel! Langsam folgt der Hengst dem Uniformierten zurück in seine Box.
Montags und donnerstags also kam der LKW in unser Tal. So gegen 15 Uhr, je nach Anzahl der Sprünge, die die Hengste zu absolvieren hatten. Je nach Bedarf befanden sich die entsprechenden Hengste im Fahrzeug. Mal war es der große LKW, meist aber der kleine, in den zwei Hengste passten. Hielt das Fahrzeug an, wurden sie gleich ungeduldig und schlugen mit den Hufen an die verstärkten Wände. Dann Rampe runter, Tür auf, und sie tänzelten rückwärts auf die Straße, oft ihr Glied schon in Erwartung des Kommenden ausgefahren. Sie mussten schier aufpassen, dass sie nicht darauf traten! Hier gab es keine Barrieren und der Mann vom Gestüt musste höllisch aufpassen, dass weder er einen Tritt abbekam, falls die Stute nicht in Rosse war, noch sein Zögling einen Huf auf die Nase erwischte! Deshalb hielt er das Seil lang und den Hengst anfangs auf Abstand. Auch ich musste verdammt aufpassen, hielt ich doch unsere Stute zurück, damit sie nicht vorwärts ging und den Hengst an seiner Pflicht hinderte. Über mir bäumte sich der Hengst in die Höhe, seine tellergroßen Hufe kamen mir ziemlich nahe. Das nahm sehr meine Aufmerksamkeit und Kraft in Anspruch. Doch insgeheim beneidete ich ihn, bestimmt auch die Umstehenden, denn die Passage des LKWs vom Gestüt verwandelte sich bisweilen in eine öffentliche Peep-Show, hier in den Tälern, wo kein Fernsehempfang möglich war…
Per Interrail kam Claudia, ein Mädel aus Lindau zu uns. Sie wollte 14 Tage lang helfen und etwas von Frankreich sehen. Zu Hause hatte sie zwei Pferde und konnte uns somit manches zeigen. Zusammen nahmen wir uns die Hufe unserer Calina vor, die trotz der Arbeit im Gelände weitergewachsen waren, und von den Rändern her leicht eingerissen. Wir kratzten das Innere des Hufes mit dem Hufkratzer sauber. Das sollte man ebenfalls vor und nach jedem Arbeiten machen. Mit Hammer und Hauklinge schnitten wir nun zuerst die Hornwand zurück, darauf bedacht, einen guten Standwinkel des Hufes zu erreichen. Calina ließ es sich gefallen, selbst die Hinterbeine gab sie gerne, da wir es oft genug mit ihr geprobt hatten. Das war alleine schon notwendig, wenn wir mit ihr arbeiteten und sie einen Fuß innerhalb der Zugketten gesetzt hatte. Es reichte zu sagen „donne le pied!“ und ihn leicht anzustoßen, und sie hob ihn hoch. Dann nahmen wir uns mit dem Rinnenmesser den Strahl vor, das pfeilförmige Innenteil des Hufes. Hier war das Horn weicher und ließ sich gut entfernen. Ein leichter Geruch von Horn lag in der Luft, der mich an die Besuche beim Hufschmied erinnerte, als ich Kind war. Wir zogen es vor, die etwas ausgefranste Schicht in dünnen Lagen abzutragen, um nicht zu tief zu geraten. Doch sah man an der Farbe der Hornschicht, wie weit man gehen konnte. Schienen feine Äderchen durch, war es Zeit, aufzuhören. Das Pferd ließ alles willig mit sich geschehen. Ab und zu, vor allem, wenn wir uns an den Hinterhufen zu schaffen machten, hielten ihr die Kinder ein Stück Brot vor die suchenden, samtigen Lippen. Um ihre Geduld nicht zu sehr zu strapazieren, machten wir alles in zwei Arbeitsgängen. So konnte sie sich inzwischen etwas erholen (und wir unsere Rücken ebenfalls). Am meisten roch es, wenn wir um den Strahl herum schnitten. Dort war es etwas feucht, aber der Huf war gesund. Das Fohlen Claudius nervte in der Zeit etwas um uns herum, drängte uns von der Mutter weg, um zu trinken. Es wurde uns klar, dass wir es bald entwöhnen mussten, denn im Herbst, zum großen Pferdemarkt, sollte es spätestens weg. Am Schluss strichen wir ein paar Mal mit der Feile über die Fläche der Hufe und rundeten leicht die Kanten, von oben kommend, ab. Als alles geschehen war und Calina auf dem Flachen stand, gingen wir nochmal um sie herum. Alle vier Hufe standen gleichmäßig!
In der freien Zeit trampte unsere Bekannte durch die Täler, stieg mit Doris und den Kindern auf ein paar Berge und hatte eine gute Zeit. Bis auf ein Mal. Doch das erfuhr ich erst später und nicht von ihr. Da versuchte der Fahrer, sich an sie ran zu machen. Als sie in ihrer Bedrängnis sagte: „Das werd ich dem Wolfi sagen!“, ließ er von ihr ab, entschuldigte sich sogar bei ihr und fuhr sie bis ins Dorf. Sie musste ihm dafür versprechen, mir nichts zu sagen. Ich erfuhr es später von Doris.
Während Claudia da war, fuhren wir eines Morgens früh los zum Mittelmeer zum Baden. Die Kühe und Ziegen hatten so wenig Milch, dass man das Melken mal auslassen konnte. Im Dunkeln brachen wir auf. Als wir nach St. Girons kamen, dämmerte es. Die Kinder wollten vor lauter Aufregung nicht mehr schlafen. Über Foix und Lavelanet kamen wir nach Quillan, von wo aus die Straße durch eine wilde Schlucht einem grünen Fluss folgt. Auf der gegenüberliegenden Seite, fast nur in Tunneln, verlief eine Bahnlinie. Das erinnerte uns stark an Persien. Und dann lag das Meer vor uns, eine in der Sonne glitzernde, endlose blaue Weite. Die Kinder rannten gleich los, dass es nur noch so spritzte. Also wir hinterher! Das war der krasse Gegensatz zu unserem grünen Tal! Später, als es wärmer wurde, bauten wir aus einer Decke und den Hütestöcken, die immer im Auto lagen, einen Sonnenschutz. Ich war der erste, der einschlief. So anstrengend war das Nichtstun nach so langer Arbeitszeit! Schweren Herzens brachen wir am Spätnachmittag wieder auf, mit dem festen Vorsatz, bald wiederzukommen!
Je näher wir unserem Hof kamen, desto mehr traten die Sorgen um die Tiere wieder in den Vordergrund. Hoffentlich waren sie nicht abgehauen! Als wir hochliefen, war es schon dämmerig. Wir sahen sie nicht, wir hörten sie nicht. Als wir vorm Haus waren, hörten wir sie im Stall. Ich leuchtete mit der Taschenlampe rein. Wie sah es da aus! Kühe und Ziegen liefen durcheinander, eine Kuh hatte einen Heuballen am Horn hängen, der Futtersack der Hühner war zerrissen, die Körner lagen umher. Ein paar Ziegen kletterten auf den an der Rückwand gestapelten Heuballen herum, hier und da knabbernd. Da kam Claudia zu uns, die uns hatte kommen hören. „Die standen alle am Zaun und haben mich so bettelnd angeschaut. Da hab ich sie reingelassen!“, erklärte sie. „Das war gut, aber du hättest die Kühe anbinden müssen und die Ziegen in ihr Gehege sperren! Wenn alle so zusammen sind, können sie sich leicht verletzen. Zum Glück waren sie zu sehr damit beschäftigt, die Futterreserven nieder zu machen!“
Es war anscheinend gerade Besuchszeit bei uns. Einer der Besetzer des ‚Blumenhäuschens‘ in Rehlings (siehe: ‚Grün ist das Leben‘) stand plötzlich und unverhofft da. Er wollte nach Marokko und hatte gedacht, uns mit einem Besuch eine Freude zu machen. Und um uns etwas zu helfen. „Oh Schreck!“, dachte ich, „ein Stadtfreak! Was kann man den denn machen lassen?“ Gut, etwas Gartenarbeit würde er noch überleben, vor allem nachdem er erst spät am Vormittag aus dem Bett gekrabbelt war. Doch draußen herrschte schon die Mittagshitze! Gut, etwas Stallmisten, da ist er im Schatten. Doch er musste sich erst mal gründlich erholen nach dem Stress der Stadt! Denn in die Stadt waren sie alle zurückgekehrt, als man sie endgültig rausgeworfen hatte, um das Haus abzureißen. In der Stadt konnte man besser überleben als auf dem Land! Nur selten mal früh aufstehen, eigentlich nur, wenn es galt, vorm Aldi oder anderen Läden das zu nehmen, was man zum Leben brauchte. Da lohnt es sich schon mal, den Wecker zu stellen, oder besser noch, nach einer durchfeierten Nacht dort vorbeizugehen! „Da gibt es bessere Sachen als das schmutzige Gemüse aus eurem Garten!“ Doris und ich waren uns einig: Es wurde Zeit, dass der das Weite suchte! Doch er hatte es sich wohl anders überlegt, er fing an zu rechnen: „Wie lange seid ihr schon hier?“, wollte er wissen. „Bald ein halbes Jahr!“, erwiderte ich. „Hmm…, das macht so zwanzig Wochen. Ich habe jetzt eine Woche hier gearbeitet, also steht mir schon ein Zwanzigstel von eurem Hof zu! Ich bin gewissermaßen Mitbesitzer geworden!“ Jetzt reichte es uns: „Eine Woche, hatten wir ausgemacht, kannst du hierbleiben! Jetzt mach mal ‘ne Fliege!“ In Deutschland Hausbesetzer, in Frankreich erst Hofbesetzer und jetzt noch Hofbesitzer!
Wo auch immer wir gingen, wir hatten einen Stock dabei. Die schönsten besaßen die Kinder, verziert mit Ringen in der Rinde oder Schlangenlinien. Unsere, vor allem meiner, waren ‚Gebrauchsstöcke‘, und somit einem Verschleiß unterworfen. Haselnusstriebe boten sich durch ihren geraden Wuchs geradezu dafür an, aber auch Esche. Ein Stock und das Taschenmesser waren sozusagen die Grundausrüstung eines Schäfers. Bei vielen kam noch der ‚Caporal‘ dazu, dieser stinkende, bröselige Tabak und die Papierchen ohne Kleber. Ich verstand nie ganz, warum viele ‚Neos‘, wie man uns nannte, Raucher waren. Selbst für einen Joint war der Tabak zu herb! Wie konnte man diese reine Luft, die uns umgab, verpesten? War das, weil die meisten Stadtlungen besaßen, die ihren täglichen Anteil an Verschmutzung brauchten? Oder war das, um den Einheimischen ähnlich zu sein? Gut, ich rauchte auch manchmal mit. Das konnte etwas sehr Geselliges sein! Vor allem in einem Bistro, denn wenn man selber rauchte empfand man die umgebende Luft nicht mehr so ätzend! Der Stock half beim Laufen an den steilen Hängen. „Der Stock ist der verlängerte Arm des Hirten!“, heißt es. Manchmal war er auch der ferngesteuerte Arm des Bauern, wenn man ihn durch die Luft warf, um ein Tier zum Umdrehen zu bewegen. Und so manch einer ging zu Bruch, wenn die Tiere den Zorn des Bauern entfacht hatten… An Gelegenheiten mangelte es nicht! Ein unerwarteter Fußtritt gegen das Schienbein, ein Tritt gegen den halbvollen Melkeimer, der diesen durch den Stall fliegen ließ. Oder eine Kuh stellte ihren Fuß da hinein und weigerte sich, ihn wieder hinaus zu nehmen! Alltäglicher war ein Schlenker mit dem saftigen Schwanz ins Gesicht. Diesen konnte man am Bein festbinden. Brigit Bardot, wäre sie in manchen Momenten vorbeigekommen, hätte unsere Tiere abtransportieren lassen und in einen Streichelzoo gesperrt, mitsamt ihren Robben-Babys!
Langsam merkten wir, dass man Tiere auf zweierlei Weise ‚dressieren‘ kann: Mit ‚Zuckerbrot‘ und ‚Peitsche‘, mit einem ‚Leckerli‘ (Getreide, Mehl, Salz) und mit dem Stock. Dazu kommt noch die Stimme. Je nach Tonfall merkt ein Tier, was anliegt. Die Tiere müssen einen als Chef der Herde anerkennen. Müssen Respekt haben, aber keine Angst. Ein ängstliches Tier kann gefährlich sein, weil es sich anders verhält als üblich. Haben sie Respekt vor dir, reicht oft ein Ruf und sie hören mit ihrer Provokation auf. Manchmal muss man sie ‚korrigieren‘, wie man hier einen Stockschlag umschreibt. Pünktlichkeit ist auch wichtig. Denn ein Tier hat seinen Rhythmus; mal frisst es, mal käut es wieder. Durch die Melk- und Fütterzeiten kann man diesen regeln und sollte ihn dann beibehalten. Es gab für uns noch mehr zu lernen als für die Kühe!