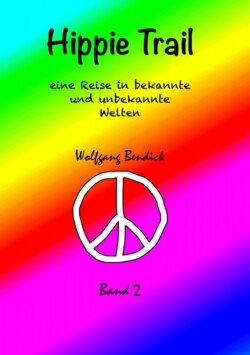Читать книгу HIPPIE TRAIL - BAND 2 - Wolfgang Bendick - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
MILES FROM NOWHERE
ОглавлениеSeit Tagen war der Horizont nur eine fast unbestimmte Linie gewesen, wo das Blau des Himmels sich in das Blau des Meeres verwandelte. Seit ein paar Stunden schien es, als würde diese Linie klarer werden, ein dünnes Band, ein Streifen. „Land in Sicht!“ schallte es von der Brücke. Die Passagiere gesellten sich an Deck. Sie schirmten die Augen mit der Hand ab, um in dem hellen Sonnenlicht genauer sehen zu können: Australien! Das Land, wo alles auf dem Kopf steht, hatte man mir als Kind erzählt. Zum Glück besaßen wir schon einen Globus, den man abends sogar beleuchten konnte. So konnte ich mir anschaulich machen, dass da zwar alle auf dem Kopf standen, aber trotzdem mit den Füßen auf der Erde! Wenn meine Mutter vom Einkaufen zurückkam, brachte sie manchmal Sammelbilder mit. Die waren fast so groß wie Ansichtskarten, glänzten und rochen eigen-artig. Ich dachte, dass sei der Geruch des Landes, aber es war nur der der Druckfarben. Diese Bilder waren so bunt, die Sonnenaufgänge so fantastisch, die Tiere so komisch, dass ich mich nicht satt sehen konnte und sie an die Wände hing. Die Bilder anderer Länder tauschte ich mit Freunden gegen deren Bilder von Australien ein. Ich war gespannt darauf, ob die Sonnenaufgänge und -Unter-gänge wirklich so bunt waren wie auf den Bildern! Doch im Augenblick ist alles eher grau, nur ein beiger Streifen, der langsam näherkommt, Wüste. Das hatte ich mir fast gedacht! Überall auf der Erde findet man auf der Südhalbkugel Wüstengebiete an der Westküste der Kontinente. Ich bringe das mit den Passatwinden in Zusammenhang. Inzwischen sind die letzten Passagiere an Deck gekommen, wir stehen alle an Backbordseite, um das Land zu begrüßen. Für die meisten die alte Heimat, für ein paar wenige, wie mich, die neue. Australien, so groß wie die USA, aber nur so viel Bewohner wie London… Je Quadratkilometer macht das nicht ganz 2 Personen, in Deutschland hingegen 245!
Die ‚Australasia‘ macht fest. Vor einem großen Schuppen, wohl der Zollabfertigungshalle. Auf deren Dach weht die australische Flagge: auf blauem Grund das Kreuz des Südens, im oberen Eck der Union Jack, die Farben Englands. Für eine Weile tut sich nichts. Erst muss das Schiff einklariert werden. Vor allem die Gesundheitspapiere werden überprüft. In einem Merk-blatt hatte ich gelesen, dass jegliche Einfuhr von Leder, Pflanzen, tierischen Produkten, Nahrungsmitteln, kurz alles verboten ist. „Die werden uns noch die Gürtel ab-nehmen und die Schnürsenkel!“ motzt John. Dann dürfen wir an Land. Für die Altaustralier ist die Prozedur kürzer. Wir Einwanderer müssen in eine extra Halle. Und dort sind sie gründlich! Zuerst Visumkontrolle und Eintragen der Landungsdaten. „Do you have money?“ ich zeige stolz meine 55 Dollar. Doch das sind US Dollar. Der australische ist aber mehr wert! Umgerechnet komme ich nur auf 48 australische. Sie beraten. Okay!
Ich habe nur die Turnhose an. Da kann ich nicht viel verstecken. Außer den Familienjuwelen. Aber unterm Hemd! Brustbeutel ausleeren! Ist aus Leder. Schuhe ausziehen. Nichts drin versteckt? Leder, ist verboten! Sie sind dermaßen auf meine Schuhe konzentriert, schon vorher, in allen Ländern. Was haben die denn besonderes? Aber ich kann doch nicht barfuß gehen auf den heißen Straßen. Keep them! John ist schon längst durch die Immigration durch und wartet draußen auf mich. Ich bin noch am Rucksack auspacken. Bestimmt kommt das von den Stempeln in meinem Pass, denke ich. Dann kann auch ich weiter. Eigenartig, das Auffälligste an mir, den Hut mit der Schlangenhaut, haben sie gar nicht bemerkt. Den habe ich noch nicht mal abzunehmen brauchen! Die Cartwrights hängen auch fest. Sie müssen erst ihr Fahrzeug desinfizieren lassen, sonst dürfen sie nicht damit fahren. Das aber ist deren Wohnung. Hoffentlich können sie diese Nacht darin schlafen! John lädt mich zu einem Bier ein. Ich gebe ihm die 50 Dollar zurück. Er lässt mir eine Adresse in Perth, der Hauptstadt Westaustraliens, nicht weit von hier, wo ich ihn erreichen kann. Er will da als Tellerwäscher arbeiten. Ich bleibe lieber in Fremantle. Das ist eine kleine Stadt, mir sympathischer.
Dann stehe ich allein auf der breiten Straße. Ich komme mir vor wie ein Cowboy in einem Western. Allein! Die Häuser sind niedrig, meist nur Erdgeschoss oder noch eine Etage drauf. Viele sind aus Holz und haben falsche Fassaden. Die paar Autos fahren alle links. Menschen sind wenige unterwegs. Klar, bei dieser Bevölkerungs-dichte tritt man sich nicht auf die Füße, höchstens man stolpert über seine eigenen. Da kommt jemand. Ich spreche ihn an. „Cheap Hotel?“ Er brummelt irgendwas und weist in eine Richtung. Was ist denn das für ein Kauderwelsch? Frage ich mich, ich dachte, hier spricht man Englisch! Ich laufe in die gewiesene Richtung und stehe bald vor einem weißen Holzgebäude: „Hotel“. Ich steige die paar Holzstufen hinauf und frage nach dem Preis. Fast wirft es mich um! 43 Dollar die Woche. Mein Geld reicht also noch nicht einmal für eine Nacht! Der Hotelmensch kennt anscheinend mein Problem. Ich bekomme den Eindruck, dass hier nicht jeder die Taschen voller Geld hat. Er meint, in meinem Fall wäre ein Boarding-House das Einzige. Und er weist mir die Richtung dorthin. Boarding-House klingt ziemlich nach Bordell-Haus. Sollte es mir hier so gehen, wie auf Penang? Und diese Sprache! Das muss schon was mit Englisch zu tun haben, aber völlig falsch betont! Ich komme mir vor wie ein Preuße in Bayern: Ich muss genau die Gestik beobachten und den Rest dazudenken. Zum Glück hängt ein Schild über dem besagten Haus. Als ich ankomme, bin ich etwas beruhigt. Wenn Bordell, dann eher Männerbordell. Denn ich begegne nur Männern in dem nach Bohnerwachs riechendem Holzhaus. „Ein Zimmer? 40 $ die Woche.“ „What? Aber man hatte mir gesagt, ein Boarding House sei billiger als ein Hotel!“ „Ist es ja auch! Die Zimmer sind aber viel größer, 4 Betten, 6 Betten. Come on!“ er klopft an eine Tür. „Come in!“ Wir gehen hinein. Drinnen sitzen 4 stoppelhaarige und stoppelbärtige Männer, schon etwas ergraut, in Turnhose und Unterhemd. Es ist sehr heiß im Raum. Vor zwei Fernsehern schauen sie die verschiede-nen Nachmittagsprogramme an. „There is a mate looking for a room!“ Mate musste also Mann heißen. Sie schauen mich an. In schlechtem Englisch fragen sie, wo ich denn herkomme. Ich sage „Germany!“ Ihre Minen hellen sich auf. Sie sind aus Ungarn, Polen und der Tschechos-lowakei. Wir verständigen uns also in Deutsch, welches sie besser beherrschen als Englisch. Sie suchen auch nach Arbeit, wie ich. Sie haben das Zimmer zusammen gemietet. Für 40 $ die Woche. Das macht 10 $ pro Kopf. Mit mir sinkt der Preis auf 8 $. Ich bin also ein willkommener Gast. Ich ziehe meine letzten Dollar heraus und will eine Anzahlung lassen. Doch der Wirt winkt nur ab und meint, ich solle erst mal schauen, dass ich Arbeit bekomme, dann reden wir über das Bezahlen. Das ist eine vernünftige Einstellung! Ich investiere also in ein paar Flaschen Bier als Einstand.
Ich bin froh, untergekommen zu sein. Sie stellen erst mal viele Fragen, wie es in Europa aussehe, die Politik usw. Ich sage ihnen, dass für das erste Mal die SPD dran sei mit Willy Brand als Bundeskanzler, und sich die Situation mit dem Osten bestimmt bald entspannen würde. Sie sind schon 6, beziehungsweise 8 Jahre in Australien, da darf schon etwas Heimweh aufkommen! Was mich aber interessiert ist, wie es hier mit Arbeit aussieht! „Du meinst wohl eher mit Arbeitslosigkeit!“ berichtigen sie mich. Seit Wochen schon sind sie ohne Arbeit. Und bald kommt der Sommer (Winter in Europa) mit der Regenzeit im Norden, wo viele Betriebe zumachen, und dann kommen noch mehr Arbeitslose nach Süden. Wer will schon im Sommer in den Tropen bleiben? Ich werfe ein, dass Australien in Europa für Einwanderer wirbt. Man hatte mir ein unbefristetes Einwanderungsvisum gegeben. Die Regierung würde doch nicht Arbeiter anwerben, wenn keine Arbeit wäre! „Das ist Politik. Politiker tun immer das Gegenteil von dem, was gut wäre…“ Es gibt ein Arbeitsamt, wo man sich registrieren lassen kann als Arbeitssuchender. Doch die würden nie Stellen haben. „Und Arbeitslosengeld?“ will ich wissen. „Das musst du dir selber auf die Seite legen, wenn du mal Arbeit hast. Manchmal gibt es schon gut bezahlte Jobs, aber nie für lange. Geh mal zur Einwanderungsbehörde in Perth. Normalerweise be-kommen Einwanderer Wohnung und Beihilfen. Versuchs mal, mehr als ein Nein kannst du nicht bekommen!“ trösten sie mich. „Es gibt auch noch private Arbeits-vermittler.“ Klären sie mich weiter auf. „Doch da musst du schon um 7 Uhr früh dastehen. Mit ein paar Tricks kannst du da Arbeit kriegen.“ „Mit Tricks Arbeit bekommen? Erkläre mir das mal genauer!“ „Das kann warten! Geh erst mal den offiziellen Weg... Prost“ Wir prosteten uns zu. „Prost Australien!“ Sage ich du hebe die Flasche. „Prost Europa!“ antworten sie und nehmen einen zweiten Zug. Zum Glück ist es nachts etwas kühler. So verbringe ich meine erste Nacht in der neuen Welt.
Am nächsten Morgen rührt es sich schon sehr früh im Boarding House. Es sind anscheinend nicht nur Arbeitslose in Australien. Ich schaue mir etwas genauer das Städtchen an. ‚Fish’n chips‘ Läden überall, viele Bars, ein paar Restaurants und ‚Clubs‘. Was sind Clubs frage ich später meine neuen Freunde. „Das sind geschlossene Gesellschaften, wo man sich trifft zum Kartenspielen, Tanzen, Trinken oder Anderem. Haupt-sächlich wohl zum Trinken. Man muss Mitglied sein.“ „Warum einen Trinkclub?“ will ich wissen. „Warte mal ab. Du wirst erstaunt sein! Hier machen die Kneipen schon um 22 Uhr zu, sonntags um 20 Uhr. Trostlose Verhältnisse!“ Je höher die Sonne steigt, desto wärmer wird es. Soweit noch normal. Doch je wärmer es wird, umso mehr umschwirren mich Fliegen. ‚Müsste mich nochmal duschen‘, denke ich, eine Dusche war wohl zu wenig, um den Geruch der Reise zu entfernen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite scheint mir jemand zuzuwinken. Aber die kenne ich doch gar nicht! Waren die vielleicht mit mir auf dem Schiff gewesen? Ich winke ihnen höflichkeitshalber zurück. Sie schauen mich erstaunt an. Doch ich scheine nicht der Einzige zu sein, der in einen Fliegenschwarm gehüllt ist. Eigentlich hält fast jeder eine gefaltete Zeitung oder etwas Anderes in der Hand und wedelt sich damit elegant Frischluft zu. Da geht mir plötzlich ein Licht auf: Die wedeln alle Fliegen weg! Diese sind regelrechte Mistviecher! Sie kriechen in die Ohren, die Nase. Das Übelste ist, wenn dir so ein dickes Ding in den Mund fliegt und auf dem Weg zur Lunge, Magen oder Arschloch in der Kehle stecken bleibt! Man sollte es machen wie die Jains in Indien und sich ein Tuch vor den Mund binden. Noch besser: sich eine afghanische Burkha überstülpen! Das wäre der Renner: Burkhas für Männer! Ich ahne plötzlich die ungeahnten Möglichkeiten, die hier meiner warten! Ich werde wohl nicht Schuhputzer, aber bestimmt Millionär, wenn ich weiterhin so großartige Ideen habe! Doch vorerst habe ich mal Rendezvous im Arbeitsamt.
„You just arrived?“ stellt das Fräulein fest. Soviel weiß ich auch selber. Ich suche Arbeit, versuche ich ihr klar zu machen. „Experience?“ „Construction, Sailor, Factory Worker, Road Construction, “ vertraue ich ihr an, „and I speak German and French!“ „You are pretty young, to have much experience!“ So intim wollte ich es gar nicht wissen. „Come back in a few days!“ Also kein Treffen am Abend, um meine mangelnde Erfahrung zur ver-vollkommnen! Wieder auf der Straße.
Ich suche eine Telefonzelle. Kein Buch darinnen. Erst in der dritten finde ich eines, es ist angekettet. Ich schreibe mir die Adresse der Einwanderungsbehörde raus und stelle mich an eine Bushaltestelle. ‚Perth‘ steht über dem Fahrer angeschrieben. Soll ich es wagen, schwarz zu fahren? Aber das ist hier unmöglich. Man steigt vorne beim Fahrer ein, meist auch aus, damit am Ausgang kein Schwarzfahrer einsteigen kann, und muss durch eine Art Drehkreuz. Auf einer Tabelle stehen die einzelnen Fahrpreise. Ich sage dem Fahrer, dass ich Arbeit suche und kein Geld habe. „Hast du denn wenigstens 20 Cents?“ fragt er. „Gerade noch!“ antworte ich. „Dann steck sie da rein und geh durch das Drehkreuz. Das ist der Preis bis zum nächsten Halt. Bleib einfach sitzen. Ich habe nichts gesehen!“ Nach guten 10 Kilometern gibt er mir ein Zeichen, und ich steige aus. Ich frage einen zeitungswedelnden Passanten. Hier in der Großstadt hat es noch mehr Fliegen als auf dem Land, stelle ich fest. Dann bin ich in der Behörde. „Haben sie einen Termin vereinbart?“ „Nein! Aber ich bin gestern in Fremantle angekommen, als Einwanderer, und möchte mit jemandem sprechen, unter anderem wegen Arbeit.“ „Da müssen sie zum Arbeitsamt!“ „Die haben mich aber hierher geschickt!“ erfinde ich schnell, „haben die nicht angerufen?“ „Moment, vielleicht ist irgendwo jemand frei!“ Bald sitze ich in einem halbdunklen Büro, der Ventilator auf dem Schreibtisch surrt. Mir gegenüber eine blasse, sommersprossige dickliche Frau, in den gleichen Farben gekleidet wie die Aktenordner, die sich auf ihrem Schreibtisch stapeln. ‚Ogottogott!‘ denke ich, von Irland auswandern, um in einem solchen Büro Akten zu lochen und wegzuhängen! „So you just arrived?“ „Yes, yesterday!“ „By which ship?“ „Australasia.“ Sie blättert eine Liste durch. Dieses Schiff steht nicht darin. „Did you come on assisted Passage?“ Was ist denn das nun wieder? Was muss ich darauf antworten, damit sie mich nicht gleich rausschickt? Ich sage ihr, dass ich mit dem Schiff von Singapur gekommen bin. Und bis Singapur? Na ja, so über Land. Den ganzen weiten Weg. Sie will meinen Pass sehen. Blättert Ordner durch. Und findet wirklich einen mich betreffenden Eintrag! Sie stellt klar, wenn ich auf Kosten der australischen Regierung mit Schiff oder Flugzeug hergekommen wäre, hätte ich Anspruch auf Wohnung und Essen in einem Auffanglager und auf finanzielle Unterstützung. Auffanglager? Das klingt für mich wie Einfanglager. Nein danke! Ich erkläre ihr, dass ich, durch mein Selberkommen der Regierung ja eine Menge Geld gespart hätte. Es müsse doch die Möglichkeit einer Starthilfe geben! Leider nicht. Dazu sind die karitativen Verbände zuständig, wie die Heilsarmee. Aber ich könne ja jederzeit wieder ausreisen, wenn ich keine Arbeit finde, das können diejenigen, die mit ‚assisted passage‘ gekommen sind, nicht. Die müssen 6 Jahre im Land bleiben oder der Regierung die Einwanderungskosten zurückerstatten. Das ist der Preis der Freiheit. „Deren Freiheit!“ bemerke ich, „und meine?“ „Sie können ja jederzeit wieder gehen!“ „Aber ich bin doch nicht gekommen um wieder zu gehen! Ich bin gekommen, um was zu arbeiten! Haben Sie nicht irgendeine Idee?“ Sie kaut an ihrem Kugelschreiber. Überlegt sie, ob sie mich als ihren Gärtner anstellen soll, als Haushaltshilfe, oder gar als Vater ihrer zukünftigen Kinder? Nichts dergleichen! Dann sieht man es ihr an: „I have an idea!“ Und sie wählt eine Telefonnummer. „Whats your adress?“ ich gebe sie ihr, plant sie ein Rendezvous? „Okay, that‘s good, I will tell him!“ und legt aufatmend auf. Sie hat gerade mit einer Bekannten telefoniert, die Deutschlehrerin ist. Wenn einer ihrer Schüler Nachhilfe bräuchte, würde die mich im Hotel anrufen…“ 20 Cents und eine halbe Stunde später bin ich wieder in Fremantle.
Zum Glück habe ich noch meinen Benzinkocher und kann so für meine osteuropäischen Zimmerkollegen das Essen kochen, um nicht ganz unnütz zu sein. Das ist zwar nicht erlaubt. Aber wie können wir sonst über-leben? Zudem fängt das Elektrizitätswerk an zu streiken. Die ganze Stadt lebt mit Kerzenlicht. Die Kollegen reiben sich die Hände. Was denn daran so schön sei? „Vor vier Jahren war es ähnlich. Über zwei Monate kein Strom! Wir sind mit den Gewehren aufs Land und haben uns Rinder geschossen. Wenn du wüsstest, wie toll das war!“ „Was kann denn daran toll sein?“ „Die Stimmung! Wir campten draußen, die Feuer loderten, die Städter kamen zu uns heraus zum Essen. Man machte Musik, man tanzte, man teilte!“ „Und die Cops?“ „Anfangs machten die Ärger. Aber am Ende war jeder froh, dass er was zum Essen hatte! Sie hatten sogar den Auftrag, uns beim Besorgen der Rinder zur Hand zu gehen, zumindest die Farmer auf Abstand zu halten.“ Aber so weit waren wir noch nicht! Noch gab es Kerzen zu kaufen, wenn auch die Spirituskocher und bald auch der Spiritus ausverkauft waren. Ich berichtete von meinem Besuch im Amt. Das brachte sie zum Lachen. „Die sollten damit aufhören, Einwanderer anzuwerben!“ sagte ich. „Die wollen Einwanderer mit Geld. Keine armen Schlucker wie uns. Einwanderer, die Geld haben, geben das aus. Sie öffnen Geschäfte, gründen Unternehmen. Und das bringt der Regierung wieder Steuern und andere Einnahmen. Wir sind nur die Lückenfüller. Wenn die Wirtschaft gut läuft, sind wir gefragt. Wenn Flaute ist, vergisst man uns. Wir kosten dem Staat nichts.“
Am nächsten Tag will ich es trotzdem versuchen, bei einem dieser privaten Arbeitsvermittler. Am Abend ist Casting, wie beim Film. Ich muss mich mitten ins Zimmer stellen. „Dreh dich mal um! Stopp, warte! Krempel die Ärmel hoch. Ja, gut. Und nimm den blöden Hut ab. Hier, nimm meine Kappe. Bisschen schräger. Gut! Moment!“ Einer holt einen Handhaken, so einen, wie am Arm von Kapitän Hook, in Peter Pan. Ich soll ihn über die Schulter hängen. „Wozu dient denn so ein Ding?“ „Zum Wollballen anheben und manipulieren. Dafür bist du zwar noch ein bisschen zu schwach auf der Brust. Die wiegen so 200 Kilo. Aber Wolle gibt es im Moment sowieso keine. Siehst aber gut aus!“ „Ja aber 200 Kilo…“ „Mach dir mal keine Sorgen, die nehmen dich sowieso nicht! Und außerdem tust du die ja nicht heben, sondern nur kippen, um eine Sackkarre unterzuschieben. Solange ein Ballen hochkant steht, ist er leicht zu handhaben. Weißt du, du musst erfahren aussehen. Und wenn man dich fragt, du hast schon alles gemacht! Zeig mal deine Hände. Scheiße, keine Schwielen, keine Narben. Das wird schon noch kommen! Die alte Hose passt gut. Eine Zigarette im Mund könnte auch nicht schaden.“ Und so geht die Modenschau weiter bei Kerzenlicht und Bier. Das Fernsehen geht nicht ohne Strom. Somit haben sie Zeit, mir ein erfahrenes Aussehen zu geben. „Aber du bräuchtest dickere Arme. Behaarte, tätowiert.!“ „Mal langsam, bin doch nicht Supermann!“ „Und vergiss nicht, lüge denen die Hucke voll! Du hast alles schon hundert Mal gemacht. Du hast Experience!“ „Aber die sehen doch in meinen Papieren, dass ich gerade erst angekommen bin!“ „Du erzählst denen, du hast drei Wollsaisons in Deutschland mitgemacht!“ „Da gibt es aber keine Schafe!“ „Das wissen die doch nicht!“
In der Früh sind sie alle auf, um mir noch den letzten Schliff zu geben. „Und vergiss nicht, du kannst alles. Immer Ja sagen! Los, hau ab, vielleicht klappt’s!“ Ich beeilte mich, zum Treffpunkt zu kommen. Der war am Stadtrand, an einer Bushaltestelle. Es waren schon an die 20 Männer da, meist bullige Typen, Zigarette im Mundwinkel, manche mit einem Boxerleibchen beklei-det, nur Muskeln und Haare. Ein Minibus fuhr vor. Daran sah ich, dass nicht mehr als 8 Personen Arbeit finden würden. Der Fahrer stieg aus, musterte die jetzt fast schweigsame Versammlung. In der Hand hielt er eine Liste und einen Schreiber. „Drei Leute Gelände-reinigung! Wer kennt sich aus?“ Alle hoben lässig die Hand. Mir fiel dabei fast der Haken von der Schulter. Er zeigte mit dem Schreiber auf drei Personen. „Namen?“ Er schrieb sie auf, während einer nach dem anderen einstig. „Ausweis!“ Sie gaben ihm diese. Er steckte sie in die Gesäßtasche seiner Jeans. „5 Maurer für Erd-arbeiten!“ Wieder die gleiche Prozedur. „Einsteigen!“ Dann fuhr er los. Die Insassen grinsten uns hämisch durch die Fenster zu. Neue Arbeitssuchende kamen zum Treffpunkt, manche stellten sich einfach davor. Aber das störte groß niemanden, denn jedem war klar, es war der Chef, der aussuchte, die Reihenordnung galt nicht. Es kamen noch drei Minibusse vorgefahren. Am Ende blieben so 10 Leute übrig, darunter auch ich. Einer schaute auf die Uhr. „Das war’s wohl für heute!“ Und die meisten gingen davon. Ein paar, darunter auch ich, verharrten noch eine Weile am Treffpunkt. Weniger, weil wir noch auf unser Glück warteten, sondern mehr, um den Tag auszufüllen. Wir tauschten Erfahrungen aus, gaben uns gegenseitig Tipps oder Adressen. Jetzt, wo die Auswahl vorbei war, gab es keinen Neid oder Eifersucht mehr. Not macht gleich!
Ich schlenderte zurück zum Boarding-House. Sie dösten auf ihren Betten. Ohne Fernsehen war der Tag lang. Die Vorhänge waren halb zugezogen. So hatte es wenigstens keine Fliegen, weil die zum Hellen des offenen Fensters hinflogen. „Und?“ „Was und? Ihr seht doch, ich bin wieder da! So an die10 Leute sind übrig geblieben.“ Ich nahm meine Angel und ging zum Hafen. Dort setzte ich mich in den Schatten eines Kranes auf die Pier und versuchte abwechselnd Brot, Würmer und dicke Fliegen als Köder. Das Wasser fiel langsam mit der Ebbe ab und legte den Miesmuschelbewuchs an den Dalben frei, doch nicht die Fische. Die hatten sich anscheinend in tiefere, kühlere Schichten zurückgezogen. Ich beobachtete die anderen Angler. Ihnen ging es wie mir. Am Nächsten Tag versuchte ich nochmals mein Glück auf dem Arbeitsmarkt. Diesmal blieben 2/3 auf der Strecke. Jetzt verstand ich, warum meine Kumpel trotz ihrem wenigen Geld in der Lotterie spielten. Da waren die Chancen zu gewinnen grösser als bei der Jobsuche! Am Nachmittag kam auch der Strom zurück. Hatte die Gewerkschaft ihr Ziel erreicht, oder war es wegen des anstehenden Wochenendes, dass die Stromleute Konflikt mit ihren Frauen vermeiden wollten?
Mein erster Sonntag in Australien stand bevor. Ich stand früh auf und wollte in die Stadt. Die anderen sahen noch nicht einmal fern. „Kommt ihr mit? Es ist Sonntag!“ „Nichts Schlimmeres als ein Sonntag in Australien!“ Ich wunderte mich darüber. Am Vorabend hatten sie darauf bestanden, dass ich 5 $ annehme, als Leihgabe, damit ich mal ausgehen könnte. Ich wollte erst nicht annehmen, doch wollte sie auch nicht beleidigen. Aber ich war total pleite. Ich zog los. Die Straßen waren fast leer. Ein paar Frauen in Lockenwicklern und rosa oder hellblauen Morgenmänteln führten ihr Hündchen Pippi. Die Kneipen waren alle zu. Frühschoppen war hier unbekannt. Ich ging zum Hafen. Dort ruhte aller Betrieb. Hier sah ich die Männer. Sie saßen meist in Grüppchen, unterhielten sich und badeten ihre Regenwürmer. Wohl um daheim nicht im Wege zu stehen. Langsam wachten die Fliegen auf. Von den anglikanischen Kirchtürmen klangen die Glocken. Kinder in Schuluniform strömten dort hin. Nach der Messe hatten sie noch Sonntagsschule. Entsetzlich! Mittags endlich machten die Kneipen auf, und die Männer konnten ein erstes Bier trinken. Keine einzige Frau war in den Kneipen zu sehen. Meine Freunde klärten mich auf: In Australien dürfen Frauen nicht in Gaststätten gehen! Dann setzte ich mich etwas in den Park. Mancher der anderen Parksitzer hatte neben sich auf dem Boden eine Packpapiertüte, die er manchmal an den Mund setzte. Ich fühlte mich nach Indien versetzt: englische Trinkkultur! Heute sah ich auch zum ersten Mal die schwarzen Ureinwohner dieses Landes. Hinter einem Gebüsch des Parks saßen sie in einer Gruppe. Kohlschwarze, gedrungene Gestalten, manche bärtig, mit krausen, meist gelb-fahlen Haaren. Komisch, verstecken die sich da? Neugierig ging ich etwas näher. Einer winkte mir zu. Oder verjagte er nur die Fliegen? Nein, er muss wohl gewunken haben, denn von den Fliegen ließen sie sich anscheinend nicht stören. Diese krabbelten auf ihnen herum. Einer hob eine Flasche und prostete mir zu. Oder wollte er sie mir anbieten? Sie war nicht in einer Tüte. Denn es handelte sich nicht um Bier. Ich war entsetzt, es war Brennspiritus, wie ihn auch meine Kollegen benutzten. Doch diese beheizten damit ihre Kocher!
Nach Mittag ging ich in einen der ‚Fish’n Chips‘ Läden. Für 50 oder 70 Cents gab es dort ein Stück panierten Fisch, in Öl gebacken und die dazu gehörige Tüte Pommes, gesalzen oder mit Essig berieselt. Ich bevorzugte sie mit Essig. Arme Leute Nahrung! Doch schmeckte ganz gut. Ich glaube, halb Australien ernährt sich so. Viele der Fischlädeninhaber waren spanische Basken. Oder, genauer gesagt, Basken, die aus Spanien ausgewandert waren. Wie die englischen Iren. Hat man schon mal irische Engländer gesehen? Überall auf der Welt wandert man aus. Oft nicht, um dem Elend zu entgehen, sondern politischer oder religiöser Verfolgung. Langsam wurde mir klar, dass ich nicht der einzige Einwanderer war, die ganze Stadt bestand aus Einwanderern. Ich war gewohnt, dass einer stolz war, Deutscher oder Österreicher zu sein, das war hier drittrangig. Hier war man stolz darauf, Einwanderer zu sein, und Australier. Nachmittags belebten sich die Straßen etwas. Die Kinder hatten ihre Sonntagsschule absolviert und begaben sich zu ‚Cleo’s‘. Das war die einzige Diskothek der Stadt. Ein Club. Dort war bis 18 Uhr Teenagerprogramm. Cat Stevens war auch hier Mode. Leise drangen die Klänge bis auf die Straße. „Miles from nowhere, I guess I’ll take my time, oh yeah, to reach there… Lord my body has been a good friend, but I won’t need it, when I reach the end…“ Bis 20 Uhr war der Laden dann dicht, und dann öffnete er erneut, diesmal für die über 18-jährigen. Ich saß gegenüber in einer Kneipe beim Bier. Ein paar Kinder reicher Eltern drehten mit quietschenden Reifen ein paar Runden in ihren glänzenden Schlitten. Alles scharte sich um sie. Man wartete, dass der Club aufmachte. In der Bar, wo ich saß, rief der Barmann „Time, Gentlemen, Please!“ Das war das Zeichen, dass nichts mehr serviert wurde, jeder austrinken sollte und gehen. Jetzt ging mir auf, warum manche Gäste sich kurz zuvor ein oder mehrere ‚Midis‘ bestellt hatten und vor sich aufgereiht. Nicht, weil sie Freunde erwarteten! Ein Polizist kam herein und stellte sich ans Tresenende. Er bekam ein Bier vorgestellt, bevor er es bestellte. Die vorher laute Unterhaltung brach ab. Der Bulle schlürfte genüsslich an seinem Glas und legte der Bedienung die Hand auf das Hinterteil. Alle anderen schütteten ihr Bier hinunter und verließen den Schuppen. Der Polizist bestellte ein weiteres Bier und schäkerte mit der Bedienung. Er war ja dienstlich hier, um das Einhalten des Gesetzes zu überwachen. Ich stand draußen und staunte. 20 Uhr Sperrstunde. In Deutschland würde sowas zu einem Regierungsumsturz führen! Um viertel nach acht war ich zurück bei den Kumpels. Sie hatten die Fernseher nebeneinander gestellt und schauten zwei Programme gleichzeitig. Das war weniger langweilig. „Na, gut amüsiert?“ „Pustekuchen!“
Am Montagmorgen wieder zur Bushaltestelle. Langsam kannten wir uns alle. In der Regel waren es immer dieselben, die genommen wurden. Es geschah, dass der ‚Chef‘ die Muskeln der Neuen abtastete, bevor er die Auswahl traf. Selbst mein Handhaken machte die fehlenden Muskeln nicht wett. Über Geld wurde so gut wie nie geredet. Manchmal sagte einer, was er woanders verdient hatte. Aber nicht bei diesem ‚Chef‘. Keiner wollte sich bloßstellen oder mit dem ‚Chef‘ verderben. Man musste das nehmen, was man bekam. Es kam vor, dass jemand vom Vortagsjob erzählte, vor allem, wenn etwas anders lief als normal, wenn sie Freibier bekamen, oder ein gutes Essen, oder die Arbeit so wenig war, dass sie Mühe hatten, bis zum Feierabend den Eindruck größter Beschäftigung zu erwecken. Denn die Arbeiter wurden vom ‚Chef‘ an den Baustellen, oft auch bei Privatleuten abgesetzt, und abends wieder abgeholt und bezahlt. Nachher schaute ich wieder im Arbeitsamt vorbei.
Am Mittwoch war mir ‚Maloche‘, die Göttin der Arbeit hold! Vielleicht hatte die Tussi im Arbeitsamt nur Mitleid mit mir oder hielt mich für seriös. Vielleicht war das auch nur, weil jeder den Job nach einem Tag wieder hingeschmissen hatte. Aber das erfuhr ich erst später. Bei Dunlop jedenfalls suchten sie einen Arbeiter! Erfahrung nicht notwendig. Anfangen sofort, das heißt morgen früh um acht. Genau das Richtige für mich. Ich konnte meinen Handhaken also wieder zurückgeben. Der Lohn? 43 $ netto die Woche, das macht bei 40 Stunden Arbeitszeit 1 $ nochwas pro Stunde. Rund 4 Mark. So langsam, wie man das verdient, kann man es gar nicht vertrinken!
Ich ließ meine Kumpel schlafen und ging zur Bushaltestelle. Dieses Mal aber eine andere. Es waren noch nicht mal 10 Minuten Fahrtzeit. Oft machte ich das zu Fuß. Aber nicht die ersten Tage, da war ich zu groggy. Es war ein riesiges Werk. In gelben Großbuchstaben stand der Name der Fabrik auf einer der Hallen. Überall in der Umgebung roch es nach heißem Gummi. Ich wurde in der Runderneuerungsabteilung eingesetzt. Die Anderen arbeiteten alle im Akkord, ich im Stundenlohn. Die Anderen gaben die Geschwindigkeit an, ich musste mithalten. Es war schon heiß draußen. Wie war es erst hier drinnen? Als glühend konnte man das schlecht bezeichnen. In den riesigen Hallen war die Luft von Dampf und Gummistaub geschwängert wie eine Frau nach 270 Tagen. Und dieser Lärm! Manche trugen Ohrenstöpsel. Ich tat sie wieder raus, sonst kam mir der Schweiß aus der Nase. Außerdem musste man sich ja auch verständigen können. Man schrie sich an oder machte sich mit Gestik verständlich. Die schon abgefrästen Reifen, also ohne Profil, kamen bei mir an. Ich musste sie sortieren. Anfangs musste ich noch auf jedem ablesen, welche Größe er hatte. Bald sah ich auf einem Blick, wo er hingehörte. In jeden der Reifen musste ich serienweise zuerst einen aus dickem Gummi bestehenden Schlauch einlegen. Dieser war vom vorigen Gebrauch noch glühend heiß, soweit man das bei Gummi sagen kann. Dann setzte ich in den Reifen 4 bis 6 mondsichelartig geformte, gewölbte Aluminiumguss-stücke, die dann einen geschlossenen Ring bildeten, wie eine im Reifen liegende Felge. Diese schloss den Schlauch gewissermaßen ein. Der so ausgestattete Reifen ging dann zu einem Kollegen, der ihn drehbar einspannte, und mit einem dicken Gummistreifen belegte, den er von riesigen Rollen mit verschiedenen Breiten abwickelte. Dann wanderte er in eine an Dampfleitungen angeschlossene, aufklappbare Form, die innen ein Profilmuster besaß, worin er dann eine Weile unter Hochdruck und Hochtemperatur blieb. Diese Formen gab es mit allen gängigen Profilen, also auch Michelin oder Kleber. Darin wurde der Reifen regelrecht gekocht. Zu Anfang hatte ich nur zwei Kollegen zu versorgen, später dann drei. Wenn alle Formen gefüllt und angeschlossen waren, fingen die an, den ersten wieder heraus zu nehmen: Zuerst also den heißen Dampf ablassen, den Reifen aus der Form wuchten und zu mir rollen oder werfen, je nach der Größe des sich vor mir häufenden Reifenberges. Ich musste dann jeden einzeln auf eine Kante schlagen, damit sich der Aluring im Inneren öffnete, dann dessen einzelne Teile daraus entfernen, dann den Schlauch und erneut in andere einbauen. Und dasselbe immer wieder und immer schneller. Es war zwar 2 x 15 Minuten Pause vorgesehen, aber wie sollte das gehen, wo doch immer gerade was am Kochen war oder rausgenommen werden musste? Und die Kollegen arbeiteten nach Stückzahl! Da auch sie der neuen Religion angehörten, die daran glaubte, dass Zeit Geld sei, und nicht ein Augenblick der Ewigkeit, verzichteten sie lieber auf die Pause. Es gab einen Eiswasserhahn nicht weit vom Arbeitsplatz, das war unsere einzige Erholung. Mittags war dann eine Stunde Pause, die gerade reichte, zu einem Fischimbiss zu gehen und zurück, und zwischendrin schnell die Mahlzeit zu verschlingen. Die einzige Erholung war, wenn mal eine Maschine kurzzeitig ausfiel! Dann fluchten die Akkordler, weil sie nichts verdienten. Anfangs spürte ich nur Erschöpfung und Muskelschmerzen. Nach einer Woche fühlte ich sowas wie Stolz. Darüber, so eine harte Arbeit unter solchen Bedingungen zu machen und darüber, den Freunden und dem Wirt das schuldige Geld geben zu können.
Ich hatte Brandblasen an den Händen, Quetschstellen an den Fingerkuppen und bald den Dreh raus, so dass ich mit den drei Kollegen eine Zigarette rauchen konnte, weil alle Formen voll waren und die Kochdauer eingehalten werden musste. Der Zigarettenrauch ließ uns den Gummigestank für eine kurze Weile vergessen. Nach drei Wochen bekam ich drei Dollar Lohnerhöhung. Die Stimmung in unserer Hallenecke wurde lockerer, man schrie sich Witze zu, die man vor lauter Lärm nur halb verstand aber dafür doppelt so laut belachte. Wir fanden sogar noch die Zeit, denen in den anderen Abteilungen kleine Streiche zu spielen, wie das Werkzeug, was sie rechts von sich abgelegt hatten, im Vorbeigehen auf die linke Seite zu legen. Wir versteckten uns dann und lachten uns halb tot, wenn wir sahen, wie sie nach dem Werkzeug tasteten und es nicht fanden, und sich dann am Kopf kratzten und sich überlegten, ob sie nicht urlaubsreif wären... Nach der Arbeit zusammen zwei, drei Bier in der Stehkneipe, das war unser größtes Vergnügen, bevor jeder sich ziemlich erledigt auf dem Heimweg machte. Es gab Tage, da übertrafen wir den Rekord von drei Tagen zuvor. Das wurde an einer Tafel angeschrieben und vor lauter Stolz darüber knüppelten wir noch mehr.
Zum Glück arbeitete ich in der PKW-Reifenabteilung. Ich bemitleidete das arme Schwein, das meinen Job in der LKW Abteilung machte. Aber der hatte Arme so dick wie meine Beine. Am gigantischsten war die Abteilung, die die Reifen der Minen-LKW reparierte oder die der Schaufellader. Diese Reifen hatten bis zu drei Meter Außendurchmesser und man musste zum Arbeiten hineinsteigen. Der Arbeiter, der diese reparierte, war nochmal eine Nummer dicker. Er passte gerade in die Reifen. Für diese Reifen hatten wir keine Formen. Sie wurden in Amerika hergestellt. Um sie rundzuerneuern, wurden die Profilreste mit Handfräsen entfernt, und dann Stück für Stück die einzelnen Profilstollen aufgehämmert und einzeln erhitzt. Oft waren sie von Steinen durchstochen, die manchmal noch darin steckten. Hier ging alles mit dicken Vorschlaghämmern vonstatten. Erst den Stein zerschlagen, ausfräsen und dann neue Gewebebahnen einlegen, anschlagen und vulkanisieren. Bei den frisch angelieferten Reifen war Vorsicht geboten. Ich dachte erst, die Kollegen machen einen Witz, als sie mir ein winziges rotes Spinnchen in einem der Reifen zeigten. Ein ‚Redback Spider‘. Dessen Biss ist tödlich.
So vergingen die Wochen. Ich konnte die Miete zahlen, mal eine Runde schmeißen und schaffte es sogar, ein wenig von meinem Lohn zu sparen. Ich rechnete aus: wenn ich weiter so sparsam lebte und weiterhin so viel auf die Seite legte, könnte ich mir in sechs Jahren die Rückfahrt nach Deutschland bezahlen! Vielleicht war so die Sechs-Jahre-Regelung für die mit Regierungsunter-stützung eingereisten Einwanderer entstanden? Inzwi-schen kannte ich Fremantle und Umgebung auswendig. Ich besuchte den botanischen Garten in Perth, wo es noch mehr Fliegen gab als in der Stadt. Ich besuchte auch John, der als Tellerwäscher jobbte. Er klagte, dass es in Australien kein Gras gebe. Zumindest er keines bekäme. Jedes Mal, wenn er junge Leute deswegen anspricht, denken die, er ist ein Bulle. Keiner kann sich vorstellen, dass man in diesem Alter auch raucht! Er erzählte mir auch, warum die Königin von England überall so beliebt ist. Jeder, an dem sie in ihrem Rolls Royce vorbeifährt, denkt, sie winke ihm zu. Das sei aber gar nicht der Fall. Durch ihre häufigen Besuche in Australien ist sie so sehr daran gewöhnt, die Fliegen wegzujagen, dass sie das auch woanders nicht lassen kann!
Es war die erste Woche im Oktober. Überall verkündeten Anschläge, dass in Perth am nächsten Sonntag ‚Oktoberfest‘ sei. Die Australier brauchten nicht mehr nach München zu fliegen, das Oktoberfest kam zu ihnen! Und da es in München in der letzten Septemberwoche abgehalten wird, kann der australische Jet Set es sogar zwei Mal feiern! Sogar der Münchener Bürgermeister käme, der Stellvertretene zumindest, der andere befand sich nach den Wies‘n Strapazen auf einer Schrotkur. Und es gäbe Münchener Bier, den echten Löwenbräu! Seit ich in Australien bin, habe ich erkannt, dass hier Bier das Nationalgetränk ist. Sie halten sich sogar für die Weltmeister im Bierkonsum. Dass die Münchener dasselbe von sich behaupten, empfinden sie als eine Anmaßung. Denen würden sie es zeigen! Was die Münchener in einer Woche zusammensaufen, würden sie in einem Tag schaffen!
Ein solch kulturelles Ereignis wollte ich mir nicht entgehen lassen! Ich hatte mich früh genug auf den Weg gemacht, um auch nichts zu verpassen. Ich trampte. Zufällig fuhren die Insassen des Autos, das bald anhielt, auch dorthin. Es schien, als ob alle Autos dorthin fuhren. Und von überall her. Auf dem Parkplatz sah ich auch Fahrzeuge von anderen Bundesstaaten. Ich hatte bisher nicht gewusst, dass die Australier so viel für Kultur übrig haben! Das Ganze sollte in einem Sportstadion statt-finden. Ohne Bierzelt, unter freiem Himmel. Regnen tut es in Perth eigentlich nie. Vielleicht einmal alle fünf Jahre. Die Vorbereitungen waren fast abgeschlossen. Mittags sollte es losgehen. Überall stiegen Rauchsäulen in den makellosen Himmel. Die Australier sind die Meister des BBQ, des Barbecues, des Grillfleisches. Ich fühlte mich etwas an Benares erinnert. Ganze Ochsen drehten auf Spießen, Hammel, Schweine, Hähnchen. Hier würde bald dem Bacchus geopfert werden, dem Gott der Trinker und Esser. Priester in von Blut befleckten Metzgerschürzen vollzogen ernsthaft und genau das Ritual. Auch anderes Essbares wurde vorbereitet, Tische standen in langen Reihen bereit, mit Bänken auf jeder Seite, um die vom Trinken ermüdeten Esser zu verköstigen. Ein paar Planen waren gespannt, um Schatten zu spenden. In einem Eck des Stadions war sogar ein Karussell und Schaukeln für die Kinder. Man hatte wirklich an alles gedacht. Sogar die Toiletten und Umkleideräume waren dem Anlass entsprechend umgerüstet worden! Alle Spiegel waren abgebaut worden. Alle Türen waren entfernt. Also freier Zutritt zum Abtritt! Damit die auf die auf die Bierflut folgende Urinflut auch bewältigt werden konnte, waren an den Wasserhähnen Schläuche angeschlossen, aus denen Wasser über die gefliesten Fußböden lief. Dieses sollte den aus Dringlichkeit auch anderswo abgelassenen Urin den Gullis zuführen. Denn diese Räumlichkeiten waren dazu gemacht, zwei Mannschaften aufzunehmen und nicht tausende von akuter Inkontinenz befallene Besucher eines kulturellen Ereignisses! Aber so weit sind wir noch nicht.
Im Moment hielt der Bürgermeister von Perth eine Rede. Vor lauter Danksagungen wollte diese kein Ende nehmen. Dann der Stellvertretende Bürgermeister von München. Auf Münchnerisch natürlich. Diese musste übersetzt werden und dauerte dadurch doppelt so lange. Aber es hörte sowieso niemand zu. Bei dem Lärm waren selbst die Lautsprecher nicht zu verstehen. Dann endlich wurde angezapft. Auf einem Podest, allen sichtbar, hielt der Münchner Schulze den Hahn, und der aus Perth schlug mit dem Holzhammer zu. Der Schaum spritzte, das Volk jubelte, die mitgereiste Blaskapelle spielte einen Tusch. Doch der erlesene Importgerstensaft aus dem Fasserl war für ein paar Auserwählte bestimmt, die ihn auch zu schätzen wussten, wie die zwei Bürger-meister, der Bayrische Konsul, der Vertreter von BMW und wer sich sonst noch auf die Blau-Weiß geschmückte Bühne geschummelt hatte. Wir, das Volk, bekamen Flaschenbier. Export. Anderes hätte sich gar nicht so lange gehalten. Die Stimmung steigt. Die Bierverkäufer können gar nicht so schnell entkorken wie die Flaschen leer sind. Der Australier ist ein Schnelltrinker. Bei den herrschenden Temperaturen muss er das sein. Sonst verdunstet ihm das Bier in der Flasche. Und außerdem ist heute Sonntag. Da ist um 20 Uhr Sperrstunde, dann, wenn es gerade richtig gemütlich werden würde! Und außerdem spielt da auch etwas Nationalstolz eine Rolle. Es geht ja darum, den Sauerkrautköpfen zu zeigen, dass man pro Kopf und Tag mehr zu trinken fähig ist, als die antipodische Konkurrenz!
Es ist heiß. Doch selbst die erhöhte Transpiration reicht nicht aus, den Flüssigkeitsüberschuss zu eliminieren. Man hätte Starkbier nehmen müssen, Dreifachbock. Oder Vierfachbock. Dann wäre man der nun folgenden sanitären Situation vielleicht Herr geworden. Anfangs stand man noch Schlange vor den entfernten Türen. Dann ließ Mann Wasser auch in den Umkleidekabinen. Dafür war ja vorgesorgt worden. Trotzdem wurde der Andrang immer grösser, die Warteschlange wuchs. Um die Wartezeit zu überbrücken, nahmen viele ihre Flasche mit zu den Toiletten. Doch die Flaschen waren schneller geleert als die Blase. Nach der Devise: oben rein, unten raus! Nur, was machen mit den leeren Flaschen? Australier sind keine Flaschenhamster wie wir. Pfandflasche unbekannt. Man stellt sie wo ab oder wirft sie in eine Ecke. Erste Scherben. Angezogen durch den Geruch, oder um ihren eigenen Bedürfnissen nachzukommen, näherten sich die Fliegen. Diese summten durch den Raum. Manche setzten sich wo ab. Man schlug nach ihnen. Jemand warf eine Flasche nach ihnen. Andere Flaschen folgten. Johlend machte man sich auf Fliegenjagd. Waren bisher Kotze, Kot und Pinkel vorherrschend, so verwandelten sich jetzt die Umkleidekabinen in ein einziges Scherbenmeer. Nur die Prüdesten wagten sich noch da hinein, die anderen erledigten ihre Dringlichkeiten außen um die Gebäude herum oder entleerten ihre berstenden Blasen an den Absperrungen.
Fast wäre es zu einer Katastrophe gekommen, denn gegen 19 Uhr ging das Münchener Bier zuende. Gerade noch rechtzeitig konnte australisches herangeschafft werden. Das Fest konnte weitergehen. Eine australische Blaskapelle hatte die Münchener schon seit einer Weile abgelöst und spielte einheimische Weisen, die die meisten mitsangen. Niemand hatte einen Blick zum Himmel geworfen, noch den grummelnden Donner wahrgenommen. Man machte sich daran, einen Vorrat an vollen Flaschen anzulegen, denn die Sperrstunde nahte. Und plötzlich erbrachen sich außer den Trinkern auch die Wolken, die Blitze zuckten, man flüchtete sich unter die Planen, die vom Winde weggeblasen wurden. Jeder schnappte sich das ihm Liebste, die Männer die Flaschen, die Frauen ihre Männer oder die Kinder, und hastete so gut man noch konnte, zu den Autos. Sozusagen eine Räumung des Platzes unter Wasserwerfern. Bei diesen Feierlichkeiten hatte ich auch ein paar junge Australier kennen gelernt, so in meinem Alter. Wir hatten bei ein paar Bier über Reisen und Europa gesprochen. Sie fühlten sich auf ihrem Inselkontinent ziemlich eingeengt. Nirgends konnten sie hin. Rundum nur Wasser, anders als in Europa, wo einem doch ganz Asien und Afrika vor der Tür lagen. Sie nahmen mich am Abend mit zurück nach Fremantle.
Die Arbeit war anstrengend. Langsam bildete sich an meinen Händen eine hitzebeständige Hornhaut. Die Lohnerhöhung war zwar gering, aber umgerechnet auf ein Jahr machte das fast einen Monatslohn aus! Aber so lange würde ich das nicht machen. Meine Zimmer-genossen kannten inzwischen alle Fernsehsendungen auswendig und waren dabei, das Stereo-Fernsehen zu erfinden. Sie hatten die zwei Apparate bei gleichem Programm nebeneinander gestellt, so mit einem Meter Abstand. Vor die Nase hielten sie den Rücken einer leicht geöffneten Zeitung und schielten an der vorbei auf den ablaufenden Film. Ich fand das Ergebnis nicht überragend, aber sie hatten ja Zeit und würden schon noch Fortschritte bei ihrer Erfindung machen. Ich selber fand Fernsehen sowieso blöd und zog mir nachts die Decke über den Kopf.
Bei meinen wochenendlichen Wanderungen hatte ich in Richtung Arbeitsplatz ein Schild „Room to let“ gesehen. Da bräuchte ich keinen Bus mehr zu nehmen. Und das würde mir das teurere Zimmer bezahlen! Ich klopfte an. Der Eigentümer, ein älterer Mann, zeigte mir seine umgebaute Garage und erzählte mir etwas von seiner geringen Rente. Er gefiel mir nicht, aber dafür die Behausung: klein, aber fein und bald mein! Das Zimmer kostete 15 $ die Woche. Ich ließ ihm eine Anzahlung. Zum nächsten Wochenende beglich ich meine Rechnung in der alten Bleibe, trank ein Abschiedsglas mit den Kumpels und lief zu meiner neuen Garage.
Ich legte mich erst mal auf das Doppelbett in der Mitte und genoss es richtig, allein zu sein! Vor allem, ohne die dauernden Fernseher! Dann setzte ich mich auf das Sofa und las ein wenig. Mit dem Schrank darin, dem Tisch und den zwei Stühlen, war es fast etwas eng. Aber ich konnte verstehen, dass der alte Mann seinen Krempel wo hinstellen musste. Ich pflückte an einem immergrünen Strauch ein paar Zweige mit Blüten und steckte sie in eine Vase. Wenn es drinnen zu eng war, konnte ich mich draußen in den großen Garten setzen. Doch dort hockte mir meist der Vermieter auf der Pelle und laberte mir die Hucke voll. Fast wären mir die Fernseher lieber gewesen, die liefen einem wenigstens nicht nach. Aber die meiste Zeit war ich sowieso auswärts beim Arbeiten. Den Schlüssel legte ich, auf Anraten des Vermieters, unter die Regentonne, die ja leer war. Da könnte ich ihn wenigstens nicht verlieren. Denn so ein Schlüssel kostet ja immerhin Geld! Nur hatte ich bald den Eindruck, dass der Schlüssel nicht mehr an derselben Stelle unterm Fass lag, wenn ich ihn suchte! Ich wurde misstrauisch, selbst wenn ich im Zimmer nichts feststellen konnte.
Nach der zweiten Woche, ich hatte mit den Kollegen von Dunlop noch ein Bier getrunken oder zwei, kam ich so gegen Sperrstunde, zurück. Ich tastete nach dem Schlüssel. Nichts. Ich war sicher, ihn dort zurückgelassen zu haben! Ich klopfte also den Alten heraus. Er hatte ihn genommen, weil da zwei junge Burschen gewesen waren, die ein Zimmer suchten. Nette Burschen, und er kann ja nicht nein sagen, will ihnen helfen, hat mir ja auch geholfen, usw. Sie hätten schon ihre Sachen im Zimmer abgestellt, morgen würden sie den Rest bringen und einziehen. Ich war stocksauer. Ich sagte ihm, dass ich das Zimmer alleine gemietet hatte, und außerdem ist ja auch nur ein Bett da. Ja, aber man müsse den jungen Leuten doch helfen, und ein Bett kann man ja auch teilen, ich könne auch bei ihm schlafen, wenn es mir mit den Zweien zu eng wird… Ich schob ihn hinaus. Als erstes räumte ich mein Bett frei und stopfte den Kram der Anderen in eine Ecke. Ich packte meinen Rucksack und legte mich erst mal schlafen. Am nächste Morgen schrieb ich einen Brief an meine Nachfolger, in dem ich sie vor dem Typen warnte, den ich für einen Schnüffler und Gauner hielt und sicher für schwul, nach seinem gestrigen Angebot. Diesen legte ich unter die Bettdecke. Dann nahm ich meine wenigen Sachen, sperrte ab und nahm den Schlüssel mit. Ich ging zum Hafen. Dort warf ich erst mal den Schlüssel ins Wasser, dann meine Angelschnur und dachte nach. Kein Fisch störte mich in meinen Gedanken. Bald trafen auch die anderen Angler ein. Jeder schien seinen Stammplatz zu haben. Ich fing natürlich nichts. Auch die anderen saßen nur da, ohne sich zu bewegen, starrten auf ihren Schwimmer und dachten bestimmt: Immer noch besser als zu Hause!
Später, gegen Mittag, holte ich mir bei meinem Basken eine Portion Fisch und Pommes. Ich fragte ihn, wo sein Fisch denn herkomme. Ich hatte in all der Zeit noch keinen gesehen. Er meinte, es seien hauptsächlich japa-nische Fischerboote, die Fremantle anliefen und mit Fisch versorgten. Wir unterhielten uns eine Weile. Seine Frau und die Kinder kamen dazu. Am Wochenende war wenig los. Aber den Laden schlossen sie nie. ‚Man muss da sein, wenn der Kunde da ist‘, war ihr Wahlspruch. Sie kannten ein Boarding-House nicht weit vom Hafen. Die Zimmer lagen im ersten Stock über einer Kneipe. Das war eigentlich gar nicht störend, bei den Sperrstunden hier. Ich hatte dort auch schon manchmal ein Bier getrunken. Der Wirt kannte mich etwas. Das Zimmer war so klein wie auf einem Schiff. Zweimal so groß wie das Bett. Es waren nur drei oder vier Zimmer vermietet, die anderen zehn standen leer. In einem langen Gang reihte sich auf beiden Seiten Tür an Tür. Toiletten und Duschen befanden sich an beiden Enden des Ganges, der ebenso nach Bohnerwachs roch wie die anderen Boarding- Häusern. Ich wählte ein Zimmer auf der Hofseite, wegen des Straßenlärmes. Der Preis war 12 $. Ich quartierte mich ein. Unten konnte man auch günstig essen. Ich leistete mir heute diesen kleinen Luxus, es war schließlich Wochenende. Den Sonntagnachmittag ver-brachte ich meistens irgendwo im Hafen beim Angeln. In den ganzen sechs Wochen fing ich keinen einzigen Fisch. Ich erinnere mich nicht, je einen Angler gesehen zu haben, der einen aus dem Wasser zog! Wenn man Fisch wollte, brauchte man ja nur zum Fischhändler zu gehen. Angeln tut man vielleicht wegen des Alleinseins. Der Fisch ist nur ein Vorwand. Ich hatte meist mein kleines Transistorradio dabei. Der neueste Hit war ‚Mamy blues‘: „Je suis parti un soir d’été, sans dire un mot, sans t‘ embrasser, sans un regard sur le passée, oh mamy, oh mamy mamy…“ Meine Abfahrt kam mir in die Erinnerung zurück, die Tränen meiner Mutter. Jetzt war ich es, dem sie in die Augen stiegen. Ich dachte an sie und wusste, dass sie jetzt auch an mich dachte! Immer.! Ich war so traurig und irgendwie auch glücklich zugleich. Als das Lied zuende war, machte ich das Radio aus und summte die Melodie weiter und ließ die Tränen laufen. Jetzt konnte ich mich getrost dem Heimweh hingeben, ohne mir untreu zu werden. Denn plötzlich wurde mir bewusst, ich hatte den halben Weg hinter mir! Jetzt war Voraus zugleich auch Zurück. Heimweh und Fernweh hatten dieselbe Richtung angenommen!
Ich wollte bald weiter. Wenn es eine Zukunft gab, dann bestimmt nicht hier in diesem Nest, das sogar von den Fischen verlassen war! Im Radio kam es, die lokale Zeitung hatte es als Titelgeschichte: ‚Diamantenfund in alter Goldmine!‘ Und Fotos von dem Stein. Ein faustgroßes Ding, der zweitgrößte der Welt, nach dem Cullinan! Ich schaute auf meine Straßenkarte. Das lag ja genau auf meiner Route nach Darwin im Norden! Es gab zwei Routen: die Inlandroute und die Küstenstraße. Der Stein war an der Inlandroute gefunden worden. Ich begann, mir eine Ausrüstung zu besorgen. Läden gab es ja genügend, die so was anboten. Immer wenn Arbeits-losigkeit herrschte, machten diese ihr großes Geschäft, oder nach Berichten wie diesem. Meine Ausrüstung musste leicht sein und klein. Ich wollte ja per Anhalter und zu Fuß weiter. Ich kaufte also einen Klappspaten, eine Goldwaschpfanne, ein Sieb und einen eine Gallone (~5 Liter) fassenden Wassersack aus Segeltuch. Dazu einen leichten Schlafsack, denn die Nächte konnten kalt sein.
Die einer flachen Schüssel ähnliche Goldpfanne benutzte ich ab sofort als Bratpfanne. Ich hatte es satt immer nur Suppen zu essen, denn ich besaß nur einen Kochtopf. Ich bereitete mir mal wieder richtige Bratkartoffeln und Fleisch statt dauernd nur Fisch und Chips. Oft, meist an den Wochenenden, kochte ich mein Essen selber. Das war zwar laut Hausordnung verboten, aber eigentlich tat es jeder, sei es nur in der Früh einen Kaffee. Manche Schlauberger hatten das mit Tauchsiedern oder Elektro-platten versucht. Mit dem Ergebnis, dass die Wirtsleute dahinter kamen, weil dauernd die Sicherungen raus-flogen. Eines Sonntagsvormittags hatte ich ein schönes Steak in meiner Pfanne auf dem Benzinkocher, fast so groß wie diese selber. Ich ging nur schnell in den Waschraum, um Wasser für den Tee, das ich gleich nachher aufsetzen wollte, zu holen. Als ich durch den Flur zurückkam, roch es etwas angebrannt. Ich dachte, das kommt von unten, wo die Wirtin auch am Kochen war, es war ja Sonntag. Als ich die Tür aufmachte, schlug mir eine Rauchwolke entgegen und ich sah schwach durch diesen Nebel wie die Flammen auf meiner Goldwaschpfanne tanzten. Mist! Das spritzende Öl hatte Feuer gefangen und die ganze Pfanne brannte! Nur kein Wasser! Kam es mir in den Sinn. Ich schnappte also die Zudecke vom Bett, warf sie über das Ganze und hielt alles fest, bis ich sicher war, dass die Flammen erstickt waren. Vorsichtig tastete ich mich dann darunter, um die Benzinzufuhr abzudrehen. Schnell das Fenster voll auf und die Tür zu. Ich besah den Schaden. In der Zudecke klaffte ein schwarzes Loch, das deren Innereien, eine Art Filzflocken, freilegte. Das Steak hatte ebenfalls gelitten, war verkohlt und mit den Filzflocken paniert. Ich öffnete jetzt alle Fenster und Türen im Flur, damit der Rauch verschwinden konnte, und die Klotüren, um einen neutralen Geruch zu bekommen.
Mein Zimmernachbar hatte anscheinend auch etwas gerochen und kam auf den Flur. „Meinst du nicht auch, es riecht hier etwas angebrannt?“ „Etwas?“ sagte ich, „und angebrannt?“ und musste grinsen. „Viel und ver-brannt! Come and see!“ Und ich zeigte ihm den Schla-massel. Kein Mittagessen, die Bettdecke hinüber. Doch das Haus war gerettet. Ich fragte ihn, ob er wüsste, was so eine Decke kostet und der Bezug. Das müsste ich ja mindestens ersetzen. Ich muss mit den Wirten sprechen. „Bloß das nicht!“ meinte er, „dann wird keiner von uns mehr kochen können! Und die wollen ja, dass wir alle unten bei denen essen! Das müssen wir irgendwie anders hinkriegen!“ Aber wie? „Schau, da hinten neben dem Klo, das Zimmer ist immer frei. Die vermieten das nicht wegen dem Lärm. Wir müssen da reinkommen und die Decke austauschen!“ Wir versuchten es mit einem umgebogenen Dosenöffner. Doch wir hatten nicht das Talent von Dieben, nur das von Arbeitern. „Moment!“ Mir kam eine Idee. „Zwischen diesem Zimmer und dem meinem liegt nur ein anderes. Schauen wir mal, wie es draußen aussieht!“ Unterhalb, ungefähr in Fußboden-höhe, zog sich ein Mauersims entlang der ganzen Wand. „Mal sehen, ob ich da drauf laufen kann!“ Ich stieg hinaus und er hielt mich, damit ich kein Übergewicht bekäme. „Es könnte klappen!“ Ich presste mich flach gegen die Wand, hielt mich an der Öffnung meines Fensters fest, tastete dann nach der des nächsten und glitt langsam an der Wand bis zum letzten Fenster. Zum Glück waren dessen Flügel nur angelehnt, wohl zum Lüften. Ich drückte sie auf und stieg vorsichtig ein. Ich nahm die vollständige Zudecke vom oberen der Stockbetten über meine Schulter und machte mich vorsichtig auf den Rückweg. Ein kleiner Balanceakt, und er nahm mir die Sachen ab. Dann reichte er mir die verräucherte hinaus. Diesmal ging es schon besser. Vielleicht schlummerte in jedem von uns doch ein Einbrechertalent, das nur darauf wartet, geweckt zu werden! Im Zimmer dauerte es dafür etwas länger, musste doch alles so zusammengefaltet werden, dass man nichts sah. Außerdem sollte es ja auch gebügelt aussehen. Ich strich eine Weile darüber um es glatt zu bekommen. Dann raus, Fenster wieder angelehnt, Rück-weg. Er holte zwei Flaschen Bier als Mittagsessenersatz. Wir prosteten uns zu. Nochmal Glück gehabt! Nur- wie konnten wir den Rauchgeruch aus dem Flur beseitigen? Er hatte die Idee: „Wir machen alle Fenster zu, dann scheißt jeder auf einer Seite in das Klo, und wir lassen einfach die Türen auf.“
Ich hatte den Vorfall fast schon vergessen. Eines Abends klopfte es wild an alle Türen. Wir eilten heraus, dachten, es ist etwas passiert. Es war die Wirtin. Sie hielt im Arm die angekokelte Zudecke und wollte wissen, wer von uns hier fast Feuer gelegt hatte. „Feuer? Hier im Haus? Das ist ja entsetzlich!“ kam es aus uns heraus. „Und wo?“ Sie führte uns zum Zimmer neben dem Klo. „Das ist doch gar nicht möglich!“ sagte jemand, „das ist doch gar nicht belegt!“ Wir zwei mussten uns das Lachen zurückhalten. „Doch!“ rief die Wirtin und wedelte uns mit dem Lumpen vor der Nase. „Das müsste man doch gemerkt haben, zumindest gerochen!“ „Das kommt bestimmt vom Bügeleisen!“ Wütend zischte sie die Treppe hinunter.
Ich ging oft zum Hafen, auch nach Feierabend. Die Angel warf ich gar nicht mehr aus. Ich fühlte mich so einsam. Selbst die herrlichen Sonnenuntergänge über dem Meer bestärkten nur das Gefühl. Die Sterne waren mir näher als die Menschen. Klar, die Kneipen waren abends voll, und man konnte ewig diskutieren. Und noch ein Bier, bis die ganze Welt dein Freund war! Aber ab der Sperrstunde war die Einsamkeit die uneingeschränkte Herrscherin über Australien. Ein Brief von meiner Mutter traf ein. Mit 200 Mark darin. Hatte sie sich das vom Haushaltsgeld abgespart, oder steckte auch mein Vater dahinter? Er jedenfalls hatte die Adresse des katho-lischen Bischofs von Broome, im Nordwesten, auf meiner Route, beigelegt, der der Bruder eines Geschäfts-freundes war. Ich muss weg von hier! Es hieß, dass im Norden die ersten Regengüsse gefallen sein, bald würde die Regenzeit einsetzen. Die Straßen würden für Monate meterhoch unter Wasser liegen, und aller Verkehr unmöglich sein.