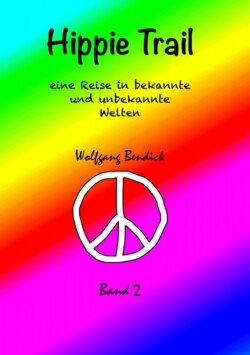Читать книгу HIPPIE TRAIL - BAND 2 - Wolfgang Bendick - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DAS VERGESSENE PARADIES
ОглавлениеVierundzwanzig Stunden später machten wir in George Town, einem Hafen auf der Insel Penang, nicht weit vom malaysischen Festland fest. Endstation. Hier trennten sich unsere Wege. John ging nach Kuala Lumpur. Er kannte dort einen Hotelier, wo er hoffte, etwas Jobben zu können. Hirohito ging in dem Menschengewühl verloren. Ich traf ihn nie wieder. Auf den ersten Blick unterschied sich Südost-Asien von Indien durch die anderen Rikschas. In Indien sitzen die Passagiere hinten, hier sitzen sie vorne. Gewissermaßen in einem lenkbaren großen Sessel, mit zwei Rädern seitlich daran. Der Fahrer sitzt also hinten, auf einem fast normalen Fahrrad-Hinterteil, das an dem Sessel beweglich angebracht ist. Zum Lenken dient ein großer Bügel, der hinter der Sofalehne befestigt ist. Daran befinden sich auch die Bremshebel, Klingel oder die Hupe mit Gummiball. Ich quartierte mich in einem billigen Hotel ein. Jemand, der kein Wort Englisch verstand, hatte mich hierher geführt. Ich kam mir vor wie in Japan. Die Innenwände waren aus Pappkarton. Andere Länder, andere seismische Normen, dachte ich. Ich ließ dort mein Gepäck und ging auf Erkundung und Nahrungssuche.
Der Stadt war eine Pfahlbausiedlung vorgelagert. Den Dutzenden hölzernen Lastkähnen und Lastseglern, die zwischen der Mole und den Pfahlbauten dümpelten nach zu schließen, wohnten hier deren Eigner und die Mannschaften mit ihren Familien. Manche dieser Stelzenhäuser waren unbewohnt und in schlechtem Zustand. Wahrscheinlich machte die Motorschifffahrt den Seglern die Existenz schwer. Viele Obdachlose oder Kriegsflüchtlinge aus Vietnam und den angrenzenden Ländern hatten sich hier einquartiert und führten ein ärmliches Dasein. Kinder spielten auf den die Häuser umgebenden Laufstegen Fangen und sprangen von da aus ins Wasser, bevor der Fänger sie erwischte. Für sie zumindest war hier das Paradies.
Die Stadt selber quoll über von Läden. Penang war Freihandelszone und fast jeder Bewohner schien das auszunutzen. Es ging eine Fähre zum nahen Festland, und wer sie nahm, musste zuerst durch den Zoll. In diesem Durcheinander von Läden aller Art fand ich auch eine ‚Travel Agency‘. Hier bestätigte man mir, dass das Schiff von Singapur nach Fremantle auf zwei Monate ausgebucht sei. Man empfahl mir, eher hier zu buchen. Für Singapur bekam man in der Regel nur ein eintägiges Transitvisum. Hier in Malaysia konnte ich ohne Visum drei Monate bleiben. Doch die Geschäftsführerin tröstete mich. Oft würden in letzter Minute Tickets gecancelt, also zurückgeben. Es bestünde eine Chance, früher wegzukommen. Ich hinterließ also dreißig Dollar als Anzahlung und meine Adresse im Aung Youn Hotel und versprach, bald wieder reinzuschauen, damit mir das Ticket nicht vor der Nase weggeschnappt würde!
Für meine Zukunft war also vorgesorgt. Jetzt wollte ich mich um meine Gegenwart kümmern. Und die hieß Essen. Ich kannte die Preise nicht, hatte gerade ein paar US Dollar in Malaysische Dollar umgetauscht, und ließ mich überraschen. Wenn ich die Bevölkerung auf den Straßen betrachte, könnte man sagen ¼ Inder, ¼ Chinesen, ½ Malaien. Vielleicht sind die Malaien ein Mischprodukt von beiden? Die indische Küche kenne ich. Also heute mal die chinesische! Ich betrachte die Schilder der Restaurants. Daran sieht man, welche Küche serviert wird. Oder man schaut auf den Koch. Und außer seiner Herkunft erkennt man an ihm auch die Güte seines Essens: je dicker der Koch, desto besser die Speisen! Man bringt mir die Speisekarte auf Englisch. Doch selbst die ist für mich wie Chinesisch. Ich kann mir nichts unter den Namen der Gerichte vorstellen. Also führt mich der Kellner in die Küche und ich zeige auf das, was ich gerne essen möchte, und der Koch bereitet mir einen gemischten Teller. Dazu Essstäbchen und einen großen Porzellanlöffel in Schiffchenform für die Suppe! Während ich auf mein Essen warte, schaue ich den anderen zu, wie sie die Stäbchen anfassen. Sie handhaben diese so geschickt, dass ich fast neidisch werde. Bei mir führte jedes Stäbchen sein Eigenleben. Langsam wurde dabei mein Essen kalt. Bei den anderen Gästen sah ich, dass sie, wenn nicht mehr viel in der Schüssel oder auf dem Teller verblieb, sie diesen vor den Mund hielten und den Rest mit den zwei Stäbchen nebeneinander in den Mund schoben. So machte ich es dann auch. Ich fing gewissermaßen mit dem Ende an. Ich war überrascht über die gute Zubereitung. Man schmeckte das, was man gerade aß. Die Gewürze dienten nur zur Geschmacks-hebung. Dazu ein kühles Bier, denn hier war Alkohol erlaubt. Und selbst die anwesenden Inder schienen mit dem Alkohol umgehen zu können. Als es ans Zahlen ging und ich umrechnete, stellte ich fest, dass hier die Preise doppelt so teuer waren wie in Indien. Das war gut zu wissen, für meine Kostenhochrechnung!
Ich schlenderte noch etwas durch die Straßen. Mir fielen überdachte Hallen auf. Darin wimmelte es um diese Zeit von weißgekleideten Kindern und Jugendlichen. Sie übten sich im Judo, was in Deutschland wenig bekannt war. Es war beeindruckend, zu sehen, wie kleine Knirpse andere packten und nach einer flinken Bewegung durch die Luft warfen und am Boden immobilisierten. Hier herrschte strenge Disziplin. Alle stellten sich in graden Reihen auf und grüßten den Lehrer mit einer tiefen Verbeugung. Und auch der Lehrer verbeugte sich vor ihnen! Und alle Kämpfer verbeugten sich voreinander vor dem Kampf und nachher, egal, wie der ausging. Sich in jeder Lage verteidigen zu können, fand ich als Grundidee sehr gut. Aber den gegenseitigen Respekt voreinander zu lernen, fand ich noch wichtiger! Und in jeder Lage fair zu bleiben, auch als Verlierer! Manchmal fanden diese Übungen im Freien statt. Überall waren die dazu notwendigen Matten vorhanden. Außer am Strand. Da genügte der Sand. Diese Übungshallen fand ich bis in Thailand. Ganz Süd-Ost-Asien scheint dem Judo zu frönen, wie bei uns man dem Fußball anhängt.
Dann zurück ins Hotel. Dieses hatte sich etwas belebt. Ich bemerkte, dass ein paar junge Mädchen herum-standen und miteinander oder mit den Gästen plauderten. Sie sahen wie Teenager aus, ziemlich jung und nach der Mini-Mode gekleidet. Wohl die Töchter der Wirts-familie, dachte ich, oder deren Freundinnen, oder Nichten, die aushalfen, wenn Not am Mann war. Alle begrüßten mich äußerst freundlich. Ich nickte zurück. Kannte ja kein Wort von deren Sprache. Als ich in meinem Zimmer ankam, bemerkte ich etwas, was ich vorher wohl übersehen hatte: in den Pappkartonwänden steckten Klopapierkügelchen, die wohl Löcher verschließen sollten. Hatte hier einer mit einem Schrotgewehr geschossen? Ich puhlte ein Loch frei und schaute hindurch. Ich sah genau in das Zimmer neben dem Meinen. Es war unbelegt. Ich stopfte das Loch wieder zu.
Unten erklang Lachen. Ich ging in den Flur und schaute hinunter. Ein paar Männer waren gerade angekommen, ohne Gepäck, und zahlten ihre Zimmer. Eilige Geschäftsreisende? Ein paar Mädchen gingen voraus, wohl um denen die Zimmer zu zeigen. Ich ging nach unten, trank ein Bier und schaute dem Treiben zu. Es war noch nicht sehr spät. Eines der Mädchen setzte sich zu mir. Ich dachte, sie wolle die üblichen Fragen stellen. Doch versteh mal wer Chinesisch! Sollte ich sie zu einem Bier einladen? Aber sie war ja noch ein Kind, obwohl sie gut proportioniert war. Was ist hier eigentlich die Altersgrenze, um Alkohol zu trinken? Dann ging ich in mein Zimmer um zu schlafen. Das Hotel kam nicht zur Ruhe. Die ganze Nacht über hörte ich Schritte, Lachen, Stöhnen, Türengeräusch. Ein ziemlich hellhöriges Hotel. Müsste mir bald ein anderes suchen, dachte ich mir und schlief dann endlich ein. Am nächsten Morgen bemerkte ich, dass Klopapierkügelchen auf meinem Bett lagen. Jemand hatte also von der anderen Seite die Löcher aufgemacht und mich zu beobachten versucht. Was geht hier eigentlich vor? fragte ich mich. Da ging mir ein Licht auf: Ich befand mich in einem Bordell! In einem Stundenhotel, wie man es auch nennen kann! Darum wohl auch das frisch bezogene Bett. Darum auch so billig. Die Beigabe erst machte den Preis! Ich hatte praktisch nur den leeren Teller gemietet, so, wie man in Italien das Gedeck bezahlt. Die Speise hatte ich verschmäht. Penang Duty-Free! Hier war alles käuflich und sogar die Liebe steuerfrei.
Ich blieb trotzdem noch zwei Tage im Hotel, weil ich dieses als meinen Wohnsitz in der Agentur angegeben hatte. Die Angestellte musste mich für einen Zuchthengst halten. Ich bin sicher, dass jeder im Ort das Bordell kannte. Und dann, am dritten Tag kam ein Anruf von der Agentur. Ich gleich hin! Zwei Tickets waren zurück-gegeben worden. Singapur hatte gleich die Agentur angerufen und wollte Gewissheit haben. In 14 Tagen schon sollte das Schiff fahren! Ich zahlte sogleich die 145 Dollar, die noch ausstanden und war überglücklicher Besitzer eines Schiffstickets nach Australien. Das Schiff hieß ‚Australasia‘. Sieben Tage sollte die Überfahrt dauern. Ich konnte also schon meinen Ankunftstermin in Fremantle ausrechnen. Das tat ich. Und da ich gerade am Rechnen war, zählte ich mein restliches Geld und teilte es durch 14. Ich sah, dass ich eigentlich mehr hatte, als ich pro Tag ausgab. Warum Geld mit nach Australien nehmen, wo es ja dort auf der Straße lag! Vielleicht nicht ganz, aber ich ging ja hin, um was zu verdienen. Vielleicht hätte jeder normale Mensch jetzt die Beigabe zum Gedeck bestellt und 14 Tage lang die Schulmädchen verwöhnt.
Ich, stattdessen, ging zum Busbahnhof und kaufte ein Ticket nach Bangkok, in Thailand. Auf dem Wege dorthin besorgte ich mir auch einen breiten Strohhut, denn die Sonne brannte manchmal ganz schön herunter. Um diesen wickelte ich meine Kobrahaut, die ich sonst meist als Haarband trug. Zehn Tage Thailand… das wäre doch was! Meinen Rucksack hatte ich dabei. Der Bus wartete nur noch auf mich, um loszufahren. Es war 11 Uhr. Um 1 Uhr früh sollte der Bus in Thailand ankommen. Jeder Platz war besetzt. Es war ein thai-ländischer Bus. Es war also genügend Beinraum vorhanden. Nur hatte ich nicht gewusst, dass thai-ländische Fahrzeuge keine Schalldämpfer besaßen. Nur den Krümmer. Als der Fahrer den Motor anließ, schreckte ich zusammen. Es war, wie wenn ein Flugzeug seinen Motor startet. Eine Konversation war unmöglich. Aber im Bus sprach sowieso niemand Englisch, geschweige denn Deutsch. Zumindest ersparte der Lärm dem Fahrer, die Hupe zu benutzen. Mensch und Tier rannte von der Straße, wenn der Bus sich näherte. Zumindest in Malaysia. In Thailand waren alle Fahrzeuge so laut, und die anrainenden Lebewesen hatten gelernt, mit dem Krach zu leben. Je lauter das Fahrzeug, umso größer das Ansehen des Fahrers! Das erinnerte mich an meine Mopedzeit. Hier zählt nicht der Stern auf dem Kühler, sondern der Krach am Krümmer! Der Busfahrer hielt sich, wie jeder seiner Kollegen, für den perfekten Fahrer und wartete nur darauf, für den Rennsport entdeckt zu werden. Die Straße war sein. Könige der Landstraße nennt man bei uns bisweilen die Brummifahrer. Die hier kann man als Tyrannen der Landstraße bezeichnen. Ich saß ganz hinten. Die Tickets waren entsprechend der Sitznummern von eins aufwärts verkauft worden. Ich war der Letzte gewesen. Bei einem Frontalzusammenstoß hätte ich also genügend Chancen, davon zu kommen. Nur nicht anhalten! Denn dann könnte einer von Hinten in uns reinrasen, dachte ich. Doch dann lachte ich über mich selber. Dann hätte ich gar nicht erst einsteigen dürfen, wenn ich so dachte, dann dürfte ich gar nicht hier sein!
Der Bus durchraste schönste Landschaften. Eine Weile folgten wir dem Küstenverlauf, sahen manchmal weiße Sandstrände. Dann ging es hinauf auf die Klippen und unser Blick überflog das blaue Meer. Einmal die Grenze überschritten, stiegen manche Fahrgäste aus. Andere stiegen zu. Es waren aber immer mehr, die zustiegen. Bald war der Gang auch voll besetzt. Das war wohl der Nebenverdienst des Fahrers. Irgendwo stieg ein alter Mann ein, bestimmt ein Bauer, mit einem vielleicht sechsjährigen Kind. Sie setzten sich auf den Boden. Ich rückte etwas mehr zu meinem Nebenmann, und ließ den Mann auf der Kante des Sitzes sitzen. Den Buben nahmen wir auf den Schoß. Der Mann sah abgearbeitet aus. Zerfurchte, schwielige Hände. Natürlich sprach er kein Englisch. Beim nächsten Halt bot ich ihm und dem Jungen einen Tee an. Weiter ging die Fahrt. Irgendwann, so gegen 23 Uhr, hielt der Bus mitten im Dunkeln an, um den Mann und seinen Enkel aussteigen zu lassen. Der Mann bot mir an, mit in sein Dorf zu kommen. Jemand aus dem Bus übersetzte mir. Das Dorf läge nur ein paar Fußstunden von hier. Wäre es hell gewesen… Alle möglichen Sachen kamen mir in den Sinn, Tiger, der Vietcong… Als der Bus wieder fuhr, war es mir, als hätte ich ein großes Abenteuer verpasst. Und stattdessen fahre ich in die größte Stadt des Landes! So gegen zwei Uhr durchfahren wir die Vororte Bangkoks. Es regnet in Strömen. Der Bus hält auf einem riesigen Platz an. Die wenigen Straßenlaternen spiegeln sich in den öligen Pfützen. Zum Glück hat der Wolkenbruch aufgehört. Alle steigen aus und gehen ihren Weg. Der Bus fährt weg. Ich stehe alleine da. Ein paar Busse parken etwas weiter am Rand des Platzes. Es fängt wieder an zu nieseln. Ein ungeheures Gefühl von Einsamkeit über-kommt mich. Mir ist, als wäre ich am traurigsten Ort der Welt gestrandet. Wo kann ich die letzten Stunden der Nacht verbringen? Wo bin ich einigermaßen sicher vor Räubern und Straßenkötern?
Ich nehme meinen Rucksack und schlage irgendeine Richtung ein. Irgendwo werde ich schon landen… Da kommen vier Personen auf mich zu. Ich sehe, es sind Jugendliche, und sie sehen eher harmlos aus, stelle ich erleichtert fest. Jeder, der schon mal gereist ist, weiß, dass man oft ziemlich was an Geld dabei hat. Mehr als die Einheimischen besitzen, vor allem in diesen Ländern. Kommen sie von einer Feier? Sie begrüßen mich auf Englisch. Aha, zumindest gehen sie auf die Oberschule, haben also Eltern, die es sich leisten können, ihren Kindern eine Ausbildung zu geben. Woher, wohin? Ich sage, ich wolle zum YMCA. Der ist weit von hier und ist teuer. Acht Dollar die Nacht. „Gib uns acht Dollar und wir besorgen dir eine Unterkunft!“ Sie führen mich zu einem Schuppen, worin ein Billardtisch und zweit Tisch-fußballspiele stehen. Ziemlich verdreckt und herunter-gewirtschaftet. Ein paar Gestalten pennen da schon. Sie sind mir nicht grade geheuer. Ich sage ihnen, dass mir der Platz nicht gefällt und zum YMCA gehen werde. Sie beraten. „Komm, du bist unser Freund, du kannst bei uns übernachten.“ Ich machte mich auf eine Studentenbude gefasst. Ich folge ihnen und beantworte ihre neugierigen Fragen.
Wir gelangen in ein schickes Wohnviertel. Hier trennen sie sich. Zwei, bestimmt Brüder, nehmen mich mit. „Falls die Eltern fragen, du bist ein deutscher Student und unser Gast.“ Ich schlafe auf einer Matte in ihrem Zimmer. Am nächsten Morgen stehen wir auf. Die Eltern haben schon erfahren, dass Besuch da ist und heißen mich mit vielen Verbeugungen als Gast willkommen. Sie sprechen kaum Englisch. Sie sind stolz auf ihre Kinder, die Respekt vor anderen haben und die Regeln der Gastfreundschaft üben. Es folgt ein gemeinsames Frühstück. Dann verabschiede ich mich mit vielen ‚Thank Yous‘. Einer der Brüder nimmt meinen Ruck-sack, um ihn hinauszutragen. Die stolzen Eltern winken mir von ihrer Tür aus nach, ich winke zurück. Wir kommen um eine Hausecke. Der mit dem Rucksack rennt plötzlich los. Der andere hält mich fest. Plötzlich sind auch die Kumpel von der Nacht da. „Gib uns zehn Dollar für Schlafen und Essen, und du bekommst den Rucksack wieder!“ Ich protestiere. „Ist das thailändische Gastf-reundschaft?“ Sie bleiben hart. Unauffällig ziehe ich einen Zehn-Dollar-Schein aus meiner Reserve und zeige ihn ihnen. Sie geben dem Anderen ein Zeichen. Der kommt näher. „First backpack!“ Sie wollen erst das Geld. Ich bleibe stur. Der mit dem Rucksack nähert sich. Ich strecke die Hand mit dem Schein etwas vor. Er macht dasselbe mit dem Rucksack. Die Anderen stehen abwartend, nicht weit. Ich greife schnell nach dem Ruck-sack, er nach dem Geld, und alle rennen in verschiedene Richtungen davon. Willkommen in Bangkok!
Bangkok ist riesig. Es liegt im Flussdelta des Chao Phraya. Viele Kanäle und Flussarme durchziehen die Stadt. Wohin ich den Kopf auch drehe, überall ragen hohe, goldene Tempeltürme in den Himmel, oder Paläste. Ich lasse mich die letzten Kilometer von einem Rikscha fahren. Der Fahrer erklärt mir im Vorbeifahren die einzelnen Sehenswürdigkeiten. Ich habe den Eindruck, er will mit mir eine Stadtrundfahrt machen. „Shortest way to YMCA!“ mahne ich ihn. Ich nehme ein Bett in einem Vierbettzimmer. Um diese Zeit bin ich noch der Einzige. Doch als ich nach meinem Stadtrund-gang gegen Abend zurückkomme, sind alle Betten belegt. Drei junge Amerikaner wohnen mit mir im Zimmer. Der Preis ist wirklich 8 Dollar. Aber pro Bett, nicht für das Zimmer! Die Nacht wird laut. Irgendwer ist immer unterwegs. Manchmal scheinen Rennfahrten stattzufinden, mit röhrenden Motoren und quietschenden Reifen. Wer eine Freundin hat, und ein Auto, bringt ihr unter ihrem Fenster ein Ständchen mit aufheulendem Motor!
Für den nächsten Vormittag haben meine Zimmer-kollegen ein Boot mit Fahrer gemietet. Ob ich nicht mitkommen will, gegen 3 Dollar Beteiligung? So wie ich bisher die Stadt gesehen habe, finde ich das eine gute Idee. Denn viele der Sehenswürdigkeiten sind einfacher vom Wasser her erreichbar oder am besten sichtbar. Es ist ein langsames Motorboot, sogar mit einem Schall-dämpfer ausgestattet. An mehreren Tempeln halten wir an und steigen aus. Der alte Königspalast. Riesig und voller Prunk zieht er an uns vorbei. Und da drüben der neue! Noch monumentaler und prachtvoller. Rot-Grün glasierte Ziegeldächer, deren Firste am Ende mit vergoldeter Schnitzerei verziert sind und sich hornförmig nach oben in die Luft schwingen. So schön diese Paläste auch sind, ich finde hier ist mindestens einer zu viel. Riesige Stupas ragen in den Himmel, wie goldene auf dem Boden stehende Glocken. Monumentaler als alle, die ich bisher gesehen habe. Die Tempelbezirke sind übersät von Stupas aller Größen, dazwischen Pagoden mit bunten oder goldenen, sich übereinanderschichtenden Dächern. Haushohe Wächterstatuen mit Grimassen-gesichtern stützen sich auf ihre Schwerter und bewachen auf beiden Seiten die Eingänge zu den Tempeln. Der Boden der Tempelstadt ist weißer Marmor, ebenso die Stufen. Wohin ich den Kopf wende, alles ist bunte Keramik, Gold und Marmor, aufs üppigste verziert. Und die Verzierungen nochmals verziert. Bis ins Aller-kleinste. Nie habe ich bisher eine solch große Tempelanlage gesehen!
Alles blitzt vor Sauberkeit, kein Gestank liegt über dem Ganzen, nur der Duft von Weihrauch, der aus dem Inneren der Tempel nach außen dringt. Im Inneren erheben sich übermenschengroße Statuen, meistens der Buddha, sitzend, lächelnd. An der Haltung der Hände erkennt der Gläubige, ob der Tempel dem vergangenen, dem Buddha unseres Zeitalters, oder dem zukünftigen geweiht ist. Vor den Statuen befinden sich prunkvolle, mit Sand gefüllte Becken, worin die Pilger und andere Besucher Weihrauchstäbe stecken. Dieser erhebt sich gleich langsam wehende Fäden von den glühenden Enden und legt sich in wohlriechenden Schichten in den Raum. Manche der Weihrauchstangen sind armdick und über zwei Meter lang. Der Geruch ist gleich dem in den lamaistischen Tempeln Nepals. Außer Sandelholz müssen große Proportionen Wacholderspäne darin sein. Dort, wo ein Sonnenstrahl das Halbdunkel im Inneren durchsticht, leuchtet der Weihrauch auf, gleich dem Richtstrahl eines Leuchtturmes. Nicht genug damit, dass die Dächer von außen verziert sind, auch von Innen ist jeder sichtbare Ziegel, jede Dachlatte oder Balken zierlich verkleidet, mit Gold, Keramikschuppen, Seidenstoffen oder Edelsteinen. Viele Götterfiguren und Dämonen, die ich in Nepal gesehen hatte, tauchen auch hier auf. Aber in Reinform, golden. Ohne mit Blut oder Farbe verschmiert zu sein. Neben den Eingängen wachsen wohlgeordnet Fächerpalmen, verbreiten Blumenbeete ihre Farbenpracht. Hier sind Architekten den Künstlern zur Seite gestanden! Hier ist kein Chaos. Hier ist Ordnung. Himmlische Ordnung. Und unter all den Besuchern wandeln trotzdem ein paar Mönche. Wenn sie nicht im Tempel oder Kloster Dienst tun, durchziehen sie bettelnd die Stadt oder sitzen in Reihen am Rande bestimmter Straßen. Stumm die Bettelschale haltend, geduldig auf Almosen wartend. Wie Fürsten, die beim Nehmen den Eindruck hinterlassen, als würden sie geben. Thailand muss ein sehr religiöses Land sein. Und ein sehr reiches. Nur durch Fron können solch Bauwerke nicht entstehen. Und auch nicht unterhalten werden. Trotz der ungünstigen Zeit des Monsuns befinden sich hunderte von ausländischen Touristen hier, auch einige amerikanische GIs auf Fronturlaub. Vietnam liegt gleich nebenan.
Bangkok wird von einem Labyrinth von Kanälen durchzogen. Diese sind sich nicht alle gleich. Es gibt da die Prachtkanäle, die sich zwischen den Palästen und Tempeln meistens gradlinig hindurchziehen. Es gibt andere, an denen sich Warendepots befinden, von wo aus Güter auf dem Wasserweg verschifft werden, wieder andere, an denen sich Geschäfte säumen, oder Wohnviertel. Viele Felder und Gärten der Stadt werden auch auf Kanälen erreicht. Diese schlängeln sich oft unter der üppigen Vegetation hindurch, kleine hölzerne Stege führen ins Wasser, um die Frachtkähne zu beladen. Andere dienen zum Entwässern des Flussdeltas, um Ackerfläche zu gewinnen. Wie durch einen Tunnel gleiten wir mit unserem Boot über das grüne Wasser. Manchmal kommen wir in einen der Flussarme. Der Wasserstand ist überall, bedingt durch den Monsun, sehr hoch. Die kleinsten Kanäle sind anfangs bedeckt. Das sind diejenigen, die die Abwässer der Stadt ableiten. Sie ergießen sich in die größeren. Zum Glück ist derzeit kein Wassermangel und die Kinder, die von den Anlegestegen vor den Pfahlbauten ins Wasser springen, riskieren nichts. Auch nicht die Frau, die sich gerade einseift. Der Fluss ist die Lebensader seit Urzeiten. In den Hauptarmen, da wo er in den Hafen münden, liegen sogar ein paar Kriegsschiffe. Zwei davon sind Fregatten. Ohne Fenster. Für was für eine Art Krieg sind die bestimmt? Sie sind nicht beflaggt, tragen keine Nummer. Sind das amerikanische Schiffe, die getarnt, auf einen eventuellen Einsatz in Vietnam warten? Aber warum keine nationalen Kennzeichen?
In der Nähe, in einer Werft, entsteht ein Frachtschiff. Ein riesiger Werftkran ist gerade dabei, die vorgefertigten Brückenaufbauten aufzusetzen. Bus-Boote fahren Menschen zur Arbeit und Kinder in die Schule. Wer es eilig hat, nimmt ein ‚Speed-Boat‘, ein schmales, schnittig gebautes Boot, mit nur zwei Sitzplätzen nebeneinander, aber 5 bis 10 hintereinander gereiht. Am Heck ist ein enormer Auto- oder LKW- Motor auf eine mindestens 5 Meter lange Welle geflanscht, an deren anderen Seite sich die Schraube befindet. Diese Motor-Wellen-Konstruktion ist an ihrem Schwerpunkt im Bootsheck drehbar aufgehängt und dient zugleich zur Steuerung. Der Motor, natürlich ohne Schalldämpfer, gibt diesen Rennbooten einen solchen Schub, dass sie mit riesiger Bugwelle halb gleitend vorwärtsschießen. Ich schätze ihre Geschwindigkeit auf über 70 Stundenkilometer. Eine kleine Barkasse, mit bestimmt weniger Pferdestärken als die Speeder, zieht langsam 4 beladene Schuten hinter sich flussaufwärts. Diese sind so tief abgeladen, dass das Deck vom Wasser überspült wird und nur die hohen Lukensülle sie am Sinken hindern. Auf jeder Schute ist eine einfache Unterkunft, die man mit geflochtenen Bastmatten erweitert hat. Man sieht, dass auf jeder eine Familie lebt. Die Kinder rennen über die überfluteten Seitendecks und die Schlepptrossen von Schute zu Schute nach vorne. Dort springen sie ins Wasser, um auf der letzten wieder an Bord zu klettern. Am Heck eines jeden Frachtkahnes befindet sich ein großes, buntbemaltes Ruderblatt mit langer Pinne. Daran steht auf jeder ein Steuermann. Die Ladeluken sind mit halbrunden Wellblechen gegen Regen geschützt, oder mit spitzen Grasdächern. Zu Stoßzeiten muss es auf den Kanälen so zugehen, wie auf den Straßen. Mit dem kleinen Unterschied, dass Schuten keine Bremsen haben…
Wir kommen durch Viertel, wo die Dächer mit Rost beschichten sind, anstatt mit Gold. Anstatt Motorbooten rudern die Menschen in Einbäumen. Zum Einkaufen, auf einen Plausch zum Nachbarn, zu den Gärten. Oft bringen die Wellen der Speed Boote die Einbäume, die nur ein paar Fingerbreit aus dem Wasser ragen, in Gefahr. Meist wird mit einem Paddelmanöver rechtzeitig der Bug gegen die Wellen gedreht und zu einem Schäufelchen gegriffen, um das übernommene Wasser wieder rauszulenzen. Unser Boot tuckert wie ein schwimmender Traktor durch die Kanäle. Eine geflochtene Matte schützt uns gegen die Sonne und die vereinzelten Regenfälle. Jede Biegung bringt uns neue Überraschungen. Schwimmende Händler paddeln in ihren übervollen Einbäumen von Pfahlbau zu Pfahlbau. Die Gemüse türmen sich in bunt geordneten Pyramiden. Schwimmende Garküchen, ein Holzkohlenfeuer unter den Töpfen verkaufen ihre in Öl schwimmenden Spezialitäten. Der Handwerker kommt im Boot. Vielleicht auch der Bettler. Eine schwimmende Tank-stelle kommt uns entgegen, motorgetrieben.
Unweit einer Flusskreuzung, unter dem tiefhängenden Geäst eines weitausladenden Baumes, ist schwimmender Markt. Die Händler und Marktfrauen halten sich an den fast bis zur Wasseroberfläche reichenden Ästen fest, um nicht abgetrieben zu werden. Aus allen Kanälchen kommen Einbäume, schwimmenden Einkaufswagen gleich, um die täglichen Besorgungen zu machen. Es scheint mir, als lägen die Händler im Wettstreit darum, wer das schönste Boot hat! Oder ist es, weil die Menschen lieber da kaufen, wo es am schönsten ist, und nicht dort, wo es am billigsten ist? Gefeilscht wird aber allenthalben! Sogar der Metzger kommt angepaddelt und zerlegt seine Schweinehälften vor den Kenneraugen der Kundschaft. Fast alle Frauen tragen die typisch süd-ostasiatischen Kopfbedeckungen, die wie ein Lampen-schirm aussieht. Das ist ein Hut, entweder aus fein gespaltenem Bambus, und/oder einer Art Schilf miteinander verflochten. Dieser Hut befindet sich etwas erhöht, wie ein kleiner Schirm, auf einem Kopfgestell. Das ermöglicht ein Durchstreichen der Luft. Je weiter die Stadt zurückbleibt, um so dichter wird die Vegetation. Palmen neigen sich über das Wasser, hohe Bäume strecken ihre Äste weit auf den Fluss, alles scheint nach Licht zu suchen. Auch hier draußen rast manchmal ein Speedboot vorbei, seine Wellen nagen an den Ufern. Eile kennt keine Grenzen, ist schon international!
Im YMCA treffe eine Amerikanerin, die in Luang Prabang, in Laos, weiter im Norden, in einem Flüchtlingscamp arbeitet. Sie berichtet uns von ihrem Alltag. Tausende Halbverhungerte müssen versorgt werden, dazu die von Minen Verletzten. Sie suchen Hilfswillige. Doch wollen die Behörden keine Genehmigungen erteilen, weil die Gegend im Norden zu unsicher ist. Selbst auf thailändischem Gebiet ist der Vietcong aktiv, hauptsächlich mit Attentaten. Gestern sei die Bahnlinie von Thailand nach Malaysia gesprengt worden, mitsamt dem Zug, der gerade durchfuhr. 5 Tote und enormer Sachschaden. Ich überlege, ob ich nicht mit ihr nach Luang Prabang gehe und Australien etwas aufschiebe. Doch es können nur Leute von gemeinnützigen Verbänden dorthin, die von der entsprechenden Regierung entsendet werden. In meinem Fall die deutsche. Aber die will mich ja eher für fünf Jahre aus dem Verkehr ziehen…
Am nächsten Tag mieten wir zusammen ein Taxi und fahren nach ‚Timland‘, einer Art Touristenpark, wo dem Besucher die Kultur Thailands in einem Tag vermittelt werden soll. Dort wurden tausende von Touristen durch die verschiedenen Animationen geschleust. Die Elefanten bei ihrer Arbeit zu sehen, wie sie Baumstämme zogen und mit ihren Stoßzähnen über den Boden rollten, war für mich das Interessanteste daran. Auch die Volkstänze, die Kostüme der Tänzer, die Musikinstrumente, all das war sehenswert. Doch war alles aus dem täglichen Leben herausgelöst und gemacht für jene, die Thailand in drei Tagen absolvieren wollen. Und zu denen gehörte letztendlich auch ich. Nach einer dritten Nacht, ohne Unterlass unterbrochen von den laut röhrenden Motoren, ging ich zum Bahnhof. Das Leben war außerdem zu teuer. Ich verbrauchte über 20 Dollar am Tag. Das einzig billige waren die Transportmittel, vor allem die Bahn. Und die war auch das Sicherste, trotz des Bomben-anschlags. An besagter Stelle lagen noch die beschädigten Wagons neben den Gleisen. Der Zug fuhr langsam durch diese Stelle hindurch, weil die Schienen noch nicht endgültig repariert waren. Auch hielten die Züge keinen festen Fahrplan mehr ein, um so Anschläge schwieriger zu machen. So ging es wieder südwärts. Im gleichen Wagen traf ich zwei Deutsche, die mit einem Billigflug vor ein paar Tagen in Bangkok angekommen waren, und die nach Malaysia wollten, weil sie gehört hatten, dass dort das Leben weniger als halb so teuer ist als in Thailand. Das konnte ich bestätigen. Außerdem erzählte ich viel von Penang, worauf sie beschlossen, dort eine Weile zu bleiben.
Als wir die Fähre, die uns vom Festland auf die Insel gebracht hatte, verließen, verfolgte uns ein Rikschafahrer regelrecht. Mit jedem Meter, den wir liefen, sank sein Preisangebot. „Wollen mal testen, was so ein Vehikel aushält, sagten meine Begleiter und zu dritt, das Gepäck auf dem Schoß, zwängten wir uns auf den Sessel. Dadurch stieg das hinten dranhängende Antriebsmodul samt seinem Besitzer, der seine indischen Kollegen durch sein Gewicht um das Doppelte übertraf, in die Luft, und unsere Gondel kippte nach vorne auf die Fußrampe. Der Fahrer lachte mit uns und alle stiegen ab. Wir wollten zu Fuß weiter. Doch der Fahrer sah wohl seine Ehre auf dem Spiel, und bestand darauf, dass wir mit ihm fahren! Er hob unsere Rucksäcke hoch, nahm den schwersten auf den Buckel, die anderen zwei hängte er außen seitlich an den Lenkbügel, was dem Gefährt eine enorme Breite verlieh. Wir waren im Gleichgewicht und er stieg in die Pedalen. Doch schon nach 200 Metern war Schluss. Ein Beerdigungszug von wohl einem Kilometer Länge zog gerade durch die Hauptstraße in Richtung Friedhof und legte allen Verkehr lahm. Wir hatten unseren Logenplatz und konnten in Ruhe den Leichenzug betrachten. Vorneweg fuhren in einer Doppelreihe gut ein Dutzend leerer Rikschas, die auf jeder Seite des Sitzes eine wohl 4 Meter hohe schwarze Fahne, mit Schriftzeichen darauf, befestigt hatten. Dann folgte eine Prozession von Kindern, auch in Doppelreihe, die auf der rechten Schulter an einer langen Bambusstange eine schmale, bunte Fahne trugen, in Laufrichtung ausgerichtet. Männer trugen riesengroße Lampions oder Gebetsmühlen aus Papier. Eine Gruppe von Männern in gelben Strohhüten schlug auf schwarze Tamburine, Frauen trugen papierene Sänften, mit Blumen geschmückt. Dann eine in zwei Stangen, wie eine Sänfte getragene Kesselpauke, wieder leere Rikschas, mehrere Tempelfiguren in weiße Schleier gehüllt. Ein Militärorchester in Tropenuniformen, mit Tropenhelmen auf den Köpfen blies in die Instrumente. Eine Gruppe Frauen trug leere, aus Papier und Seide gebildete Sänften auf den Schultern, dann folgte ein blau-gelber Lkw, der mit einem Baldachin versehen war, und anscheinend nur zu Beerdigungszwecken diente. Darunter lag der Sarg. Dieser war ein enormer Baumstamm, der Länge nach durchgeschnitten und ausgehöhlt. Orangefarbene Blumengirlanden schmückten Sarg und LKW. An den Streben des Baldachins und den umlaufenden Geländern hielten sich mit Sackleiwand gekleidete Männer, leicht gebückt, mit einer Hand fest. Auf dem Kopf trugen sie lange, gelbe, bis über die Schultern herabhängende Kapuzen mit Eselsohren daran. Diese Gruppe schienen berufsmäßige Trauernde zu sein. Sie waren die einzigen des Trauerzuges, die dem Leid der anderen in lautem Lamentieren Ausdruck gaben. Die darauf Folgenden mussten von der Familie sein. Jeder von ihnen trug ein länglich gefaltetes gelbes Tuch über der rechten Schulter. Gelb, die Farbe der Trauer. Der Verstorbene musste ein hohes Tier gewesen sein, wohl ein früherer Militär, weil er mit solchem Pomp zu Grabe geleitet wurde. Es folgten noch weitere leere Rikschas und dann eine Menge anderer Trauergäste und Schaulustige. Als der nachfolgende Verkehr sich einigermaßen verlaufen hatte, ging unsere Testfahrt weiter.
Wir kamen an dem Bordell vorbei, wo ich drei Tage gewohnt hatte und wo die Schulmädchen bestimmt noch über den sonderbaren Touristen lachten. Ich erzählte meinen Kumpeln davon. „Das wäre doch was für uns!“ feixten sie. Stiegen letztlich aber in einem Hotel ab, was ihnen der Rikschafahrer empfahl. Mit mir am Strand zu schlafen, schien ihnen zu riskant. Ich ging also alleine zu dem kleinen Fischerdorf, welches ich auf meinen früheren Streifzügen entdeckt hatte. Telok Bahang hieß es. Bald sah ich hinter den Palmen das Meer schimmern. Ich wandte mich nach links und lief so weit, bis keine Häuser mehr waren. Die Straße endete in einem runden Platz, neben dem sich ein Wellblechdach erhob, worunter ein Tischfußballspiel und ein alter Billardtisch standen, die von Jugendlichen umlagert waren. Daneben befand sich ein Limonadenausschank. Diese Kneipe hatte ich mit den Freunden als späteren Treffpunkt ausgemacht. Hier vergnügten sich die Fischer, wenn sie mal nicht ausfuhren, hier ließen sie ihr weniges Geld. Unterhalb dieser Hütte führte ein langer, hölzerner Steg ins Meer. Heute war er verlassen, nur ein paar Netze hingen über den Balken, wohl zum Trocknen oder Reparieren. Es war Ebbe. Rechts vom Steg lagen drei schraubengetriebene Fischerboote auf dem Strand. Es roch nach Schlick, Fisch und frischer Farbe. Ein paar Fischer rollten rote Unterwasserfarbe auf einen Schiffsrumpf, während andere mit Stechwerkzeugen die Böden ihrer Boote von Algen und loser Farbe befreiten. Sie winkten mir zu. Ich setzte mich auf den Steg und beobachtete ihr Treiben.
Später, als die Sonne sich dem Horizont näherte, nahm ich meinen Rucksack und lief auf der anderen Seite des Steges den weißen Strandstreifen entlang. Ich zog mir die Schuhe aus. Das war schön, den warmen Sand zu spüren! Ich umlief eine Bucht, mal im Wasser, mal im Trockenen, kletterte über ein paar abgrenzende Felsen, kam in eine andere Bucht. Wieder weißer, feiner Sand, die Kokospalmen neigen sich schräg zum Meer, eine leichte Dünung verläuft sich leise in durchsichtigen Wellen. Die Sonne geht auf den Horizont zu. Ich finde einen Platz zwischen zwei dicken Felsen, stelle meinen Rucksack dort ab und klettere die vom Meer leicht unterhöhlte Uferböschung hinauf. Ich sammle etwas trockenes Holz auf dem Ufer. Das Beste liegt aber unterhalb davon, Schwemmholz aus dem Meer und trockene Palmenblätter. Als der Horizont golden die Erde umarmt, zünde ich das Feuer an. Ein paar Steine stützen mein Kochgeschirr ab, bald schon blubbert es darinnen. Ein halbes Paket chinesische Nudeln, einen Bouillonwürfel, ein Stück Brot: ‚Malaysia for one Dollar a day…‘
Noch lange saß ich auf meiner Decke und schaute auf das dunkle Meer. Es war eine warme Nacht. Leise schoben sich die Wellen auf den Sand, es herrschte fast absolute Stille. War das eine Wohltat, nach den drei Nächten in Bangkok! Als der Horizont nicht mehr zu sehen war, legte ich mich auf die Decke und bedeckte mich mit dem Leinentuch aus Indien. So konnten mir die Mücken nicht viel anhaben. Die Sterne hatten ihre volle Pracht entfaltet. Ich betrachtete sie eine Weile, versuchte, mir die Entfernungen da oben vorzustellen. Und da, wo ich nichts mehr sehen konnte, ging es trotzdem weiter. Das Nichts ist endlos. Und irgendwo in diesem ganzen Glitzerkram schwebe auch ich, auf dieser Staubkugel, die jemand vor uns mal Erde genannt hatte, Terra, Gaia… Und noch verrückter, ich selber, mein 72 Kilo schwerer Körper, bin genauso aufgebaut wie das All: viel Leere und darin meine Atome und Moleküle gleich Galaxien. Und was, wenn das Universum, wie wir es sehen, nur selber ein Molekül ist, von etwas noch Größerem? „We are stardust, we are golden…“ mit dem Lied von Joni Mitchell im Sinn schlafe ich ein.
Irgendwann in der Nacht wurde ich wach. War es die Kühle, die mich geweckt hatte? War da nicht ein Geräusch im Urwald hinter mir? Mir war, als sehe ich ein Paar leuchtende Augen, die mich beobachten. Die Schlange Ka oder Baghira, der Panther? Ich schlüpfte unter die Decke. Mir fröstelte. Ich war wohl gerade wieder eingenickt, da rissen mich Maschinengewehr-salven erneut aus dem Schlaf. Ich lauschte eine Weile. Die waren jedenfalls weit weg. Auf dem Festland. „Bom… bom… bom!“ antwortete ein Geschütz oder ein Mörser. War dies ein Manöver, waren das kommu-nistische Guerillas? Durch den Krieg in Vietnam waren auch die angrenzenden Länder unsicher geworden. Nicht nur, dass die Lebensweise der herrschenden Klassen Unmut hervorrief, sondern der Nachschub der Guerillas lief meist durch die Nachbarländer. Ich konnte nicht wieder einschlafen und dachte über meine Lage nach. Würde mir ein wildes Tier was anhaben wollen, könnte ich ins Wasser rennen und sogar wegtauchen. Was verirrte Kugeln betrifft, hatte ich mal gehört, dass, wenn man die Schüsse hört, keine Gefahr mehr besteht. Die Kugel fliegen schneller als der Schall. Der Tod kommt für den Betroffenen lautlos. Fast jede Nacht hörte ich Schüsse. Als ich die Fischer danach fragte, zuckten sie die Schultern und meinten, das ist weit weg, das ist die Armee.
Ich wachte erst wieder auf, als die Sonne über den Horizont aufstieg, ungefähr da, wo ich die Schüsse gehört hatte. Ich nahm mein Morgenbad im seichten Wasser, legte meine Angel aus und mischte mein Müsli. Dann folgte ein kurzes Sonnenbad, bevor sie zu stark wurde. Dabei fiel mein Blick auf die Kokosnüsse oben unter den Blättern am Stamm der Palmen. Ich versuchte den riffeligen Stamm hinauf zu klettern. Am unteren Ende, wo er am dicksten ist und leicht geneigt, ging es ganz gut. Doch dann war Schluss. Ich rutschte auf der glatten Rinde und musste mich durch einen Sprung in den weichen Sand retten. Ich versuchte es, indem ich den Stamm umklammerte. Zum Glück war unten der weiche Sand, in dem ich mich jedes Mal wiederfand. Kokosnuss würde ich mir von meinem Menü streichen können! Später am Vormittag kam ein Dutzend Studenten mit ihrem Professor, der nicht viel älter schien als ich, den Strand entlang. Sie sammelten Krustentiere für ein meeresbiologisches Projekt. Während die Studenten unter Steinen, am Schwemmholz und im Sand suchten, unterhielt sich der Lehrer mit mir. Mittags ging der ganze Trupp mit gefüllten Gefäßen zurück. Am Nachmittag näherte sich ein größeres Holzruderboot mit zwei Fischern darin. Das Heck war gespreizt und lief in zwei hölzerne Hörner aus, wozwischen eine runde Stange befestigt war. Diente diese dazu, das Netz auszustecken und wieder einzuholen? Sie zogen das Boot nicht weit von meinem Lager auf den Sand. Mit Äxten ausgerüstet gingen sie in den Wald. Dumpf hallten kurz darauf Axtschläge zu mir herüber. Nach einer Weile bewegte es sich in den Kronen, und zwei Bäume krachten durch das Unterholz auf den Boden. Bald zogen sie die entasteten Bäume zum Strand. Hier spitzten sie ein Ende zu, das andere flachten sie ab. Daraus schloss ich, dass es Pfähle für den Landungssteg am Dorf waren. Nun zogen sie die Stämme, einen für jede Seite, durchs Wasser zum Boot. Sie hatten Schlingen um die Stämme gelegt, die verhinderten, dass diese im Wasser versanken. Das Holz war schwerer als Wasser. Dann schoben sie das Boot ins tiefere Wasser und, während einer sich ins Heck setzte, ruderte der Andere stehend, den Blick nach vorne, mit sich kreuzenden Ruderenden zurück. Am nächsten Tag sah ich, wie sie diese Pfosten seitlich am Steg mit Seilen aufrichteten und von einem provisorischen Podest aus in den sandigen Untergrund rammten.
Durch diese zwei holzholenden Fischer, und vielleicht auch die Studenten, hatte das Dorf erfahren, dass ich hier draußen wohnte. Bald schon kam eine Gruppe Kinder und beschaute mein Lager, meine Angelausrüstung, alles. Dann berieten sie kurz und machten sie sich daran, mir einen Vorrat an trockenem Schwemmholz zu sammeln. Sie wussten, wo das lag. Ich musste für sie exotisch erscheinen. Sie sprachen kaum Englisch. Jedesmal, wenn sie etwas nicht verstanden, lachten sie und wiederholten so gut sie konnten, das, was ich gesagt hatte. Da war es an mir, zu lachen, denn das klang nun unverständlich für mich. Lachen ist jedenfalls die beste Verständigung. Ich lief auf eine Kokospalme und kletterte so hoch ich konnte. Bis ich im Sand lag. Sie wälzten sich vor Heiterkeit am Boden. Die kleineren machten es mir nach und landeten ebenfalls im Sand. Ein größerer, so 10 Jahre alt, zeigte erst auf sich, dann hoch zu den Kokosnüssen, dann auf mich. Ich bejahte. Und schon kletterte er los. Solange der Stamm noch geneigt war, nutzte er die Stammschuppen wie eine Treppe. Dann, als der Stamm fast senkrecht war, umfasste er diesen bäuchlings mit beiden Armen, setzte seitlich die Füße an den Stamm, ganz hoch, fast neben seiner Hüfte, wie ein Frosch vor dem Sprung. Nun streckte er die Beine, glitt mit den Armen entlang des Stammes etwas höher, hielt sich dann damit fest. Nun zog er die gestreckten Beine wieder an. Dann dasselbe nochmal und nochmal, und nach einem dutzend Mal Strecken und Anziehen war er oben. Er rüttelte an den in Reichweite dicht unter den Blättern hängenden Nüssen, bis zwei nach unten fielen. Er schlug sich wie wild auf den Kopf und auf den Körper und rief etwas, was alle zum Lachen brachte. Dann kam er schnellstens heruntergerutscht, sprang in den Sand, rannte ins Wasser, taucht unter und kam dann lachend zurück. Aus seinen nassen Haaren entfernte er einige große Ameisen, die oben in der Palme ein Nest angelegt hatten.
In Georgetown hatte ich schon das letzte Mal ein neues Fahrtenmesser gekauft als Ersatz für das in Griechenland zersprungene. Und auch ein winziges Transistorradio. Mit diesem Messer versuchte ich nun, die erste Nuss zu köpfen. Die Kinder schauen mir eine Weile zu. Dann will einer das Messer und im Handumdrehen hat er die Nuss aus den Fasern gelöst. Gegen Abend gehe ich in die Fischerkneipe und leiste mir ein Fanta. Die Boote sind fast alle zurück, und die Fischer ‚verbraten‘ ihre paar Cents bei einem Tischfußball oder einer Partie Billard. Auf einem Grill liegen frische Fische und verbreiten Appetit. Schnell habe ich mich mit den Fischern angefreundet. Ein paar wenige sprechen etwas Englisch. Durch sie erfahre ich, dass eine Straße rund um die Insel führt. Viele Tempel säumen diese und es gibt sogar eine Seilbahn auf den höchsten Berg!
Früh am nächsten Morgen laufe ich auf einem Pfad durch den dichten Wald zur Straße. Ich will heute versuchen, um die Insel zu trampen. Überall kreischt und zirpt es im Geäst. Doch selten bekomme ich einen Vogel zu Gesicht. Dann komme ich an die Straße. Die Insel hat einen Umfang von 40 Kilometern. Notfalls könnte ich immer noch zu Fuß zurück. Denn so sehr George Town, der Hauptort der Insel, vor Menschen und Autos wimmelt, so verlassener scheint das Land zu sein. Bis zum ersten Tempel gehe ich zu Fuß. Es ist der Schlangentempel, ein buddhistischer Tempel in chinesischen Stil. An beiden Enden hochgezogene Dächer, mit Ziegeln gedeckt, fast alles Holz ist rot gestrichen. Im Innenhof sind allerlei Büsche gepflanzt, vor allem in Keramikgefäße. Ich lasse meine Schuhe neben dem Tempeleingang, setze mich eine Weile vor den Hauptbuddha. Nirgendwo eine Schlange zu sehen. Und die Fischer hatten gesagt, es seien hunderte davon da! Ein Mönch nähert sich. Ich frage ihn nach den Schlangen. Er zeigt stumm auf einen im Tempel stehenden Busch, nicht weit von da, wo ich sitze. „Ja und?“ Ich stehe auf und trete ganz nahe. Und da sehe ich es: das, was ich für einen Pflanzenstil mit Blütenknospe gehalten hatte, ist eine kleine, grüne Schlange. Und sie ist nicht alleine! Der halbe Busch ist lebendig und schaut mich mit züngelnden Mäulern an! Ich schrecke zurück. „Not poisonous?“ frage ich. „They are. But they don’t bite in Tempel!“ Der hat Humor! Warum sollten die im Tempel nicht beißen? Wünscht er mir eine Abkürzung ins Nirwana? Er führt mich etwas herum und zeigt mir die verschiedenen Schlangentypen in ihren entsprechenden Büschen. Es erinnert mich etwas an ein Suchbild. Hat man die erste entdeckt, findet man die anderen schneller. Selbst in hölzernen Gestellen, gleich Garderoben, räkeln sie sich. Warum solche Tempel? Zeigen sie die große Liebe und Mitgefühl Buddhas zu allen Lebewesen? Soll auch den Tieren der Weg zur Erleuchtung gezeigt werden?
Das Trampen geht auch trotz des wenigen Verkehrs. Meist nur von einem Ort zum andern. Und das gibt mir die Gelegenheit, fast alle Tempel zu besuchen. Der nächste ist der des liegenden Buddhas. Über dreißig Meter lang liegt er da, ganz in Gold und lächelt mir zu. Eine enorme Halle überspannt ihn. Der Tempel der 1000 Buddhas ist zugleich ein Kloster. In seinem hohen Turm sollen sich in den Nischen tausend Buddhastatuen befinden. Der ganze Komplex ist in den Hang gebaut und gleicht einem riesigen Park. Das nächste Auto setzt mich am Fuß der Seilbahn ab, vor dem Fahrkartenhäuschen. Ich leiste mir den Luxus und steige in die stufenartig gebaute Gondel. Diese fährt auf Schienen und ist mit einer anderen verbunden, die im Augenblick oben steht. Rumpelnd setzt sie sich in Bewegung. Auf halbem Weg, an einer Ausweichstelle, begegnen sich die beiden Kabinen. Dann bin ich auf über 800 Meter über dem Meer. In der Ferne sehe ich das Festland. Schiffe liegen in der Meeresenge vor Anker. Hinter mir erheben sich ein paar dicht beurwaldete Bergketten. Hier oben tummelt sich auch ein Affenklan.
Am nächsten Tag kommen die Studenten wieder vorbei. Seit ich hier draußen wohne, wird der Streifen Strand immer schmäler. Der Professor erklärt mir, dass in drei Tagen Springflut sei, also der höchste Wasserstand, und dass da der Strand ganz verschwindet. Es bliebe mir da nur, direkt im Urwaldrand zu schlafen. Der Professor hat eine Idee: Wenn ich wolle, könnte ich unterm Dach der Fischerkneipe schlafen. Der Wirt sei ein Bekannter von ihm und bestimmt einverstanden. Also sammle ich am Nachmittag meine Siebensachen und mache mich auf den Weg zur ‚Spielhalle‘. Der Wirt will nichts für die Behausung. Also kaufe ich einen fritierten Fisch bei ihm, damit ich wenigstens Kunde bin. Und wie bin ich in der kommenden Nacht froh, umgezogen zu sein! Es geht ein so starkes, nicht enden wollendes Tropengewitter nieder, dass ich Angst habe, der Blitz trifft die Bude oder der Sturm bläst sie ins Meer.
Am nächsten Morgen sehe ich eine große Menschenansammlung am Strand. Ein Boot, wie das, welches die Pfosten geholt hatte, kommt rückwärts an den Strand gerudert. Im Heck liegt ein Netz, dessen Anfang an Land gereicht wird. Dort wird es verankert, während das Boot hinausrudert und dabei langsam das Netz aussteckt. Das Netz ist so 1 Meter 50 hoch und besitzt oben Korkschimmer, die in der Trageleine eingearbeitet sind. Unten scheint es leicht beschwert zu sein. Das Boot beschreibt einen Halbkreis, während ein Fischer fortlaufend das Netz aussteckt. Als es ganz draußen ist, rudern sie mit dem Ende zum Strand. Hier nehmen es die Männer und Frauen in Empfang. Nun werden beide Enden gleichzeitig auf den Strand gezogen. Das Netz hängt wie ein Vorhang im Wasser und zwingt die Fische, die sich im oberen Bereich befinden, zum Strand zu schwimmen. Hier sind schon die Kinder bis zum Bauch im Wasser und versuchen mit Keschern die ersten zu erwischen. Je kleiner der vom Netz umgebene Raum wird, um so mehr quirlt das Wasser vor Fischen, die sich manchmal bis auf den Strand flüchten. Jetzt geht die große Ernte los. Meist mit bloßen Händen werden die Fische ergriffen und, damit es schnell geht, weit auf den Strand geworfen, wo sie leicht eingesammelt werden können, da ihr glitschiger Schleim voller Sand ist. Ich fühle mich wie auf einem Volksfest, so ausgelassen ist die Stimmung. Und alles wird am Ende geteilt.
Die Fischer fragen mich, ob ich mal mit hinaus auf Fang fahren will. So ein dreißig Stunden Törn. Und ob ich will! Morgen gegen Mittag soll es losgehen, und am nächsten Nachmittag oder Abend zurück. Ich schaue mir das Boot an. Vielleicht 9 Meter lang, 3 Meter breit. Und damit hinaus aufs weite Meer? Ja, und was mach ich mit meinem Geld, dem Ticket und den Papieren, falls wir absaufen? Oder falls das Piraten sind und keine Fischer? In der Früh gehe ich gleich zum Touristenbüro und deponiere meine Travellerschecks und das Schiffsticket in ihrem Safe. Meinen Pass vertraue ich den zwei deutschen Freunden an. Ich halte sie für korrekt. Meinen Rucksack lasse ich in der Kneipe. Nur in Badelatschen, Turnhose und Hemd gehe ich an Bord, der offiziellen Arbeitskleidung der Fischer von Penang. Doch ehe es losgehen kann, muss noch Diesel getankt werden. Das geschieht mit einem Fass, das über den Steg bis zum Boot gerollt wird. Dann angesaugt, und die Schwerkraft macht den Rest. Ein LKW hat Eis angeliefert. Jede Bootsbesatzung schnappt sich so einen Block, etwa 1 Meter x 0,5 x 0,25 groß, und schiebt ihn über den Steg zu ihrem Boot. Dort wird eine Rolle an einem der Pfosten befestigt, darüber ein Seil mit einer Zange an einem Ende. Damit gelangt der Klotz an Deck. Damit er nicht durch die Schiffsbewegung ins Rutschen kommt, legt man ihn auf eine Matte aus Kokosfasern. Sogleich wird ein Teil davon mit einem Beil klein gehackt, in Sacktuch gefüllt, damit es nicht zu schnell schmilzt, und in zwei kleinen Luken verstaut. Ebenfalls der nun leichtere Rest des Blockes. Von da wird es dann später über die einzelnen Kisten und Körbe mit Fang gestreut. Der Steg erstreckt sich gut 50 Meter in die Bucht hinaus. Er ist so gebaut, dass auch bei Niedrigwasser noch Boote am äußeren Ende anlegen können. Jetzt liegt gerade ein gutes Dutzend Fischerboote am Steg. Manchmal zwei oder drei nebeneinander. Es herrscht emsiges Treiben. Die Mannschaften bereiten alles für die baldige Ausfahrt vor, die Kinder hüpfen dazwischen herum, angesteckt von der Aufregung der Ausfahrt. Warum fahren alle zugleich auf Fang aus? Ist gerade ein günstiger Zeitpunkt zum Fischen, oder braucht ein Großhändler dringend Fische? Laufen die Boote nur bei hohem Wasserstand ein und aus? Aber es spricht keiner Englisch, und man wird ja sehen...
Der Kapitän, der auch Maschinist ist, und je nach Bedarf in alle Rollen schlüpft, macht sich am Motor zu schaffen. Der ist das Herz und die Muskeln des Schiffes. Er sieht ziemlich alt aus. Etwas öliges Bilgenwasser bewegt sich im Rhythmus der See unter seiner Befestigung und zwischen den Spanten. Der Motor liegt gleich hinter dem Ruderhaus in einem kleinen Abteil, erreichbar vom Ruderhaus oder durch eine Luke im Deck. Hier riecht es nach Diesel, während sonst überall der Geruch von Fisch dominiert. Das Boot ist bereit. Die Netze und deren Schleppleinen liegen an Deck, fertig zum Ausstecken. Es ist wenig Raum auf dem Kahn. Das Ruderhaus nimmt einen Teil des hinteren Drittels ein. Vor diesem steht ein kleiner Mast mit einem Ladebaum, der die Funktion eines Kranes übernehmen kann. Vor dem Mast geht eine drehbare Welle querschiffs fast über die ganze Breite, mit einem Spillkopf (felgenförmige Trommel, dient zum Hieven) auf jeder Seite, womit seitlich am Ruderhaus vorbei die Schlepptrossen von Netz eingeholt werden können, die Festmacherleinen oder die Ankerkette, als auch das Ladegeschirr betätigt werden kann. Auf dem Vordeck befinden sich zwei Luken, hinter dem Ruderhaus und dem Motorschacht eine. Diese sind durch ein 20 Zentimeter hohes Süll (Umfassung) eingefasst und können mit einem Deckel seefest verschlossen werden. Die ersten Boote legen ab. Unser Kapitän steckt die Kurbel ein, ein paar Handgriffe am Motor, dann wird gedreht. Der Antrieb muss ein Getriebe haben mit Kupplung und einer Schwungmasse. Nachdem diese in Drehung gesetzt ist, legt jemand einen Hebel um und der Motor wird durch diese in Bewegung gesetzt. Mit viel Qualm und Knallen erwacht er zum Leben. Das Boot vibriert gehörig. Doch einmal der Motor warm, und die Drehzahl erhöht, legt sich das weitgehend. Dann haken die Kinder die Festmacherleinen aus, die Männer drücken das Boot leicht mit dem Vorschiff in Richtung See, der Gang rutscht etwas kratzend rein, etwas mehr Gas, und der Steg verschwindet achteraus. Einzelne Möwen lösen sie aus dem kreisenden Pulk und nehmen die Verfolgung des Bootes auf. Der leichte Fahrtwind macht die Fahrt angenehm. Der Kapitän am Steuer nimmt Kurs aufs offene Meer. Jedes Boot hält vom anderen genügend Abstand. Sie sind vier an Bord, plus mir. Da bleibt nicht viel Raum. Die zwei Jüngsten steigen in die Luke und zerkleinern das letzte Eis.
Der Kapitän betätigt das kleine Steuerrad, das mit Ketten, die am unteren Rand der Reling verlaufen, mit dem Rudermechanismus verbunden ist. Diese laufen um gefettete Rollen und haben mit der Zeit etwas Spiel bekommen. Vor dem Steuerrad hängt ein Magnetkompass an der Wand des Ruderhauses. Dann sind wir im Fanggebiet angekommen. Die Fahrt wird herabgesetzt. Alle, außer dem Mann am Ruder, machen sich ans Ausstecken des Netzes. Ich habe nicht viel Ahnung von der Fischerei. Ich sehe aber, dass es sich um ein Schleppnetz handelt, was da langsam ausgesteckt wird, in dem Maße, wie das Boot vorwärts fährt. Was bleibt, ist die Öffnung des Netzes, wie ein Trichter oder ein großes Maul. Oben sind Schwimmkörper befestigt, die es wohl auf eine bestimmte Höhe halten sollen, unten Gewichte, die bewirken, dass das Maul offen bleibt. Als dieses vorsichtig weggefiert ist, werden auf jeder Seite die Schleppleinen auf die richtige Länge gefiert und dann belegt. Inzwischen hat sich das Netz gut mit Wasser gefüllt, die Leinen straffen sich und bremsen das Boot. Jetzt wird dem Motor Saft gegeben. Er hat Arbeit. Anders die Mannschaft, die sich für ein paar Stunden in den Schatten legt, erst Karten spielt und dann schläft, gegen die schräge, hoch aufragende Verschanzung am Bug des Schiffes gelehnt.
Ich stehe mit dem Kapitän in der engen Ruderbude und schaue genau, was er macht. Dann frage ich durch Zeichen, ob ich mal übernehmen kann. Dieser überlässt mir, etwas skeptisch seinen Platz, nachdem er mir auf dem Kompass den zu steuernden Kurs gezeigt hat, und die Zahl genannt. Ich wiederhole die mir unverständlich klingende Zahl, wie es beim Übernehmen des Ruders auf allen Schiffen Pflicht ist, und konzentriere mich auf Kompass und Rudermechanismus. Schon bald entspannt sich mein Kapitän und raucht mit den Anderen eine Zigarette. Inzwischen ist es später Nachmittag geworden. Die anderen Boote sind als Punkte auf dem Meer zu sehen, das Festland ist zu einem schmalen Streifen geschwunden. Wir scheinen aber parallel dazu zu fahren. Nach einer Weile ist Manöver angesagt. Vielleicht hat der Kapitän am Klang des Motors gehört, dass das Netz voll ist. Er übernimmt wieder das Ruder und stoppt die Maschine. Die Netzleinen werden von den Pollern gelöst und um die Spillköpfe gewickelt. Das Spill wird mit dem Motor gekoppelt, was es auf Dauerdrehung bringt. Durch bloßes Lockerlassen der Leine kann man bewirken, dass es leer dreht, durch Wegholen (Ziehen), greift die Leine auf dem Kopf und zieht das Netz ein. Der schwierigste Augenblick ist, als die Netzöffnung über eine Rolle am Heck an Bord kommt. Alle sind voll mit dem Bergen des Netzes beschäftigt. Um nicht im Weg zu stehen, gehe ich aufs Vorschiff und schaue von dort aus zu. Als das Netz an Deck liegt, bleibt nur noch der Steert, das dünne, zugebundene Ende, in dem sich die Fische angesammelt haben. Jemand schlingt schnell einen Stropp (Schlinge) darum, und über einen kleinen ‚Galgen‘ hievt man den Steert an Deck. Alle machen zufriedene Gesichter. Dann wird die Leine, die den Steert verschließt, gelöst, und der Fang ergießt sich auf das Achterdeck. Das ist der spannendste Moment des Abends: zu sehen wieviel von welchen Fischsorten sich darin befinden! Die Fische fließen förmlich über das Deck, nur von Lukensüll und den Bordwänden zurückgehalten. Da krabbeln ein paar Krabben und wollen sich aus dem Fischsalat befreien. Flink werden diese eingesammelt und in Eimer geworfen, bevor sie jemanden schnappen können oder das Weite suchen. Einige Fische haben sich in den Maschen des Netzes verfangen. Sie werden aus ihrer misslichen Lage befreit und zu den anderen geworfen. Alles was sonst noch daran hängt, wird entfernt und geht zurück ins Meer. Schnell muss das Netz wieder vorbereitet und ausgebracht werden. Die Fischer waten förmlich in den Fischen.
Jetzt geht es ans Sortieren. Schon zu Beginn hatte ich viele flache, ineinander gestapelte Körbe bemerkt. Diese werden jetzt geholt und direkt auf die Fische gelegt. Ich versuche, mich wenigstens da als nützlich zu erweisen. Mit flinken Händen werden die Fische sortiert und landen in den entsprechenden Körben. Quallen werden vorsichtig herausgepuhlt und in Eimern gelagert. Sie gehen erst über Bord, wenn das Netz wieder eingeholt ist, um sie nicht erneut darin zu haben. Alles andere Unbrauchbare fliegt weit vom Boot ins Wasser. Ich gebe mir Mühe. Aber ich sehe ja selber, bis man mir gezeigt hat, was über Bord geht, was in welchen Korb soll, und wie die Größen sortieren, vergeht zu viel Zeit. Der Skipper merkt das auch. Er ruft mich ans Steuerrad. Er macht die Positionslichter an, alles Petroleumfunzeln, die nicht weit leuchten. Aber die großen Schiffe, deren Lichter wir bisweilen sehen, fahren weiter draußen. Dann macht auch er sich ans Sortieren. Die Hecklampe dient zugleich als Decksbeleuchtung. Ich wundere mich, wie die Fischer bei so schwachem Licht die Fische erkennen. Sie scheinen durch den vielen Umgang mit Fischen deren Tastsinn der Mittellinie übernommen zu haben. Ein kleiner Hai versucht, sich mit heftigen Schwanz-bewegungen zu befreien. Bevor der Unheil anrichten kann, wird er mit einem Bootshaken getötet und verschwindet in einer Luke. So vergehen wohl zwei Stunden. Das Deck leert sich langsam von der Fischflut. Korb um Korb verschwindet unter Deck in den verschiedenen Abteilungen, gut mit Eis bedeckt. Bevor alles fertig war, hatte jemand schon auf einem Benzinkocher Wasser aufgestellt. Dahinein warf er die drei schönsten Krabben des Fanges. Diese teilten wir unter uns. Dann war eine Pause angesagt, bis zum nächsten Netzeinholen. Nach einer Zigarette legte sich ein jeder irgendwo hin. Nur der Kapitän blieb am Steuer.
Nach dem Einholen des zweiten Netzes fing der Motor an zu husten. Während die Anderen sich ans Sortieren machten, schraubte und klopfte der Kapitän am Motor herum. Das war gar nicht so einfach, mit der Schicht von Fischen auf dem Deck. Zum Glück hatte ich meine Taschenlampe dabei. Wahrscheinlich war es Wasser oder Dreck im Sprit. Und, oh Wunder, der Motor sprang nach längerem Kurbeln wieder an, und das Netz konnte erneut übers Heck ins Wasser. Bevor der Fang ganz aufge-arbeitet war, färbte sich der Horizont leicht rot. Als dann die Sonne aufging, legten wir uns, anstatt das Schauspiel zu betrachten, todmüde wieder für eine Stunde hin. Später frittierte jemand ein paar der schönsten Fische und wir aßen sie mit etwas kaltem, wohl schon an Land vor-gekochtem Reis. Mit den Händen, alle zusammen aus einem Topf. Dazwischen starken Tee. Das brachte uns wieder auf die Beine. So ging es dann weiter, bis zum Nachmittag. Seit einer Weile hatten wir wieder Kurs auf die Insel genommen. Wir sahen, dass auch die anderen Schiffe ihre Richtung geändert hatten. Der Fang war gut gewesen, und wir waren das erste Boot, das zurückkam. Irgendwie erschien mir das alles wie ein Wettlauf. Wer am meisten fängt und als erster zurück ist, dem winken die besten Preise! Den letzten Fang befreiten wir nur von den Quallen und dem Gammel und schaufelten ihn unsortiert in Körbe. Diese gingen, einmal festgemacht, als erstes von Bord und wurden an Land verlesen oder so an kleinere Händler verkauft. Der gekühlte Teil des Fanges wurde in Körben vom Laderaum an Deck gereicht, von da auf den Steg und dann gleich an Land getragen und im Schatten eines Baumes aneinander-gereiht. Doch damit hatten wir vom Boot nichts mehr zu tun.
Auf dem Steg standen die ersten Händler, dickliche Chinesen mit öligen, nach hinten gekämmten Haaren, und wühlten im Eis um die Ware zu begutachten. Sie begleiteten die Körbe bis an Land. Legten bunte Zettel darauf, die sie aus einem Block rissen, auf denen sie etwas notiert hatten. Bald wurden die Körbe in einen LKW geladen. Ich hatte den Eindruck, dass die Fischer in einer Genossenschaft zusammenarbeiteten, denn es war immer dieselbe Person, die mit den Aufkäufern verhandelte. Inzwischen kamen nach und nach auch die anderen Boote an. Kinder kamen scharenweise mit Eimern auf den Steg gerannt, lachend und sich an-schubsend. Waren das die Kinder der Fischer? Jedenfalls sprangen sie auf die Boote und sammelten alles Unverkäufliche ein, das herumlag. Auch in den schon sortierten Körben fanden sie immer noch etwas, was nicht dort hineingehörte oder zu klein war. Dann rannten sie mit ihrem Eimer oder Körbchen nach Hause, um manchmal erneut zurück zu kommen. Ohne zu zahlen. Der Beifang schien für alle zu sein. Kein Streiten um die Fische, nur Lachen und viel Spaß. Was konnte ich noch groß helfen? Ich war zu neu in diesem Beruf! Ich dankte den Fischern für die Ausfahrt und ließ sie beim Aufklaren ihres Bootes zurück. Während der nächsten Tage erwartete ich sie mit den anderen vom Dorf auf dem Steg, wenn sie heimkahmen. Wenn wir uns in der Dorfkneipe trafen, tranken wir eine Fanta zusammen oder spielten ein Match Tischfußball. Ich versuchte ihnen zu zeigen, wie man bei uns spielte, ohne die Stangen mit den Spielern rundum zu drehen. Doch sie hatten mehr Freude daran, die Figuren schnell rundum zu drehen, wenn der Ball in die Nähe kam. Und wenn der Ball dann durch die halbe Hütte flog und auf dem Billardtisch landete, dann schallte ihr Lachen bis in den Kokoshain.
Als ich dann aufbrach, gab mir der Vater Rafis, des Jungen, der die Kokosnüsse gepflückt hatte, seine Adresse. Er wollte, dass ich in Deutschland für seinen Jungen einen Platz an einer Schule besorge, damit er aus diesem Elend herauskäme und es einmal schöner haben würde. Ich erfüllte seinen Wunsch nicht. Einen Engel entfernt man nicht aus dem Paradies…
Die Fähre setzte mich auf dem Festland ab. Ich hatte mein Ticket und Geld aus dem Safe zurückgeholt, und hatte mit den zwei Deutschen noch ein Bier getrunken. Diese waren begeistert von der Insel, wollten aber bald zurückfahren, sonst würde ihr Rückflugticket von Bangkok verfallen. Gute 700 Kilometer lagen vor mir. Ich hatte 5 Tage Zeit dazu. Notfalls gäbe es immer noch den Bus. Etwas schwer war mir schon zumute, als ich wieder auf meinem Rucksack am Straßenrand saß. Ich dachte an die Fischergemeinschaft, deren Leben ich für kurze Zeit geteilt hatte. Ihre Lebens- und Arbeitsweise kam mir ideal vor. Eine heile Welt! Aber mindestens ebenso stark wie die Sehnsucht danach war mein Fernweh. Ab und zu hob ich die Hand, um den wenigen vorbeifahrenden Autos zu zeigen, dass ich mitgenommen werden wollte. An meinem Rucksack hing das Filzpüppchen, das Marion mir zum Abschied gebastelt hatte und lachte mich an. Jemand nahm mich ein paar Kilometer mit und setzt mich in einer Stadt ab. Ich lief eine Weile, bis sie hinter mir lag, denn dort kam nur Nahverkehr vorbei. Ich zog es vor, an einem schönen Ort zu sitzen wo es was zum Schauen gab, anstatt mich von Auspuffen umblasen zu lassen.
Ich zog das Buch von Steve heraus und arbeitete mich darin weiter. Dem Autor nach sind alle Wege zur Selbstfindung erlaubt. Ob natürliche oder künstliche, also Meditation und Yoga oder Drogen wie LSD. Aber wozu zählten Marihuana, auch Buddha-Gras oder Ganga benannt, nach dem heiligen Fluss oder der Göttin. Das waren doch natürliche Kräuter! Wie Pfefferminz und Kamille. Manche Sadhus rauchten sich die Hucke voll damit, und wie ich gesehen hatte, waren manche ganz schön weit vorwärts gekommen auf dem Weg der Selbstverwirklichung! Nicht, weil sie auf Nagelbetten schliefen, sondern viele wurden als Meister verehrt, waren angesehene spirituelle Lehrer. Ich finde, es ist jedem seine eigene Sache, was er macht, um ein besserer Mensch zu werden…
Ein Auto, das 10 Meter hinter mir zum Stehen kommt, weckt mich aus meinen Gedanken. Es war ein grauer Holden, eine Art asiatischer Opel. Darin ein etwas korpu-lentes, bürstenhaariges Bleichgesicht, voller Sommer-sprossen. Ich tippte auf einen Irländer. Er war aber Amerikaner. Terry Holmes, und wir waren gleich voll im Gespräch. Beim Trampen stößt man auf die unter-schiedlichsten Menschen. Manche Fahrer sagen nur drei Worte und sind fast mürrisch. Da fragt man sich, warum die einen überhaupt mitgenommen haben. Andere sind unterhaltsam, und alles läuft wunderbar. Dann gibt es die Übergesprächigen, die dich mit ihrem Psychotherapeuten verwechseln und die Aufdringlichen. Und da fragt man sich auch, warum die einen aufgelesen haben. Terry hatte ich anfangs dieser letzten Gruppe zugeordnet. Aber, dachte ich, das liegt daran, dass er schon ewig keinen Weißen gesehen hatte. Jedenfalls arbeitete er für eine amerikanische Erdölfirma und war schon sein 6 Monaten in Malaysia. Er war in seiner Jugend auch viel getrampt und hatte sich wohl mal geschworen, jeden Tramper mitzunehmen, falls er endlich von dem gottverlassenen Fleck, wo er gestrandet war, wieder wegkomme. Alters-mäßig gehörte er eher zu Jack Kerouac und den Beatniks, der Vor-Hippie-Bewegung der 60er Jahre. Jetzt hatte er Familie und diesen Job, der ihm auch das Reisen ermög-lichte, aber eben auf andere Art. Was wäre er froh, er könnte mal wieder, so wie früher, halt so wie ich, jetzt…
Mittags lud er mich zum Essen ein, was ich gerne annahm. Ich wollte was Billiges wählen. Er lachte nur, und meinte, das ginge alles auf Kosten der ‚Pacific Oil‘, ich solle nur zuschlagen! Seine Kinder trampen im Augenblick bestimmt auch irgendwo in den Staaten, und er wünscht ihnen einen ähnlichen Empfang von Seiten der Autofahrer, wie er ihn mir bereitet… „In Kuala Lumpur seht die größte Moschee der Welt, die solltest du dir unbedingt anschauen!“ rät er mir beim Weiterfahren. Wir befinden uns schon in den Vororten. Eine Art Stadtautobahn umgeht das Zentrum. Ich sehe das Bauwerk von Ferne. „Ich will nicht in diese Riesenstadt eintauchen“, sage ich, „Großstädte sind sich zu ähnlich. Laut und teuer. Ich will lieber weiter!“ Er versteht und lässt mich an einer Ausfallstraße aussteigen. Ein gutes Pensum für heute, denke ich. Bald nimmt mich ein alter Pickup mit. Der Fahrer spricht kein Englisch. Er lässt mich nach 30 Kilometern aussteigen und biegt seitlich zu einer Plantage ab. Es ist bald dunkel. Also verlasse ich die Straße und laufe in ein kleines Gehölz auf der anderen Straßenseite. Ich bin noch satt vom Mittagessen. Koche aber, mehr aus Tradition, einen Tee, weil es noch früh genug ist. Dann liege ich, von Mücken umsummt, unter meinem indischen Tuch.
Oft sagen die Leute, sie hätten nie den Mut, so zu reisen! Ist nicht der erste Schritt der mutigste? Und ist dieser selbst nicht nur die Folge einer Schnapsidee oder eines Traumes? Plötzlich findet man sich in einer Bewegung wieder, die sich selbständig gemacht hat, wo man den nächsten Schritt vielleicht gezwungenermaßen macht, um nicht zu fallen, oder aber Freude daran findet, und ihn fast wie einen Tanz ausführt. Mut ist Akzeptieren des Alltags. Was ist das Gegenteil von Mut? Ist das Angst? Angst ist das kribbelnde Gefühl, das die Nackenhaare sträuben lässt, das den Atem anhält und dich eins mit dem Schatten werden lässt. Das Herz schlägt schneller, du wartest ab, bereit, wegzurennen oder zu kämpfen oder versteckt zu bleiben. Angst und Mut gehen oft Hand in Hand. Ohne Angst wirst du tollkühn, ohne Mut sitzt du bibbernd da. Wenn ich draußen schlafe, ist das nicht unbedingt ein Zeichen von Mut. Das ist Romantismus oder knappe Kasse. Wie viele Arme schlafen unter freiem Himmel, ohne dass man sie deshalb mutig nennt! Angst kommt plötzlich auf. Ausgelöst durch ein Geräusch, durch einen Instinkt. Angst ist gut. Angst leitet zur Vorsicht! Wenn ich mein Messer im Schlafsack habe, kann das beides sein. Doch sollte das einen nicht so weit bringen, allen zu misstrauen.
Wer ist der Feind des Armen? Der Reiche? Oder der andere Arme? Oder anders gesehen: Wer ist der Freund des Armen? Der Reiche? Ich glaube eher, der andere Arme! Unter Armen habe ich große Hilfsbereitschaft gefunden. Sie sind gewohnt, wenig zu haben und wissen, was Teilen ist. Klar, dass zu krasse Armut zu Kurzschlusshandlungen führen kann. Reden wir lieber nicht von zu großem Reichtum… Bisher hat noch kein Armer einen Krieg angezettelt! Armut – Reichtum… Natürliche Gegensätze wie kalt und warm? Oder vom Menschen geschaffen? Ist der Reiche ursprünglich nur so geworden aus Angst vor Armsein? Doch selbst, wenn man die Ursprünge unserer Lebensumstände ergründen würde, änderte das noch lange nichts an der Tatsache, dass die große Mehrheit der Menschen arm bis sehr arm ist. Das Regierungssystem oder Wirtschaftssystem, das die Armut abschafft, würde in die Geschichte eingehen, und sein Beispiel würde den Weltfrieden schaffen helfen. Religionen, die oft nur dazu dienen, den gegenwärtigen Zustand zu rechtfertigen, würden überflüssig, Konflikte könnten in Sportveranstaltungen gelöst werden. Wir würden uns mit ‚Bruder‘ und ‚Schwester‘ anreden, und nicht mehr mit ‚Herr‘ und ‚Madame‘.
Man wird ja noch träumen dürfen, selbst mit einem Messer unter der Decke…