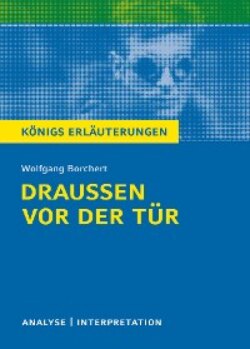Читать книгу Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert. - Wolfgang Borchert - Страница 4
Оглавление| 1. | Das Wichtigste auf einen Blick – Schnellübersicht |
Damit sich jeder Leser in diesem Band sofort zurechtfindet und das für ihn Interessante gleich entdeckt, folgt hier eine Übersicht.
Im zweiten Kapitel wird Wolfgang Borcherts Leben beschrieben und auf den zeitgeschichtlichen Hintergrund verwiesen:
Wolfgang Borchert lebte von 1921 bis 1947 vorwiegend in Hamburg. Der Zweite Weltkrieg brachte ihn an die Ostfront, in Lazarette und ins Gefängnis, wo ihm die Todesstrafe drohte. Er kehrte in ein zerstörtes, hungerndes und von einem kalten Nachkriegswinter zermürbtes Hamburg zurück.
Der militärische Zusammenbruch Hitlerdeutschlands und die bedingungslose Kapitulation am 8. Mai 1945 war auch die Befreiung vom Faschismus und bedeutete die Abrechnung mit der Vergangenheit.
Eine besondere Situation ergab sich durch die Aufteilung Deutschlands in vier Besatzungszonen, in denen auch kulturpolitisch unterschiedliche Konzeptionen wirkten.
Wolfgang Borchert hatte, wie seine gesamte Generation, das bewusste Leben nur im Nationalsozialismus geführt – als die Nazis an die Macht kamen, war er 12 Jahre alt – und so kaum andere Erfahrungen als die dort gemachten zur Verfügung, als der Krieg zu Ende war. Für ihn galt, wie für viele andere Künstler, dass sie Alternativen nur aus der Literatur kannten.
Im dritten Kapitel geht es um die Textanalyse und -interpretation.
Draußen vor der Tür – Entstehung und Quellen:
Draußen vor der Tür entstand im Spätherbst 1946, zuerst unter dem Titel Ein Mann kommt nach Deutschland. Quellen waren vorwiegend Borcherts Erlebnisse an der Front, im Gefängnis und im zerstörten Hamburg nach Kriegsende. Dennoch gibt es Ähnlichkeiten mit Georg Büchners Woyzeck (1878) und Parallelen zu Ernst Tollers Tragödie Hinkemann (1921/1922). Von Einfluss waren Borcherts Vorbehalte gegen Goethes Faust, sein literarisches Interesse für expressionistische, romantische und neuromantische Strömungen sowie für die Kunst Ernst Barlachs.
Inhalt:
Der Unteroffizier Beckmann, 25 Jahre alt, mit zerschossenem Knie und Gasmaskenbrille, kommt 1945 ins zerstörte Hamburg zurück und findet seine Vergangenheit – Ort, Familie, Eltern – zerstört vor. Sein Selbstmordversuch scheitert: Die Elbe, in die er sich stürzt, will ihn nicht. Nun macht er sich auf die Suche: Seine Frau hat einen anderen Mann, ein Sohn wurde Opfer eines Bombenangriffs, die Eltern suchten den Freitod; die Verantwortung für die Toten zurückzugeben, gelingt ihm nicht. Auf Arbeitssuche in einem Kabarett wird er abgelehnt. Beckmann kann mit seiner Schuld und Vergangenheit nicht leben, findet keinen Ausweg und keine Antworten.
Chronologie und Schauplätze:
Das Stationenstück steht formal in der Tradition von Georg Büchners Woyzeck und des expressionistischen Dramas, ohne ihm in der Idee der Welt- und Menschheitserlösung zu folgen. Es spielt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, in der Zeit der Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft, in Hamburg. Die Stationen korrespondieren mit Borcherts Erfahrungen. Auffallend ist eine Parallelität zu Goethes Faust. Der Tragödie erster Teil, zu dem das Stück einen Gegenentwurf darstellt. Die Erzählung Die lange lange Straße lang ist eine epische Variante des Stücks.
Personen:
Die Hauptpersonen sind
Beckmann:
ausgewiesen als „einer von denen“ (HL S. 4/R S. 6), die er als Typ des Heimkehrers repräsentiert;
Individualitätsmerkmal des Familiennamens;
äußere Attribute: Knieverletzung und Gasmaskenbrille;
das leidende Individuum in einer existenziellen Notsituation.
Der Andere:
Wesen mit den „tausend Gesichter[n]“ (HL S. 11/R S. 15);
das Gegenwesen zu Beckmann, der als Neinsager den Jasager benötigt;
Verwandtschaft mit Mephisto.
Ein Mädchen:
„dessen Mann auf einem Bein nach Hause kam“ (HL S. 4/R S. 6);
hilfsbereit und freundlich;
ihr Mann ist bei Stalingrad vermisst;
tritt als einzige Person außer Beckmann/der Andere in drei Szenen auf;
sie ist einer Maria Magdalena ähnlich, jedoch in umgekehrter Situation.
Frau Kramer:
„die weiter nichts ist als Frau Kramer, und das ist gerade so furchtbar“ (HL S. 4/R S. 6);
Typ des Mitläufers und Denunzianten;
steht für eine Kleinbürgerlichkeit, die den Faschismus ermöglichte und ihn nach seiner Niederlage als geistiges Potenzial in der Nachkriegszeit weiterführte.
Direktor eines Kabaretts:
muss sich mit dem Anspruch Beckmanns, ein Künstler zu sein, auseinandersetzen;
passt sich jeder Situation an und besitzt selbst keine Haltung;
seine ästhetischen Positionen sind ohne Konzept;
Unwissenheit wird zum Maßstab gemacht und steht für zahlreiche Deutsche nach 1945.
Elbe und Gott:
erscheinen personifiziert und sprechend;
in sie werden reale Personen projiziert: die lebenstüchtige Mutter Borcherts und der zurückhaltende, leise Vater.
Stil und Sprache:
Das grundsätzliche sprachliche Problem: Borchert ringt um „Wahrheit“ mit den Mitteln einer missbrauchten Sprache. Fragen, Wiederholungen und Interjektionen sind für den Sprachfluss bedeutend. Die Sprache ist auffällig und einmalig, eine Mischung aus zugespitzter Einfachheit und ausufernder Bildhaftigkeit, lapidarer Feststellung und schichtweise aufgelegter Bedeutungsvielfalt.
Interpretationsansätze:
Das Stück ist ein Maßstäbe setzendes Werk über die verlorene männliche Generation, die – falls sie überlebte – ihre Jugend im Krieg, in Gefangenschaft oder als Kriegsheimkehrer erlebte und diese Erfahrungen in das weitere Leben einbrachte. Das Stück versucht, dem zum Objekt degradierten Menschen wieder zum Subjekt zu verhelfen. Es bedient sich eines Realismus, der die offenen Fragen in Visionen zu beantworten sucht, aber keine Antworten findet und deshalb außerhalb der bürgerlichen Ordnung landet (siehe Titel des Stücks).
Zahllose Ansätze: vom umgekehrten Passionsspiel über ein Beispiel für eine Höllenfahrt bis zur Rehabilitation der Schuldigen, die Verantwortung und die Zurücknahme.
Verbindung von realistischen Details und irrationalen Elementen;
mythische Dimension des Stücks;
das „Delirium des Ertrinkenden“.
Rezeptionsgeschichte:
Die Rezeption vollzog sich in drei Phasen.
Das Stück wurde zwischen 1947 und 1949 das bedeutendste Theaterereignis in Westdeutschland.
Die Stellung des Stücks in der Theaterentwicklung nach 1945.
Die zwiespältigen Urteile der Kritiker hatten ihren Gegenpol in den Bekenntnissen der Generationsangehörigen.