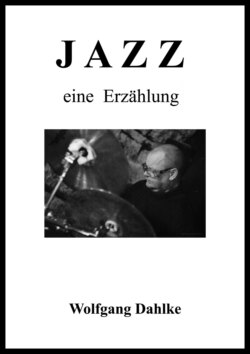Читать книгу Jazz - Wolfgang Dahlke - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRO
ОглавлениеDie meiste Zeit ist Lucius Mitchell verwirrt. Wenn er sich nicht gerade über irgend jemand ärgert. Vor allem: dessen unverdienten Ruhm. Oder sein eigenes Schicksal beklagt, sich Sorgen macht, von Eifersucht oder einem Angstanfall geplagt wird. Dabei ist er nicht der geborene Verlierer. Er hat gute Talente. Aber es liegt ihm nicht, sich in den Vordergrund zu stellen. Er hasst Angeberei. Erfolg, durch Lügen erzielt, wäre nichts wert. Er hat sich ein Pseudonym zugelegt. Vielleicht war unter Zuhilfenahme eines neuen Namens ein Neuanfang möglich!
Er hatte Musik immer geliebt. Bis er professioneller Jazzmusiker wurde. Die Leute rannten nicht nur immer noch (sondern heute mehr denn je) in Scharen in die Konzerte der bei billigem Rock und Pop mental frühergreisten Verweigerer des Erwachsenwerdens, denen sie mit ihrem knappen Geld durch regelmäßige Plattenkäufe und treu-anhängliche Konzertbesuche seit bald fünfzig Jahren rauschende Existenzen finanzierten. Mit prunkvollen Anwesen in exquisiten Wohngegenden an Waldrändern, Traumstränden oder in Penthouses der Metropolen, in Hotel-Nobelsuiten mit Groupies und Unmengen aller erdenklichen Betäubungsmittel. Der erfolgreiche Rockmusiker, der für sie in den Siebziger Jahren eine Rebellion verkörperte, die sie mit gesellschaftlichem Umschwung oder wenigstens Progress verwechselten, lebte längst das Leben des großbürgerlichen Luxus-Spießers, dessen Lebensgefühl aus dem Geist sinnloser Verschwendung erwuchs. Dieselben Fans, gerieten sie aus Versehen in eines seiner Jazzkonzerte, beschwerten sich bereits am Eingang lautstark über 7 EUR 50 Eintritt. Für die Rolling Stones-Karte vorgestern hatten sie gut und gerne das Zehnfache geschmückt. Die Anzahl der gespielten Akkorde, konnte man als Regel festhalten, und die Höhe des gezahlten Eintritts verhielten sich zu einander in reziproker Proportion.
Lucius führt Tagebuch. Er hat gelernt, dass ein Erlebnis (eine Enttäuschung, Kränkung, ein Schicksalsschlag) besser zu ertragen ist, wenn man sich beim Schreiben seiner Bedeutung versichert. So kommt er selbst zu Wort. Er konzentriert sich dabei auf sich und die anderen, die im Moment für sein Leben eine Bedeutung haben.
Er hatte immer Musiker werden wollen; aber die Szene bleibt ihm fremd. Es wird zu viel gelogen, es geht zu viel um Sex, Herrschaft, und zu wenig wirklich um Kunst. Noch spielt er die Heldenrolle in der von ihm selbst inszenierten Tragödie. Wohin er auch kommt, was immer auch geschieht: seine Erwartung, dass etwas Schreckliches passieren wird, ist bereits da und wartet wie der Igel auf den Hasen. Ich, als der, der ihn kennt (weil er ein wenig wie ich ist) und der die Dinge – im Moment des Schreibens – nüchterner von außen betrachten kann als er, ich glaube nicht an Tragödien. Ich halte es mehr mit der Epik: sieh, was passiert und was du tun kannst, damit es sich ändert. Epik ist, wenn alles beständig im Fluss ist. Wenn nichts, kein Schicksal, kein Charakter, keine Bedeutung ein- für allemal feststehen. Der Stoff der Epik ist unbegrenzt. Er ist die unreduzierte Realität ganz intimer, mikroskopisch kleiner und ganz riesiger, unüberschaubar in die Breite gewachsener Lebensräume, die keine traditionelle Erzählkunst mehr durchmisst. Man könnte in den Gesichtern der vorbeihuschenden Massenexistenzen lesen, hielte man sie am Arm fest. Man könnte ihre Geschichten entschlüsseln, näme man sich die Zeit, sie anzuhören. Könnte die gesellschaftliche Totalität einzufangen versuchen, die sie hervorbringt. Doch da sind sie schon wieder in der anonymen Menge untergetaucht. Und ganze gesellschaftliche Systeme haben sich in dem Moment, da man sie beschreibt, schon wieder verändert und weiterentwickelt. Dennoch versucht der Epiker, gegen den Verfall, gegen das Vergessen, die Fremdheit, anzusammeln, was immer er in die Hände kriegt: Geschichen, Biographien, menschliche Eigenschaften und Verhaltensweisen, Imaginationen, Träume. Er will nicht glauben, dass die oktroierte schlechte Alltagsexistenz nur noch gesichtslose Masken ausspuckt, ohne Zukunft und Vergangenheit – vor allem: ohne Verantwortung. Für sich selbst und für andere. Es gibt immer wieder Charaktere, die Entscheidungen fällen. Natürlich auch solche, die (wie Lucius Mitchell) glauben wollen, dass sie dazu im Moment keine Möglichkeit haben. Keine Energie oder keine Zeit. Und, natürlich: es gibt auch geschichtliche Situationen, in denen keiner mehr individuell verantwortlich ist, keiner mehr allein schuldig ist. Nachdem er mit all den anderen zusammen die Unterlassungssünde begangen hat, es so weit kommen zu lassen. Dann bewegen sich die Kollektive in irrationalen, subjektlosen Massenornamenten. Überrennen andere Völker. Oder stecken Asylantenheime an. Auch davor hat Lucius Mitchell Angst: dass die Debatten veröden und das, was ihnen zugrunde lag: die Theorien. Weil die Menschen nicht mehr miteinander streiten können, sondern gleich zuschlagen. Dass die Bücher verschwinden, weil die Leute sich nicht mehr konzentrieren können. Dass die Musik stirbt, weil die Menschen keine Lust mehr haben, ein richtiges Instrument zu lernen. Und das Spielen dem Computer überlassen. Sogar das Komponieren.
In seiner Studienzeit war er ein optimistischer Humanist; und eigentlich vertraut er noch immer darauf, dass sich letztendlich das Gute durchsetzt, besser: die Vernunft. Oder die herausragende gesellschaftliche Leistung. Na gut, sagen wir, er hofft darauf; ganz sicher ist er sich da nicht. Er will kein »Mann ohne Eigenschaften« werden. Allerdings gewinnt er den Eindruck, dass seine Kompliziertheit heute nicht mehr gefragt ist.
Ich bin nicht wie ihr, widerlich schleimige Opportunisten, die sich mit dem Substanzverlust in der Kultur (Denken, Musik, Kunst, Politik, Verhalten, Partnerschaft) lieber abfinden und daran teilhaben als in Gefahr zu geraten, darunter zu leiden und nicht in Gesellschaft zu bleiben
Das schrieb er in sein schwarzes Buch. Danach war er deprimiert und sprach tagelang mit keinem: er hatte seine wenigen Freunde gekennzeichnet und fühlte sich nun erstmals völlig allein; ein Don Quijote der Kultur. Immer auf der Suche nach neuen Windmühlen.
Der Stoff und die Charaktere dieser Geschichte sind Realerfindungen. Ähnlichkeiten mit wirklichen Personen und Geschehnissen sind einerseits weder beabsichtigt wie andererseits letztlich vermeidlich. Wer vermeint, sich wiederzuerkennen, behielte es am besten für sich. Vermutlich hat es außer ihm ohnedies niemand bemerkt. Wer indes aus der schützenden Maske seines Pseudonyms herauskrakeelt: »Der meint doch mich!« täte dies womöglich aus Eitelkeit. Dummheit will ich nicht unterstellen – so dumm war nicht einmal ein Parteisekretär des längst obsoleten Neuen Deutschland (»Herr Heym, geben Sie's zu: der König David, das bin doch ich, oder?!«). Fiktion ist frei. Ich kann lügen oder die Wahrheit sagen. Erst Richtigstellungen machten der Verdacht zur Gewissheit. Außerdem ist es in Literatur völlig unerheblich, ob etwas stimmt. Solange es wahr ist.
Obgleich Lucius, jedenfalls, so lange er noch Musiker ist, keine Literatur zu schreiben beabsichtigt, macht er sich selbst hin und wieder Notizen über die Künstlichkeit der Konstruktion einer Wirklichkeit, die wir offenbar nur, wenn wir sie extrem bearbeiten, deformieren also, wenn wir sie einschrumpfen und ihrer nicht einpassbaren Ecken und Kanten berauben, zu verstehen in der Lage sind:
Die Wirklichkeit genannte Realinszenierung menschlichen Verhaltens hat, wie jedes andere Theaterstück auch, gewisse Typen. Man nimmt die anderen wahr als abstrakte, verallgemeinerbare Form aus einer Unsumme von Eigenschaften, die gegen die komplizierte Eigentlichkeit ihres Charakters auf das Erkenn- und Verstehbare reduzierte werden: So willst du ihn haben – du kannst ihn so besser begreifen; und vielleicht bist du das, was du an ihm sehen kannst, worauf du ihn eingeschrumpft hast, was dir immer wieder aufstößt, am Ende du selbst!
Eigentlich ist der Stoff der Epik, wie gesagt, unendlich. Nimmt man sich nur einige Charaktere heraus oder konstruiert Figuren, die man für typisch genug hält, Gesellschaft zu vertreten, begeht man also (folgen wir Lucius' Aperçu) bereits eine an sich unzulässige Verkürzung. Aber Literatur, als praktische Philosophie, schielt immer in der Abstraktion zugleich auf das Konkrete, meint im Ausschnitt meist auch das Ganze. Und ein Roman allein kann das versuchsweise Bohren an einer Stelle, unter Vernachlässigung Googol-endlich vieler anderer, ohnehin niemals überwinden. So begnügt man sich mit einigen wenigen Typen, deren Geschichte man eine Zeit lang verfolgt; und ein Roman endet zum Beispiel auf Seite dreihundertundfünfzig – zumal man es sich heute nicht mehr erlauben kann, wie Homer, Cervantes, Fielding, Hugo, Joyce oder Döblin, das ungeduldige Schnelllesepublikum, das lieber auf die Verfilmung wartet, mit ausufernden Plots zu langweilen. Eine Erzählung musste schon immer zwischen zwei Buchdeckel passen, die heutzutage nicht mehr allzu weit voneinander entfernt sein dürfen. Es wird sonst womöglich zu teuer; und die Bindung ist auch nicht mehr das, was sie noch nie war. Literarische Texte widersetzen sich zwar dem Verfall, jedoch sind ihm Bücher seit jeher hilflos ausgeliefert. Sonst rechtfertigt nichts derlei Verkürzungen.