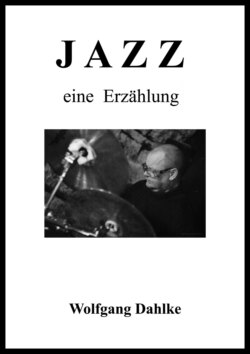Читать книгу Jazz - Wolfgang Dahlke - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
B-PART
ОглавлениеMo. 12.2. Salzgitter, Di. 13. Braunschweig, Do. 15. Hannover, Fr. 16. Emden, So. 18. Lucklum, Mo. 19. Goslar, Mi. 21. Jever, Fr. 23. Oldenburg, So. 25. Oberhausen, Di. 27. Emsdetten, Do. 1.3. Kassel, Fr. 2. Frankfurt, So. 4. Heidelberg, Mo. 5. Esslingen, Mi. 7. Tübingen, Fr. 9. Rottweil, So. 11. Biberach, Di. 13. Fürstenfeldbruck, Mi. 14. Freiburg, Fr. 16. Romans, Sa. 17. Lyon, Mo. 19. Bordeaux, Mi. 21. Santander, Sa. 31. San Sebastian, Mi. 4., Do. 5., Fr. 6.4. London
Es treibt ihm einen angenehm lockernden Schauer in den Rücken, wenn er am Telefon bestimmt und abweisend sein kann. Besonders bei Frauen. So war es auch diesmal wieder gewesen; er hatte sich gesträubt: Was, in zwei Wochen schon? Unmöglich! Er kann Annette nicht einfach sieben Wochen allein zu Hause sitzen lassen! Und warum überhaupt er, haben die anderen alle abgesagt? Außerdem: Er kann nicht über eine so lange Zeit jeden Abend spielen. Dann wird sein Rheuma unerträglich.
Es kommt auf die Länge der Leitung an, ob sein Bluff, irgendwo zwischen Bescheidenheits-Koketterie und sadistischer Kompliziertheit, den oder die am anderen Ende für längere Zeit hilflos zappeln lässt. In diesem Fall Ina. Es drängt sich ihm (in Bezug auf Ina) das Bild einer lachhaften chaplinesken Figur auf, die von einem riesigen, bulligen Pickelgesicht (ihm selbst) hinten am Jackenkragen hochgezogen wird. Ina hat, sagt sie knapp, im Augenblick andere Sorgen und keine Zeit für seine Spiele: Ich kann diese Arie zweistimmig und in sämtlichen Tonarten. Tja, schade, Mensch, vielleicht nächstes mal. Ciao.
Zehn Minuten später ruft er Annette an: Stell dir vor, Ina will mich in ihrer Band mitnehmen. Wir spielen in ganz Europa!
Eine Jazzband ist ein Arbeitsverhältnis. Eine Produktionsgruppe auf Montage. Montage, Dienst-Tage, Frei-Tage. Eine Tour ist der letzte melancholische Versuch, dieses schwierige, fast unmögliche Produktionsverhältnis durch geographische Ausweitung erträglich zu machen, indem man es auf möglichst viele verschiedene Orte in möglichst schneller Abfolge verteilt, damit es keiner mehr merkt.
*
Sie kommen früh in Goslar an, was bedeutet: noch bei Tageslicht, und vom Hotel Kaiserworth am Marktplatz, von wo es nur einen Steinwurf oder einen Weltrekord im Weitspucken bis zum Club ist, schlendern sie in die schmale belebte Geschäfts-Passage. Dann decken sie sich mit Proviant für die nächsten Tage ein. Lucius kauft gern eine intensiv riechende Zahncreme, die lange vorhält: Ah, Ajona, hatte ihn Birgit in der Oberprima begrüßt, du riechst lecker. Ja, damals war er der erste! Heute glaubt er, davon Zahnfleischbluten zu bekommen.
Unter dem Vordach bei Karstadt steht nun Lucius und bewacht die Kartons, derweil die anderen, was sie in jeder Stadt tun, die Musikläden nach irgendwelchen Instrumenten und technischen Neuheiten abklappern, die es – warum bloß? – in Hannover vielleicht noch nicht gibt. Zwanghaft und lächerlich, findet Lucius, der gern mitgegangen wäre. Aber irgendwer muss ja auf die Sachen aufpassen! Insgeheim glaubt er nämlich doch an den kleinen Provinzladen, in dem es in einer verstaubten Ecke die Ludwig Snare für zweihundertfünfzig Ocken gibt.
Der alte dicke Penner mustert ihn, sieht auf die Kartons, wieder zu ihm: Ich war die letzten Jahre ein paarmal drüben in Polen, sagt er, es wird besser. Ihr seid ehrgeizig und fleißig, und es wird nicht mehr lange dauern, dann habt ihr auch, was wir haben. Dann braucht ihr nicht immer rüberkommen und uns die Sachen wegkaufen. Aber, obwohl wir uns gerade so nett unterhalten, möchte ich zum Geschäftlichen kommen: Haste mal'n Euro?
Die Enge von Kleinstädten wie dieser – ganz abgesehen von ihrer liebenswürdig rauh-romantischen Ausstrahlung – hat hinter der vordergründigen Idylle ihrer zuckerguss-verkleisterten Hexenhäuschen-Fassaden für ihn immer etwas undeutlich Bedrückendes. In einer ähnlich dichten, dornigen Neurosenhecke war auch Lucius, als er noch Dieter hieß und von seinen Freunden seiner immerwährenden Unzufriedenheit mit allem und jedem wegen »der kleine Nölprinz« getauft wurde, lange nach der Schulzeit hängengeblieben, ehe ihn dann Nerea wachküsste und nach Heidelberg holte.
Rainer lebt immer noch in der Kleinstadt, in der sie beide aufgewachsen waren, fast vierzig, bei seinen steifen Eltern in einer winzigen Mansarde mit schrägen Wänden. Auch er hatte Berufsmusiker werden wollen, übt seit zwanzig Jahren sechs Stunden am Tag Gitarre und traut sich nicht mehr auf die Bühne, weil er sicher ist, nicht gut genug zu sein. Es gibt jetzt in ihrem Ort, hatte Rainer kürzlich geschrieben, einen Jazz-Verein mit einem dicken Boogie-Woogie-Pianisten als Erstem Vorsitzenden, der in der Zeitung verbreiten ließ, das Jazzpodium habe ihn einst zum drittbesten Jazz-Pianisten des Landes gekürt, und der gegen ihn, Rainer, ein »Vereinsausschluss-Verfahren wegen vereinsschädigenden Verhaltens« angestrengt habe – aufgrund der unbewiesenen (aber von jemand, der sich nicht zu erkennen gab, angeblich bezeugten) »unglaublichen Unverschämtheit«, dass er, Rainer, nachts betrunken in einer Kneipe über ihn, den Ersten »Vorschwitzenden«, hergezogen habe. An den genauen Wortlaut seiner dreisten Beleidigungen konnten sich weder der anonyme Zeuge noch der Vereinsvorstand erinnern. Nur habe man ihn in Verdacht gehabt, er habe bei »Jazz vom Feinsten« auf den Plakaten des Boogy-Virtuosen überall das N ausgestrichen. Er sei zuvor, beteuerte Rainer, der Vereinsspitze lediglich dadurch unangenehm aufgefallen, dass er einige brauchbare Vorschläge gemacht habe, wie die Organisation mehr Mitglieder gewinnen, bessere Pressearbeit leisten und eine demokratische Entscheidungsfindung unter den Mitgliedern per Umfrage erzielen könnte. Außerdem hatte die Provinzpostille seine, Rainers, früheren Erfolge als Musiker in einem Artikel über die städtische Musikszene gewürdigt und erwähnt, dass er mit berühmten Musikern des internationalen Jazz zusammengespielt habe (was den Tatsachen entspricht). Leider habe der Redakteur in seinem Artikel versäumt, die Neugründung des Vereins hervorzuheben und den Ersten Vorsitzenden wenigstens namentlich, wenn nicht gar lobend, zu erwähnen.
Rainer, der sich keiner Schuld bewusst war, dem man aber Arroganz und Starallüren vorwarf, entschuldigte sich beim Vorstand und den Mitgliedern und schenkte dem Verein ein Konzert mit einer international renommmierten Koryphäe, die er persönlich kennt und die seinetwegen gern kam, sich nicht einmal die Flugkosten erstatten ließ und für wenig Geld spielte. Auch das legte ihm der Vorstand als »unerträgliche Renommiersucht« aus. Der Erste Vorsitzende, der bis eine Woche vor dem Konzerttermin weder einen Auftrittsort besorgt, noch die von Rainer selbst geschriebenen Pressemeldungen mitsamt teurem Fotomaterial verschickt, noch den Kartenvorverkauf arrangiert hatte, war bei der Bandzusammenstellung nicht berücksichtigt worden – ein Umstand, der Rainer nun, zu spät, angesichts der offensichtlichen Sabotage durch den Vereinsboss selbst, schmerzlich bewusst wurde.
Die 100 Plakate, die man angeblich vergessen hatte abzuholen, geschweige denn zu verteilen, warf man ihm einen Tag vor dem Konzert in den Hausflur. Er hängte sie noch in derselben Nacht eigenhändig auf, hatte inzwischen auch einen Club besorgt und den Vorverkauf geregelt, ganz nebenbei die Bandproben arrangiert und ohne die geringste Hilfe durch die Vereinsmitglieder einen Workshop mit dem Star organisiert und durchgeführt (die Zeitung schrieb: »als special offer des Jazzvereins«); schließlich beglich er auch die Kosten für die Plakate, für die die Druckerei keine Rechnung ausstellte, um dem Verein die Mehrwertsteuer zu ersparen, der sich daraufhin, da Rainer keine Rechnung vorlegen konnte, unter glaubhaftem Ausdruck tiefempfundenen Bedauerns für nicht zuständig erklärte.
Bis heute habe ihm die Jazzszene der Stadt nicht verziehen, dass er (obgleich stillschweigend und ohne die Sache an die große Glocke zu hängen) daraufhin einfach ausgetreten ist.
Er hatte sich wenig später, so schrieb Rainer weiter, bei der städtischen Musikschule beworben, wo man ihn aber abgelehnt habe, da er kein Diplom vorzuweisen hatte. Sein zusammen mit seiner Bewerbung eingesandtes »Modell eines Zweigs für Jazz und Popularmusik« übernahm die Schule allerdings. Zu den öffentlichen Sessions, die Teil seiner Alphabetisierungs-Vorschläge für die Szene waren und die nun ein ehrgeiziger Musikschullehrer in eigener Regie durchführte, wurde er nicht eingeladen.
Lucius’ Blick streift über die Fassaden, wandert vom Marktplatz über das alte Rathaus, die Marktkirche in Richtung des Hotel Brusttuch. In dieser Kirche könnte er damals gesungen haben, erster Sopran, vorne rechts, mit der Kantorei. Im Winter lugten die frostig geröteten Eisbeine aus den kurzen blauen Wollhosen. Der angststeife Nacken scheuerte sich am harten Kragen der engen gelblich verwaschenen Nyltesthemden wund, an denen sie beim Ausziehen elektrische Schläge bekamen; die unfreiwillig kurzen Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Frisuren standen stramm. Die kleinen polierten Glühbirnen, die oben aus den zahngelben Hemdkragen lugten, waren rot angelaufen vor Scham über: Oh Lamm Gottes, unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet, während die Stones schon sangen: I can’t get noho ... Satisfaction.
Noch immer, wenn er, wie heute, Deoroller kauft, geht ihm Gloria In Exelsis Deo durch den Kopf. Und er muss daran denken, dass er vor gut zwanzig Jahren am Ausgang einer Coop-Filiale mit zwei nicht bezahlten Bak-Stiften erwischt worden war. Die Ermittlungsbehörden hatten ihm geschrieben: die Staatsanwaltschaft Hannover beschuldigt Sie, fremde bewegliche Sachen von geringem Wert einem anderen in der Absicht rechtswidriger Zueignung weggenommen zu haben, indem Sie Waren im Wert von 7,96 DM ohne Bezahlung mitnahmen. Beweismittel: Ihre Angaben, soweit Sie sich eingelassen haben; Zeugen. Wir halten Ihre Version, derzufolge Sie die Werbung »Mein Bak, dein Bak, unser Bak« bezüglich der Eindeutigkeit der Besitzlage für ebenso wenig glaubhaft, wie wir die Formulierung BAK-OUT als für sonderlich geistreich erachten – auch nicht Ihr Angebot, die Deoroller einem Waisenhaus zu schenken, sog. BAK-STIFTUNG. Also enweder er lasse es auf eine Verhandlung ankommen, wobei eine Gefängnisstrafe bis zu einer Woche drohe, mithin Aberkennung seines Doktortitels. Oder man einige sich auf einen Wert von sechs Tagessätzen. Das wären neunzig Mark. Er verzichtete auf die Pointe: Na dann nehme ich doch das Geld, und wir vergessen die Sache, um die Behörde nicht weiter zu erzürnen und stotterte den Betrag in monatlichen Sätzen zu zehn DM ab.
Dieses sandgraue Jungengymnasium könnte es gewesen sein. Alle Bullenklöster dieser Welt scheinen von ein und demselben Architektenkonsortium entworfen. Wie kriegt man es hin, dass trotz ausreichend vieler und genügend großer Fenster kein Licht reinkommt? Die Schildbürger hatten das Prinzip perfektioniert: Fenster ganz weglassen und nur so viel Licht, wie unbedingt nötig, mit Säcken reintragen. In der Aula des Gymnasiums, das Lucius besucht hatte, spielte auf der selben Bühne, auf der er sich in Bödekers postfaschistischen Blasorchester und Flötenchor mit »Und nun gang I an Peter's Brünnele« blamiert hatte (mit Klatschen auf Lederhosen und Schuhe zu Blödekers blödem hingeholperten Klavierzwischenspiel) blamiert hatte, später am Abend Arpad Bondy Vibraphon in einer Primanerjazzkapelle. Dabei übten sie mit der eigenen Band nachmittags schon einfachere Hendrix-Stücke. Seine Angebete, Gila, hatte peinlich berührt auf ihre Schuhe geschaut und war nach der Pause verschwunden. Und dreißig Jahre später trat dort Michel Petrucciani mit Steve Gadd auf. Lucius blickte sich während des Konzertes verstohlen um, ob er womöglich Zeugen dieses persönlichen musikhistorischen Debakels von damals ausmachen konnte. Erspähte aber außer dem ehemaligen Chorleiter, Donald Cramer, der (wie damals) noch immer milde abwesend lächelte, gottlob niemanden.
»Der Nagelkopf« , rechts: der mittelalterliche Marktplatz, den (für die damalige Zeit) wuchtige schieferverkleidete oder ihre Fachwerkbauweise offen (wie Kunstwerke) zur Schau stellende prunkvolle Häuser des wohlhabenden Handelsbürgertums und der Handwerker-Stände der ehemals reichen Hansestadt umsäumen. Links: das drohend düstere Massiv der Marktkirche. Dazwischen, vor der Seitfront des bald tausendjährigen Rathauses, an der eine wuchtige Steintreppe hinaufführt zur schweren Holztür vorm reich verzierten Sitzungssaal, steht ein einzigartiger kulturpolitischer Eulenspiegel-Streich des Magistrates der Stadt: ein großer, platter Eisenkopf ist von beiden Seiten mit riesigen Nägeln durchbohrt. Der Künstler hat dieses Monument der vernagelten Kunstborniertheit des kleinstädtischen Bürgertums den Ratsherren gewidmet, die ihn dafür reichlich entlohnten. Vielleicht sogar den Kaiserring überstreiften, eine Kunstauszeichnung, die auch Joseph Beuys bekommen hat. Womöglich für einen Klops Bunkerschmalz, den er in einen Glasschrei gestopft hat, wochenlang vor der Putzfrau verbarg, die den heute viel und gern zitierten Satz prägte: Is dat Kunst oder kann dat wech?! Und der Magistrat verwahrt ihn in den hieratisch gehüteten Gemächern des tumben Kulturfetischismus wie eine Heiligenmonstranz. Vor dem Stadttor hat er sich dann (wie weiland Eulenspiegel, der einem blöden Bürgermeister gerade ein nutzloses aber teures Zeugs aufgeschwatzt hatte) wohl in fettige Fäustchen gelacht. Bis der tiefere Sinn dieser einzigartigen Selbstentlarvung kulturpolitischen Kleingeistes diesem Monument entsteigt, wie einst die Athener Soldaten dem geschenkten Gaul in Troya, dem man nichts ins Maul aber in den Arsch hätte schauen sollen, und Passanten sich davor prustend auf dem Pflaster kullern, wird die graue kleinstädtische Mittelstandsmasse weiterhin kopfschüttelnd daran vorbeiflanieren: Für so'n Quatsch hamse Kohle!
*
Was das für ein Name sei, hatte der Beamte beim Ordnungsamt wissen wollen, wo Lucius Mitchell sein Pseudonym anmeldete. Und was das heiße!
Was heißt Dustin Hoffmann oder Jethro Tull?
Na gut, sagt der Beamte, aber wo der Name herkommt und wie man ihn ausspricht. Er stammt von meinem jüdischen Stiefgroßonkel mütterlicherseits, der Amerikaner war. Man sagt aber nicht Lusches, sondern Luzius.
Lucius war es leid, seinen Namen ständig erläutern zu müssen: Er hatte sich zuvor bereits clevere Anagramme überlegt, aber in Dieter Benecke waren einfach zu viele deutsch klingende Laute. Mit seiner spitzfindigen Verdrehungskunst wurde aus Joe Klose: Klo Jose, und aus dessen Sextett das Sex Jose Klosett, aber Bieter Denecke klang ebenso spröde wie Beter Dienecke oder Decker Bietene. Wenn aus Dieter Blume Bluter Dieme wurde, gab das wenigstens noch eine Pointe ab. Das Spiel, die Anfänge zweier benachbarter Worte zu vertauschen, hatte er zu einer gewissen Perfektion entwickelt, wobei kompliziertere Varianten eine fast vollständige Vertauschung der Buchstaben aufwiesen. So war aus Zoo Wuppertal Zupp Waterloo, der Name seiner ersten eigenen Band, geworden. Bei der Nordsee aß er nur noch ungern, da er, seit er einmal Frischfikadellen bestellt hatte, sich später ungeheuer darauf konzentrieren musste, wie die Pressfisch-Klopse nun wirklich hießen.
Nachdem er Dieter Benecke endgültig dem Schutthaufen der Geschichte übereignet hatte, war ihm zuerst der Kunstname Dusbin Jaich in den Sinn gekommen. Das Rätsel war vielen zu leicht, deshalb hatte er den Namen in seine englisch anmutende Version verfremdet: Dusbin Jaych. Dann hatte er sich für Thaddis Jaime entschieden. Als Stan keine fünf Minuten benötigte, auch diese Maskerade zu enttarnen, entschloss er sich zu seinem jetzigen Pseudonym.
*
Noch bis wenige Tage vor der Abreise ist unklar, wer den Bus fahren, wer als zweiter Fahrer und Roady mitkommen wird. Musiker, die genügend Geld haben, um sich geräumige Bandbusse leisten zu können, sind selten oder passen nicht ins Konzept. Außerdem sind zu dem Zeitpunkt die besten Musiker der Szene entweder in Roger Cicero's Band engagiert und spielen den bandintern gern belächelten Sekretärinnen-Jazz, darunter Lutz Krajenski, Ulli Orth, Stephan Abel, Axel Beinecke, Uwe Granitza und Hervé Jeanne. Und ihr früherer Bassist, Olav Casimir, legt ein paar unbedingt notwendig tiefe Töne unter Annett Louisan's Kindergesang. Die vordergründig locker sozialreformerischen Texte für beide Projekte schreibt einer, der so heißt, als könne er vielleicht der Bruder des Kölner Bassisten, den alle Den Inder nennen: Christian Ramond sein: Frank Ramond.
Niemand, der im Profigeschäft mitmischt, leistet sich heute noch den Luxus der 60er Jahre, einen musikalischen Schwachmaten mitzuschleifen, nur weil er eine Anlage, einen Proberaum und einen Hanomag-Diesel besitzt.
Deddie Kool hat einen Hanomag-Diesel und ist ein arbeitsloser Sozialarbeiter, der in seiner ausreichenden Freizeit als Amateurrocker genauso erfolgreich ist. Jeder weiß, dass es für ihn etwas Großartiges ist, eine Profiband zu kutschieren, die Anlage aufzubauen, den Sound zu pegeln und so dazuzugehören. Er beteuert, dass er der Band nur einen Gefallen tut; denn eigentlich ist er ja, wie gesagt, selbst Musiker, muss Proben ausfallen lassen und kann nicht komponieren, solange sie unterwegs sind. In jedem Club, den sie meist sehr spät erreichen, testet er zuerst das Klavier, während die Musiker die Anlage schleppen. Es ist für ihn eine offensichtlich erregende Vorstellung, wenn die ersten Gäste und der Wirt glauben, er sei der Pianist. Wo ist unser Akkordarbeiter, mault Kain und zerrt das zentnerschwere Flight-Case mit dem Mischpult, dem Verstärker und der Endstufe, das sie zärtlich Kraftpaket nennen, aus dem Bus. Wenn der morgen wieder nicht anpackt, schmeißt er ihn raus. Kain kann sehr miese Laune kriegen, wenn Musiker schlecht spielen oder Roadies ihren Job nicht machen.
Und wer fährt dann? fragt Gunther und kennt bereits die Antwort: Du! Gunther ist sich nicht sicher, ob die anderen wissen, dass er keinen Führerschein mehr hat. Außer Lucius, der ihn empfohlen hat und versprechen musste, es niemandem zu sagen. Gunther ist bei der Künstlervermittlung des Arbeitsamtes als Saxophonist gemeldet, er hat sich auf Blues und Unterhaltungsmusik spezialisiert. Sagt er. Tatsache ist, dass ihm der moderne Jazz zu schwer und das viele Üben zu anstrengend ist. Vor allem morgens, wenn er nach spirituellen und durchzockten Nächten nicht aus dem Bett findet. Lucius hat bemerkt, dass er genau die Zeit verschläft, in der früher die Schule stattfand, und nicht vor Ende der sechsten Stunde aufsteht. Gunther setzt gern hohe Beträge zum Beispiel darauf, dass er spätestens morgen ganz mit dem Alkohol brechen wird – »brechen« ist gut, sagt Lucius, mir ist auch immer kotzübel – , aber das könnte man doch eigentlich heute nochmal so richtig feiern. Er wettet um einen Hunnie. Und es gibt Freunde, so nennt er seine Zechgenossen, die gern bei solchen Beträgen mit ihm einschlagen und sich das Geld prompt ausbezahlen lassen.
Wenn Gunther in seiner überschwänglich fröhlichen, optimistischen und ganz selbstvergessenen Saufstimmung ist, ruft er die Freundinnen von Kollegen an, von denen er weiß, dass sie gerade auf Tour sind oder irgendwo außerhalb einen Auftritt haben. Gelegentlich hat er damit wirklich schon Glück gehabt. Ein Bandkumpel, der ihn beobachtet hat, wie er »Bräute anbaggert«, dabei säuselt und schmalzt und sich mit weicher, rhythmischer Arschrotation vorwärtsschleimt – »wie son’n Entenarsch, sag ich dir« – hat ihm den Titel »Ganter Sax, der Mann vom Abschleppdienst« verliehen. Er raspelt nicht, so hatte Lucius es beschrieben, Süßholz, wie die verbrauchte Metapher illustriert, sondern hackt Anmachholz.
Gunther hofft darauf, dass er eines Morgens aufwacht und entweder im Lotto gewonnen hat, plötzlich unwahrscheinlich gut Saxophon spielen kann oder wenigstens einen Job findet, der viel Geld bringt und wo keiner merkt, dass er nichts tut. Im Vertrauen darauf, dass Nomen Omen sei, hat er sich zuerst einmal im Freundeskreis den Namen Fritz zugelegt. So heißt sein Vater, ein erfolgreicher Arzt für alle gemeinen Krankheiten, der in einem reichen Kurort vornehmlich bei älteren Damen den Rahm abschöpft, genauer: das Fett absaugt.
Die Taufe für Fritz hatten sie, auch Lucius, in einem Guinessbuch-verdächtigen Flens-Marathon abgefeiert, bei dem sie sich die Bierkästen von einer Tag-und-Nacht-Tanke per Taxi bringen ließen, wenigstens zwanzig Gramm Grüner Afghan in blauen Nebel aufgingen und in dessen Anschluss Lucius einen Kreislaufkollaps erlitt, als er am dritten Morgen sechs Aspirin, einige Tassen Kaffee, einen Rollmops sowie eine Flasche Bier zu sich nahm, um nüchtern zu werden oder wenigstens diesen dröhnenden Kopfschmerz zu überwinden. Fritz arbeitet entgegen jeder pessimistischen Vorhersage seit einiger Zeit aushilfsweise als Taxifahrer. Gelegentlich fährt er Theater- und Kleinkunstgruppen über Land. Im Freundeskreis nennt man ihn Fritz von Tour’n und Taxis. Den Spitzenplatz in der Wirtschaft: gleich vorne an der Theke, hat er noch immer, wo man ihn »Senator Fullbreit« nennt, und in der er jede Nacht gegen vier, halb fünf aufkreuzt, über zu hohe Steuern, die amerikanische Kolonialpolitik, die Wiedervereinigung, den Extremistenerlass von 1972, das Magister-Prüfungsamt und seine Rechnung lamentiert. Zwischendurch einmal hat er eine Zeit lang alle denkbaren BtMs verdealt, was ihm innerhalb seiner Klientel den Namen »Graf Berge von Trips« einbrachte. Lucius glaubt, dass Gunther sich offiziell Fritz nennt, weil er einen falschen Pass besitzt. Leute aus Gunthers Dunstkreis behaupten, er sei in den 70ern vor der Bundeswehr auf der Flucht gewesen und mit den gefälschten Papieren aus Berlin zurückgekommen, weil er dort als Musiker keine Chance hatte, andere, dass er wegen eines Rauschgiftdelikts in Indien von Interpol gesucht wird. Ganz sicher weiß Lucius nur, dass Gunther seinen Führerschein für immer los ist, nachdem er mehrmals betrunken in Verkehrskontrollen geraten war.
*
Er legt sich vor dem Auftritt kurz im Hotelzimmer aufs Bett, angezogen, aber mit gelösten Schnürsenkeln. Wenig später sucht er in seinem Tourset, einem elastischen, schmuddelig-hellblauen Kasten mit Reißverschluss, das er schon der lächerlichen Bezeichnung »Kulturbeutel« wegen diesem Spießbürgerutensil vorzieht, nach dem Kontaktlinsenbehälter. Er ist verschlossen, aber die Linsen sind nicht darin.
Lucius hat diese Schrecksekunden schon oft erlebt. Er kann sich nicht erinnern, wo er die Linsen herausgenommen hat. Er geht vom Hotelzimmer in beide Richtungen den langen Flur entlang. Er sucht im Waschbecken, auf der Ablage unter dem Spiegel, neben der Toilette, vor der Dusche. Auch das kennt er: das kaum hörbare, fragil spitze Knackgeräusch, wenn man mit harten Sohlen die kleinen gewölbten Glashuckel zertritt, während man auf dem Waschbeckenrand gerade einen Wassertropfen mit der Fingerkuppe aufzunehmen versucht. Und jedesmal hatte er sich geärgert, dass er Schuhe trug. Und jedesmal hatte er sich vorgenommen, das nächste Mal daran zu denken.
Er dreht sich um, will sich die Hände abtrocknen, als er dieses zweite Knacken vernimmt. Jetzt tut es weh, als breche ein kleiner harter Knochen im Ohr. Er zieht die Schuhe aus, streift mit der Hand über die Sohlenränder, gibt sich einige Minuten seiner fassungslosen Verzweiflung und dem von ihm sehr geschätzten »Heute-geht-mir-alles-daneben-Gefühl« auf dem Klodeckel sitzend hin. Dann nimmt er die zertretenen Linsenleichname behutsam auf. Sie sind beide in der Mitte gespalten, aber die Teile hängen noch aneinander. Er setzt sie auf die Hornhäute, vielleicht geht’s ja doch noch. Die Augenkappen, wie Spinnweben aus gebrochenem Horn zerfasert, verfärben sich zusehens gelblich, Minuten später sind sie braun. Tote Linsen verfaulen und werden dunkel. Das weiß er jetzt. Als er mit schweißnassen Haaren und scharf stinkendem Unterhemd erwacht, sieht er sofort im Behälter nach. Die linke ist drin, die rechte kann er tatsächlich nicht fühlen. Wie sollst du eine verlorene Linse finden, wenn du nur eine hast, um sie beim Suchen aufzusetzen!
Das Konzert spielt er einäugig, die Noten kann er ohnehin auswendig. Als Lucius später, in einer Pause, die linke Linse auch herausnimmt, weil sie heute schlecht sitzt und ständig beschlägt, merkt er, dass er beide auf einem Auge hat. Er hatte sie in einem Fach übereinandergelegt, und sie waren zusammengeklebt. Er erzählt Stan die Geschichte, weil der ihm bei der Suche geholfen hatte, und er glaubt, ihm nach der Aufregung die erleichternde Nachricht schuldig zu sein. Am liebsten hätte er es auch ihm verschwiegen. Er blamiert sich nicht gern.
Stan, wahrscheinlich Ende dreißig, ist polnischer oder tschechischer Abstammung, wurde in Istanbul geboren und hat Kontrabass, was ungewöhnlich ist, fast ausschließlich autodidaktisch gelernt. In Hannover gab es zu seiner Zeit keine guten Bassisten, bei denen man Unterricht hätte nehmen können. Er ist groß und schlaksig, seine makromelitisch anmutenden riesigen Gliedmaßen sausen über die Bassmensur, als sei es eine spanische Gitarre. Infolge seiner stoischen Ruhe spielt er ihn allerdings meist sehr simpel und getragen, immer nur Grundton, Quinte, sagt er, das reicht. »Good enough for Jazz!«