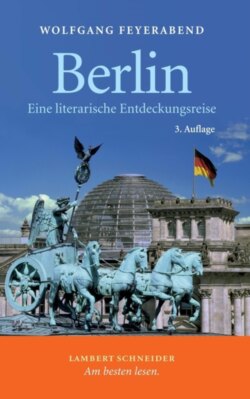Читать книгу Berlin - Wolfgang Feyerabend - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Vom Schlossplatz zum Tiergarten
ОглавлениеAuf der Spreeinsel stand fünf Jahrhunderte lang das Herrscherhaus der Hohenzollern, mit dem die Entwicklung Berlins von der mittelalterlichen Marktsiedlung zur Residenz- und späteren Reichshauptstadt untrennbar verbunden ist. 1451 war unter Kurfürst Friedrich II., „Mit dem Eisenzahn“, eine Burg eingeweiht worden, aus der im 16. Jahrhundert ein Renaissancebau und im späten 17. Jahrhundert das barocke Stadtschloss hervorgingen. Mit einer 70 Meter hohen Kuppel und 1210 Räumen, die sich um mehrere Innenhöfe gruppierten, besaß es nicht nur eine imposante Größe, sondern auch einen hohen baukünstlerischen Wert. An seiner Errichtung bzw. Erweiterung waren so namhafte Baumeister wie Andreas Schlüter, Johann Friedrich Eosander von Göthe, Karl Friedrich Schinkel oder Friedrich August
Stüler beteiligt. Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, wurde das Schloss 1950 auf Anweisung der SED-Führung gesprengt und abgerissen. Ab 2010 soll auf dem Areal das Humboldt-Forum mit der historischen Schlossfassade erbaut werden.
Zu den frühen prominenten Gästen im Stadtschloss gehörte Voltaire. Er folgte 1750 einer Einladung von König Friedrich II., der ihn seit langem in seiner Nähe wissen wollte. Mit dem Titel eines Kammerherrn ausgestattet, der das erkleckliche Jahresgehalt von 10.000 Taler mit sich brachte, war der berühmte Philosoph zunächst von der Aufnahme am Hof begeistert. Nach und nach stellte sich bei ihm jedoch Ernüchterung ein. Nicht zuletzt vermisste er hier die französische Lebensart. Bereits vier Monate nach der Ankunft schrieb er im November 1750 an seine Nichte Marie-Louise Denis:
Mein Leben ist frei und schaffensreich, aber … aber … Oper, Komödien, Jahrmärkte, Soupers in Sanssouci, Kriegsmanöver, Konzerte, Studien, Lektüren, aber … aber … die Stadt Berlin ist groß, viel weiträumiger angelegt als Paris, Palais, Theatersäle, anmutige Königinnen, charmante Prinzessinnen, schöne und wohlgebaute Ehrenjungfern, das Haus der Madame de Ticonel immer gut besucht und oft zu gut … aber …
Es sollte nicht allein bei atmosphärischen Störungen bleiben. Ein so unabhängiger Geist wie Voltaire gedachte keineswegs, sich mit der Rolle des Hofmannes zu begnügen. Streitigkeiten waren vorprogrammiert. Zum Eklat führte die satirische Schmähschrift „Die Geschichte des päpstlichen Leibarztes Dr. Akakia“, die er 1752 veröffentlichte und die den vom König geschätzten Präsidenten der Akademie der Wissenschaften Pierre-Louis Moreau de Maupertuis zum Ziel hatte.
Friedrich II. ließ das Buch sofort verbieten und, als Voltaire es abermals veröffentlichte, schließlich von Henkershand verbrennen. Am Ende stand das tiefe Zerwürfnis zwischen beiden. In einem Brief an seine Schwester Wilhelmine Markgräfin von Bayreuth räsonierte der Preußenkönig:
Du fragst mich nach Voltaire: die Geschichte ist folgende: Er hat sich hier wie ein Erzlump benommen. Er fing damit an, alle Welt durch Lügen und schändliche Verleumdungen, über die er nicht errötete, miteinander zu verfeinden. Darauf schrieb er Schmähschriften gegen Maupertuis und nahm die Partei von König, den er ebenso hasst wie Maupertuis, nur um diesen zu kränken, ihn lächerlich zu machen und Präsident unserer Akademie zu werden. Das alles geschah mit vielen Ränken, die ich übergehe, die aber seine schwarze Seele, seine Schlechtigkeit und Falschheit offenbart haben.
1753 kehrte Voltaire nach Frankreich zurück. Die Wertschätzung, die beide füreinander empfanden, sollte jedoch über die Zwistigkeiten obsiegen. Nach einer Weile nahmen beide den Briefwechsel wieder auf.
Mit den Erfolgen im Siebenjährigen Krieg (1756–1763) machte Friedrich der Große, wie er fortan genannt wurde, auch als machtbewusster Politiker und geschickter Feldherr europaweit von sich reden. Von überallher kamen Gäste in die Stadt, um einen Blick auf den König zu erhaschen. Der englische Reisende James Boswell hatte sich in den Kopf gesetzt, sogar eine Audienz zu erwirken. Im Tagebuch seiner „Großen Reise. Deutschland und die Schweiz 1764“ vermerkt er:
Ich bin seit ein paar Wochen in Berlin. Es ist die prächtigste Stadt, die ich je gesehen. Sie liegt in einem schönen Flachland und hat wie London ihren Fluss. Die Straßen sind breit und die Häuser ansehnlich. Der Königin bin ich vorgestellt und all den Prinzen und Prinzessinnen, dagegen hat sich noch keine Gelegenheit ergeben, mich dem König vorzustellen. Dies kann nur in Berlin geschehen, wo Seine Majestät, dem höfischen Wesen abhold, sich selten aufhält. Allein, ich bin entschlossen, eine Begegnung herbeizuführen, und verzweifle nicht daran, ihn zum Sprechen zu bringen. Er soll merken, dass er nicht den ersten besten vor sich hat.
Nachdem der 24-Jährige wochenlang vergeblich versuchte hatte, zum König vorgelassen zu werden, reiste er schließlich unverrichteter Dinge ab. Als Reiseschriftsteller, vor allem aber als Biograph seines Dichterfreundes Samuel Johnson erwarb er sich in der Literatur einen bleibenden Namen.
Dem Stadtschloss gegenüber, in der am östlichen Spreearm gelegenen Burgstraße, befand sich seit dem 18. Jahrhundert der Gasthof König von Portugal, den Gotthold Ephraim Lessing zum Schauplatz seines Lustspiels „Minna von Barnhelm oder Das Soldatenglück“ (1767) machte. Um nicht mit lebenden Personen in Konflikt zu geraten, gab er dem Etablissement in der Burgstraße 12 vorsichtshalber den Namen König von Spanien. Preußisch gründlich ging es allerdings auch hier zu, wie der Herbergsvater seine Gäste wissen lässt:
Wir Wirte sind angewiesen, keinen Fremden, wes Standes und Geschlechts er auch sei, vierundzwanzig Stunden zu behausen, ohne seinen Namen, Heimat, Charakter, hiesige Geschäfte, vermutliche Dauer des Aufenthalts und so weiter gehörigen Orts schriftlich einzureichen.
Während mehrerer Aufenthalte in den Jahren zwischen 1748 und 1767 hatte Gotthold Ephraim Lessing das Leben in Berlin kennen gelernt. Eine Zeitlang war er sogar für Voltaire tätig, der wegen diverser Geldgeschäfte in einem Rechtsstreit stand und ihn als Übersetzer für die Prozessakten engagierte. Eine Zusammenarbeit, die allerdings nicht lange währte, da der Franzose ihm das Vertrauen bald wieder entzog. So stellten die Berliner Jahre zwar eine erfahrungsreiche und prägende Zeit für Lessing dar, aber eine auskömmliche Anstellung fand er nicht. 1768 ging er als Dramaturg nach Hamburg, später als Bibliothekar nach Wolfenbüttel und kehrte nie wieder in die preußische Hauptstadt zurück.
Ebenso wie das Stadtschloss oder das Hotel König von Portugal existieren auch die südlich vom Schlossplatz gelegenen Häuser der Spreegasse nicht mehr, in der Wilhelm Raabes Romanerstling „Die Chronik der Sperlingsgasse“ spielt. Die Straße, in der er 1854/55 als Student gewohnt hatte, wurde ihm zu Ehren 1931 in Sperlingsgasse umbenannt. Zu DDR-Zeiten völlig neubebaut, hat das Bekenntnis des Schriftstellers zu „seiner“ Straße heute in doppelter Hinsicht Denkmalswert:
Ich liebe in großen Städten diese älteren Stadtteile mit ihren engen, krummen, dunkeln Gassen, in welche der Sonnenschein nur verstohlen hineinzublicken wagt; ich liebe sie mit ihren Giebelhäusern und wundersamen Dachtraufen, mit ihren alten Kartaunen und Feldschlangen, welche man als Prellstein an die Ecke gesetzt hat. Ich liebe diesen Mittelpunkt einer vergangenen Zeit, um welchen sich ein neues Leben in liniengraden, parademäßig aufmarschierten Straßen und Plätzen angesetzt hat, und nie kann ich um die Ecke meiner Sperlingsgasse biegen, ohne den alten Geschützlauf mit der Jahreszahl 1589, der dort lehnt, liebkosend mit der Hand zu berühren. Selbst die Bewohner des ältern Stadtteils scheinen noch ein originelleres, sonderbareres Völkchen zu sein, als die Leute der modernen Viertel. Hier in diesen winkligen Gassen wohnt das Volk des Leichtsinns dicht neben dem der Arbeit und des Ernsts, und der zusammengedrängtere Verkehr reibt die Menschen in tolleren, ergötzlicheren Szenen aneinander als in den vornehmern, aber auch öderen Straßen.
Mit Romanen wie „Der Hungerpastor“, „Abu Telfan“ oder „Der Schüdderump“, die er ab den 1860er Jahren schrieb, wurde Wilhelm Raabe zum Vorläufer des poetischen Realismus und zu einem der wichtigsten deutschen Erzähler in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Nach Lebensstationen in Wolfenbüttel und Stuttgart siedelte er sich 1870 in Braunschweig an, wo sein literarisches Spätwerk entstand, zu dem die Romane „Stopfkuchen“ (1891) oder „Die Akten des Vogelsangs“ (1896) zählen. Da er als freiberuflicher Schriftsteller gezwungen war, von den Erträgen seiner Bücher zu leben, verfasste er darüber hinaus etliche Unterhaltungsromane, die lange Zeit den Blick auf seine eigentliche literarische Bedeutung verstellten. Erst im Alter fand er die ihm gebührende Anerkennung. Nach Tübingen und Göttingen zeichnete ihn 1910 auch die Berliner Universität mit der Ehrendoktorwürde aus.
Ein halbes Jahrhundert vor Wilhelm Raabe hatte Stendhal, der zu dieser Zeit noch seinen bürgerlichen Namen Henri Beyle trug, Berlin besucht. Er kam während der napoleonischen Besetzung als Offizier in die preußische Hauptstadt. Im Haus des Stadtkommandanten Unter den Linden 1 einquartiert, schrieb er seiner Schwester Pauline im November 1806 in einem Brief:
Ich bin gegenüber dem Zeughaus, einem prächtigen Gebäude neben dem Königsschloss. Wir sind von ihm durch einen Arm der Spree getrennt, deren Wasser ölig-grün ist. Berlin liegt an einer sandigen Straße, die ein wenig vor Leipzig beginnt.
An allen Stellen, die nicht gepflastert sind, sinkt man bis zum Knöchel ein; dieser Sand macht die Umgebung der Stadt zur Einöde; es wachsen dort nur Bäume und ein wenig Rasen.
Ich weiß nicht, wer darauf gekommen ist, eine Stadt inmitten dieses Sandes zu gründen; diese Stadt soll, wie man sagt, hundertneunundfünfzigtausend Einwohner haben.
Ab 1817 begann der überzeugte Bonapartist, den der Sturz des Kaisers ins Exil nach Italien vertrieben hatte, als Schriftsteller hervorzutreten. Für sein Reisebuch „Rom, Neapel, Florenz“ verwendete er in Anlehnung an den Geburtsort des von ihm verehrten Kunstgelehrten Johann Joachim Winckelmann erstmals das Pseudonym „Stendhal“. Eingang in die Weltliteratur fanden seine Romane „Rot und Schwarz“ (1830) und „Die Kartause von Parma“ (1839), die zusammen mit den Werken Honoré de Balzacs einen Höhepunkt der realistischen Erzählkunst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bezeichnen.
Schlossbrücke mit Blick zum Berliner Dom
Das jüngst wiederaufgebaute Kommandantenhaus, in dem der Bertelsmannkonzern seine Berliner Dependance unterhält, gehört zusammen mit dem Zeughaus, dem Prinzessinnen- und Kronprinzenpalais zu den Gebäuden, die schon im 17. bzw. 18. Jahrhundert die Straße Unter den Linden säumten. Das Zeughaus, in dem das Deutsche Historische Museum untergebracht ist, wurde 1695–1706 als Arsenal errichtet und zählt zu den schönsten erhaltenen Barockbauten Berlins. Jüngeren Datums sind dagegen das von Karl Friedrich Schinkel 1830 fertig gestellte Alte Museum und der 1894–1905 unter der Leitung von Julius und Otto Raschdorff erbaute Berliner Dom. In den Grüften der einstigen Hofkirche sind die Sarkophage der Hohenzollernherrscher aufgestellt. Das Alte Museum, anfangs Ausstellungsstandort der königlichen Kunstschätze, beherbergt die Bestände der Antikensammlung.
Nachdem das Alte Museum errichtet worden war, entstand die Idee den nördlichen Teil der Spreeinsel insgesamt als Museumsstandort zu nutzen. Zwischen 1841 und 1930 folgten als weitere Bauten das Neue Museum, die Alte Nationalgalerie, das Bode-Museum sowie das Pergamonmuseum. Das weltweit einzigartige Ensemble wird derzeit Schritt für Schritt restauriert und modernisiert.
Vor dem Alten Museum und dem Dom erstreckt sich der Lustgarten. Den einstigen Küchengarten des Schlosses ließ der Große Kurfürst im späten 17. Jahrhundert zur barocken Platzanlage umgestalten. Unter dessen Enkel König Friedrich Wilhelm I. entstand daraus – wie in Potsdam – ein Exerzierplatz. Als Kundgebungsort schließlich ging der Lustgarten im 20. Jahrhundert in die Geschichte ein. Zu den düstersten Kapiteln gehört die 1942 von der Reichspropagandaleitung der NSDAP initiierte Ausstellung „Das Sowjetparadies“, die den Krieg gegen Russland rechtfertigen sollte. Einen Brandanschlag auf die Ausstellungszelte durch die jüdische Widerstandsgruppe Herbert Baum beantwortete das Regime mit der willkürlichen Verhaftung von 500 Juden, die teils sofort oder später im Konzentrationslager Sachsenhausen ermordet wurden. Dem vielfach missbrauchten und bis in die DDR-Zeit hinein für Aufmärsche und Propagandaveranstaltungen genutzten Platz widmete der in Berlin lebende Schriftsteller Volker Braun das Gedicht „LUSTGARTEN, PREUSSEN“:
Das Gras gepflastert. O Schweiß der Ämter, die Weisheit Des Volkes demselben, eh sie Zitiert wird, einzu– Rammen in das Gemüte.
Volker Braun debütierte 1965 mit dem vieldiskutierten Lyrikband „Provokation für mich“ und wurde seit den 1970er Jahren auch als Dramatiker und Erzähler international bekannt.
Für sein literarisches Werk, das die Entwicklung in der DDR zunehmend kritisch begleitete und sich nach 1989 mit den Gründen des Scheiterns der realsozialistischen Gesellschaft auseinander setzt, erhielt er 2000 den renommierten Büchner-Preis.
Auch Christa Wolf gehört zu den Schriftstellerpersönlichkeiten, die mit ihren Arbeiten, darunter den Romanen und Prosastücken „Kindheitsmuster“ (1976), „Kein Ort. Nirgends“ (1979) oder „Kassandra“ (1983) über die Grenzen der DDR hinaus bekannt wurden. In ihrer 1974 veröffentlichten Erzählung „Unter den Linden“ nimmt sie sich mit nicht zu überhörender Ironie einer militärischen Zeremonie an. Schauplatz ist die zwischen Universitätsgebäude und Zeughaus stehende Neue Wache, für deren Bau 1816–1818 Karl Friedrich Schinkel verantwortlich zeichnete. Das Gebäude, das 1993 als Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik eingeweiht wurde, diente zu DDR-Zeiten als Mahnmal für die Opfer des Faschismus und Militarismus. Ungeachtet dessen fand hier allwöchentlich die von den Preußen übernommene Große Wachablösung statt:
Im Traum holt man nach, was man immer versäumt hat. So wollte ich endlich einmal ganz genau der Großen Wachablösung zusehen, die gerade an der Neuen Wache mit klingendem Spiel und zuckenden weißen Handschuhen aufzog. Wollte mir die Kommandos einprägen, mit denen sie, zackzack, die beiden Hauptakteure wie an straff gespannten Schnüren aus dem zurückbleibenden Peloton ziehen, wollte mir keinen der bewunderungswürdigen Paradeschritte entgehen lassen, die, haarscharf einer uns Uneingeweihten unsichtbaren Linie folgend, genau vor den Stiefelspitzen des Wachtposten zu enden haben – wenn dieser da steht, wo das Reglement ihn hingestellt hat. Was in der Regel der Fall ist, da kann man unbesorgt sein. Ausgerechnet an diesem Nachmittag aber war die Regel verletzt worden, und einer der beiden Offiziersaspiranten marschierte schnurstracks auf eine Katastrophe los: Der Fleck, auf dem sein Vorgänger ihn zu erwarten hatte (zwischen der zweiten und dritten Säule), war leer.
Hinter der Neuen Wache und dem Kastanienwäldchen empfängt heute das Maxim-Gorki-Theater seine Besucher. Es wurde 1825–1827 als Konzerthaus für die Singakademie erbaut, jenen 1791 von Carl Friedrich Fasch gegründeten und ab 1800 von Carl Friedrich Zelter geleiteten Chor, der entscheidenden Anteil am Entstehen einer bürgerlichen Musikkultur in der preußischen Residenzstadt hatte. Franz Hessel, Berlins berühmtester literarischer Flaneur der 1920er Jahre, nimmt den Leser in seinem Feuilleton „Rundfahrt“ auf eine Besichtigungstour mit und empfiehlt ihm dringend:
Solange wir an der Neuen Wache halten, wirf auch einen Blick auf das kleine Kunsttempelchen da hinten, halb von Laub bedeckt. Das ist die Singakademie Zelters, des Goethefreundes Werkstatt, nachdem der Maurermeister ein Musikmeister geworden war … An diesen Verein und seine Kunststätte hier hinter den Büschen knüpft sich ein gut Teil Berliner Musikgeschichte zu den Zeiten Zelters und Mendelssohns, und mehr als das, ein Stück Leben der besten Berliner Gesellschaft, die es bisher gegeben hat, jener meist ziemlich eingeschränkt lebenden bürgerlichen Menschen der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts …
Schräg gegenüber der Neuen Wache befindet sich der Bebelplatz (früher Opernplatz). Auch er erlangte, ebenso wie der Lustgarten, in der Nazi-Zeit traurige Berühmtheit. Am 10. Mai 1933 wurden hier die Bücher von Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Lion Feuchtwanger, Alfred Kerr, Irmgard Keun, Heinrich Mann, Kurt Tucholsky und anderen fortschrittlichen Schriftstellern und Schriftstellerinnen verbrannt. Daran erinnert das mitten auf dem Platz in den Boden eingelassene Mahnmal des Künstlers Micha Ullmann. Zu lesen sind hier zugleich die prophetischen Worte von Heinrich Heine: „Das war ein Vorspiel nur. Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen.“
Entstanden war der Opernplatz durch königlichen Willen. Bereits als Kronprinz plante Friedrich II. mit seinem Baumeister Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff die repräsentative Ausgestaltung der Residenzstadt. Neben dem Opernhaus und einem Akademiegebäude sollte auch ein neuer Palast für den König erbaut werden. Das „Forum Fridericianum“ blieb jedoch als Gesamtanlage unvollendet. Stattdessen wurden nur das Opernhaus, die katholische St. Hedwigs-Kirche, die Königliche Bibliothek und das Palais für den Prinzen Heinrich errichtet.
Prinz Heinrich, den Bruder von Friedrich II., lernten Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach und Johann Wolfgang von Goethe bei ihrem Besuch in Berlin kennen. An Charlotte von Stein schrieb der Dichter am 17. Mai 1778:
Ich dacht an des Prinzen Heinrichs Tafel dran, dass ich Ihnen schreiben müsste, es ist ein wunderbarer Zustand, eine seltsame Fügung, dass wir hier sind. Durch die Stadt und mancherlei Menschen, Gewerb und Wesen hab ich mich durchgefressen. Von den Gegenständen selbst mündlich mehr …
Der Weimarer Herzog und sein Geheimer Legationsrat suchten in der Residenzstadt zu erfahren, ob es zu einem neuerlichen Krieg zwischen Preußen und Österreich kommen würde und wie man sich gegebenenfalls zu verhalten habe. Die insgesamt zweiwöchige Reise sollte Goethes einziger Besuch in Berlin bleiben.
1810 zog in das Palais des Prinzen Heinrich die im selben Jahr gegründete Universität. Elf Jahre später schrieb sich hier Heinrich Heine als Student der Jurisprudenz ein. Wegen eines Ehrenhandels hatte er das Studium in Göttingen abbrechen müssen und war in die preußische Hauptstadt gewechselt. Rasch fand er Zugang zu den literarischen Zirkeln, so zum Kreis um E. T. A. Hoffmann und zum Salon Rahel Varnhagens. Frühe journalistische Zeugnisse des 25-Jährigen sind seine „Briefe aus Berlin“, die 1822 im „Rheinisch-Westfälischen Anzeiger“ abgedruckt wurden. In den spottfunkelnden Korrespondenzen findet sich auch ein Seitenhieb auf die Universität:
Fürwahr, ein herrliches Gebäude! Nur Schade, die wenigsten Hörsäle sind geräumig, die meisten düster und unfreundlich, und, was das Schlimmste ist, bei diesen gehen die Fenster nach der Straße, und da kann man schrägüber das Opernhaus bemerken. Wie muss der arme Bursche auf glühenden Kohlen sitzen, wenn die ledernen, und zwar nicht saffian- oder maroquinledernen, sondern schweinsledernen Witze eines langweiligen Dozenten ihm in die Ohren dröhnen, und seine Augen unterdessen auf der Straße schweifen und sich ergötzen an dem pittoresken Schauspiel der leuchtenden Equipagen, der vorüberziehenden Soldaten, der dahin hüpfenden Nymphen und der bunten Menschenwoge, die sich nach dem Opernhause wälzt.
1828 besuchte Heinrich Heine ein letztes Mal Berlin. Ein Jahr zuvor war sein „Buch der Lieder“ erschienen, das ihn in ganz Deutschland bekannt machte. Seine in der Folgezeit immer gesellschaftskritischer werdenden Artikel, Aufsätze und Bücher ließen ihn zunehmend in Konflikt mit der Zensur geraten, weshalb er 1831 nach Paris übersiedelte. Mit dem Verbot seiner Schriften durch den Deutschen Bundestag endete 1835 für ihn, der neben Goethe zu den bedeutendsten Lyrikern deutscher Sprache im 19. Jahrhundert gehört, auch die Korrespondententätigkeit für die „Augsburger Allgemeine Zeitung“.
Neben dem Lustgarten und dem Bebelplatz verdient der Gendarmenmarkt, als Dritter der großen Plätze nahe der Straße Unter den Linden genannt zu werden. Er entstand im Zusammenhang mit der Anlage der Friedrichstadt im späten 17. Jahrhundert und wurde nach den unter Friedrich Wilhelm I. hier errichteten Pferdeställen der Gens d’armes, der Leibgarde des Königs, benannt. Die Französische Straße, die den Platz im Norden flankiert, erinnert mit ihrem Namen noch daran, dass in dem Viertel viele der französischen Glaubensflüchtlinge Unterkunft fanden. Schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts ließ König Friedrich I. die Französische Kirche und die Deutsche Kirche erbauen, die in den 1780er Jahren zusätzlich Türme erhielten. Von deren Kuppeln (franz.: dome) leiten sich die volkstümlichen Begriffe Deutscher und Französischer Dom ab.
An der Westseite des Platzes stand das Komödienhaus. Es fiel im Sommer 1817 einem Brand zum Opfer, dessen Begleitumstände noch lange für Gesprächsstoff unter den Berlinern sorgten. In einem Brief, den Bettina von Arnim am 8. August 1817 an ihren Mann nach Karlsbad sandte, klingt noch ein wenig das Entzücken der Schaulustigen nach:
Es ist schade, dass du den Brand vom Komödienhaus nicht gesehen hast, es sind für 800 Louisdor Perücken mitverbrannt, die bloß zu Brühls Zeiten sind angeschafft worden. Schinkel ist sehr begierig zu wissen, was der König dazu gesagt hat, ob er Lust hat ein ganz neues oder ein auf die Fundamente des alten gegründetes zu bauen, was ihm nicht behagen würde; ich glaube nicht, dass er den Bau ganz allein übernehmen dürfte, denn schon jetzt spricht man davon, dass alles, was er je erfunden hat, viel zu phantastisch sei, und dass er keinen Kuhstall bauen könne, wo er seine Ideale nicht anbringen würde.
Entgegen der Vorhersage von Bettina von Arnim erhielt Karl Friedrich Schinkel den Auftrag doch und errichtete an gleicher Stelle 1818–1821 das Königliche Schauspielhaus. Es wurde nach der Neuen Wache die zweite große Bauaufgabe des inzwischen 37-Jährigen. Im Zweiten Weltkrieg zerstört und zu DDR-Zeiten wiederhergestellt, erhielt das Gebäude in den 1990er Jahren den Namen Konzerthaus am Gendarmenmarkt und ist heute vorrangig Musikaufführungen vorbehalten.
Gleich hinter dem Theater, in der Charlottenstraße 56, Ecke Taubenstraße, wohnte der Schriftsteller E. T. A. Hoffmann. Nach der Zeit als Referendar am Berliner Kammergericht und juristischen Tätigkeiten in Posen, Plozk und Warschau hatte sich der geborene Königsberger zunächst als Komponist und Kapellmeister in Bamberg, Leipzig und Dresden versucht. 1814 trat er erneut in den preußischen Staatsdienst und übersiedelte nach Berlin, wo er Rat am Kammergericht wurde und sich neben dieser Arbeit zunehmend dem Schreiben widmete. Seine Kunstmärchen und phantastischen Erzählungen beeinflussten Schriftsteller wie Hans Christian Andersen, Nikolai Gogol, Edgar Allan Poe und Oscar Wilde.
In der Erzählung „Des Vetters Eckfenster“, die 1822 im Jahr seines Todes erschien, hat sich E. T. A. Hoffmann selbst porträtiert:
Dabei liegt aber meines Vetters Logis in dem schönsten Teile der Hauptstadt, nämlich auf dem großen Markte, der von Prachtgebäuden umschlossen ist und in dessen Mitte das kolossal und genial gedachte Theatergebäude prangt. Es ist ein Eckhaus, was mein Vetter bewohnt, und aus dem Fenster eines kleinen Kabinetts übersieht er mit einem Blick das ganze Panorama des grandiosen Platzes.
Es war gerade Markttag, als ich mich durch das Volksgewühl drängend, die Straße hinabkam, wo man schon aus weiter Ferne meines Vetters Eckfenster erblickt. Nicht wenig erstaunte ich, als mir aus diesem Fenster das wohlbekannte rote Mützchen entgegenleuchtete, welches mein Vetter in guten Tagen zu tragen pflegte. Noch mehr! Als ich näher kam, gewahrte ich, dass mein Vetter seinen stattlichen Warschauer Schlafrock angelegt hatte und aus der türkischen Sonntagspfeife Tabak rauchte.
In dem heutigen, aus den Gründerjahren stammenden Gebäude befinden sich die in den 1990er Jahren wiedereröffneten Weinstuben von Lutter & Wegner. Das Vorgängerlokal, in dem E. T. A. Hoffmann zu verkehren pflegte und das Jacques Offenbach zum Schauplatz seiner Oper „Hoffmanns Erzählungen“ machte, residierte zwei Straßen weiter, in einem nicht mehr erhaltenen Gebäude an der Ecke zur Französischen Straße.
In Sichtweite sowohl der Taubenstraße als auch der Französischen Straße liegt die Friedrichstraße, die einst die wichtigste Geschäfts- und Vergnügungsmeile Berlins war. Nach dem Ersten Weltkrieg richtete sich das Augenmerk mehr und mehr auf den Kurfürstendamm. Der Glanz der Friedrichstraße verblasste. Victor Aubertin, neben Alfred Kerr und Alfred Polgar einer der wichtigsten Protagonisten des deutschsprachigen Feuilletons in den 1920er Jahren, gab seinem Text über die inzwischen entzauberte Magistrale den Titel „Studie in Grau“:
Das berühmte Pflaster der Friedrichstraße entlang laufen wir alle und haben es sehr eilig; jeder trägt eine schwarze Ledermappe unter dem Arm.
Nur die Fräulein mit den hohen Lackstiefeln haben es gar nicht eilig. Die gehen gelassen von der Ecke Mohrenstraße nach der Ecke der Jägerstraße und umgekehrt; und wenn sie an der betreffenden Ecke angekommen sind, bleiben sie stehen und blicken um sich, liebevoll und aufmunternd …
Und nun rennen wir wieder weiter, mit unseren Aktenmappen, über das Pflaster. Dieses Pflaster der Friedrichstraße aber ist schief und eingesunken und klingt dumpf, als sei da unten alles ausgehöhlt. Nächstens brechen wir zusammen und werden etwas Versunkenes und Begrabenes wie Pompeji. Oder wie Sodom und Gomorrha. Die Archäologen, die uns dann in zweitausend Jahren wieder ausgraben, die werden eine Freude haben.
Zu den Attraktionen in der Friedrichstraße gehörte noch eine Zeit lang die Lindenpassage. In ihr war das berühmte Kaiserpanorama untergebracht, das seine Besucher mit Bildern aus den Weltregionen erfreute. Die Ausstellung des Anatomischen Museums, ein Panoptikum und zahlreiche Läden bildeten weitere Anziehungspunkte. Der Publizist Siegfried Kracauer, der vor allem durch seine filmsoziologischen Arbeiten und den Essay „Die Angestellten“ bekannt wurde, widmete dieser Berliner Institution 1930 das Feuilleton „Abschied von der Lindenpassage“:
Die Lindenpassage hat aufgehört zu bestehen. Das heißt, sie bleibt der Form nach eine Passage zwischen der Friedrichstraße und den Linden, aber sie ist doch keine Passage mehr. Als ich vor kurzem wieder einmal in ihr lustwandelte wie so oft in den Studentenjahren vor dem Krieg, war das Werk der Vernichtung schon beinahe vollendet …
Jetzt, unterm neuen Glasdach und im Marmorschmuck, gemahnt die ehemalige Passage an das Vestibül eines Kaufhauses. Die Läden dauern zwar fort, aber ihre Ansichtskarten sind Stapelware, ihr Weltpanorama ist durch den Film überholt und ihr anatomisches Museum längst keine Sensation mehr. Alle Gegenstände sind mit Stummheit geschlagen. Scheu drängen sie sich hinter der leeren Architektur zusammen, die sich einstweilen völlig neutral verhält und später einmal wer weiß was ausbrüten wird – vielleicht den Faschismus oder auch gar nichts. Was sollte noch eine Passage in einer Gesellschaft, die selber nur eine Passage ist?
Anders hatte dies noch bei Theodor Fontane geklungen. Das Kaiserreich, nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 aus der Taufe gehoben, war auf der Höhe der Macht, und die Friedrichstraße, Ecke Unter den Linden mitsamt dem Kaffeehaus-Dreigestirn Kranzler, Bauer und Victoria zählte zu den extravaganten Treffpunkten der jungen Reichshauptstadt:
Und nun ging die Weihnachtswoche zu Rüste, der 31. Dezember war da, und die Frage war, ob man in eine Silvestervorstellung mit Schlussakt im Café Bauer gehn oder aber zu Hause bleiben und einen guten Punsch machen und genießen wolle,
heißt es in „Mathilde Möhring“. Unweit der Kaffeehausecke, in der Friedrichstraße 153, war Theodor Fontane 1845 als zweiter Rezeptar in die Polnische Apotheke eingetreten. Und noch ein paar Schritte weiter, an der Ecke zur Dorotheenstraße, hatte vier Jahre zuvor der 21-jährige Friedrich Engels eine Unterkunft gefunden. Der spätere Mitstreiter von Karl Marx leistete 1841/42 seinen Militärdienst in Berlin ab und betätigte sich nebenher als Beiträger für Arnold Ruges „Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst“. Über das Haus in der Dorotheenstraße 56, an dessen Stelle heute ein Neubau steht, der die Nr. 43 trägt, schrieb der Gardefußartillerist an seine Schwester Marie:
Vor meinem Hause liegen eine Menge Droschken und halten ihr Standquartier daselbst. Die Droschkiers sind gewöhnlich besoffen und amüsieren mich sehr. Wenn ich also einmal ausfahren sollte, so habe ich das sehr bequem. Ich wohne überhaupt ganz angenehm, eine Treppe hoch, ein elegant möbliertes Zimmer, dessen vordere Wand aus drei Fenstern besteht, zwischen denen nur schmale Pfeiler sind, so dass es sehr hell und freundlich ist.
Die Dorotheenstadt, in der der Barmener Fabrikantensohn seine Zelte aufschlug, zählte zu den vornehmen Quartieren Berlins. Das Viertel war Ende des 17. Jahrhunderts angelegt und nach ihrer Gründerin der Kurfürstin Dorothea, der zweiten Gemahlin des Großen Kurfürsten, benannt worden. Friedrich Engels wohnte hier nahe der Prachtmeile Unter den Linden und der Universität, an der er in seiner dienstfreien Zeit Vorlesungen hörte. Ein junger Wachtelhund mit „viel Talent zum Kneipen“ begleitete ihn auf seinen Spaziergängen. Häufiges Ziel dürfte der Tiergarten gewesen sein, zu dem die Linden führen. Die 1,5 km lange Straße, die zugleich die südliche Grenze der Dorotheenstadt bildet, entstand 1573 zunächst als Reit- und Jagdweg und entwickelte sich im Verlauf des 18. Jahrhunderts zum aristokratischen Boulevard.
In Friedrich Nicolais „Beschreibung der königlichen Residenzstadt Berlin“, die 1786 bereits in dritter Auflage erschien, heißt es:
Diese prächtige Straße nimmt die ganze Länge der Dorotheenstadt bis an das Viereck ein … Sie ist mit einer sechsfachen Allee von Linden bepflanzt, zwischen welchen auf jeder Seite eine breite gepflasterte Straße und in der Mitte ein ungepflasterter breiter Platz zum Spaziergang ist, der 1783 wieder mit einem doppelten hölzernen Geländer eingefasst wurde. Auf beiden Seiten ist sie mit schönen und zum Teil prächtigen Häusern besetzt.
Der intime Kenner der Stadt, Friedrich Nicolai, gehörte als Buchhändler und Verleger zu den großen Persönlichkeiten der Aufklärung. Er war befreundet mit Moses Mendelssohn und Gotthold Ephraim Lessing, die er als Mitarbeiter für die Rezensionszeitschrift „Briefe, die neueste Literatur betreffend“ gewinnen konnte. Neben der verlegerischen Tätigkeit trat der vielseitig begabte Nicolai aber auch als Romanschriftsteller, Reisebuchautor und Kritiker hervor. An ihn und sein Wirken erinnert bis heute der Name der in Berlin ansässigen Nicolaischen Verlagsbuchhandlung.
Hof des Nicolai-Hauses, Brüderstraße 13
Immer wieder hat es Schriftsteller, so auch E. T. A. Hoffmann, gereizt, sich der Linden literarisch zu nähern. Obwohl er in der Erzählung „Das öde Haus“ die Namensnennung der Straße vermeidet, ist sie in seiner Beschreibung doch unschwer zu erkennen:
Die mit Gebäuden jener Art eingeschlossene Allee, welche nach dem ∗∗∗ger Tore führt, ist der Sammelplatz des höheren, durch Stand oder Reichtum zum üppigeren Lebensgenuss berechtigten Publikums. In dem Erdgeschoss der hohen breiten Paläste werden meistenteils Waren des Luxus feil geboten, indes in den obern Stockwerken Leute der beschriebenen Klasse hausen. Die vornehmsten Gasthäuser liegen in dieser Straße, die fremden Gesandten wohnen meistens darin, und so könnt ihr denken, dass hier ein besonderes Leben und Regen mehr als in irgend andern Teile der Residenz stattfinden muss, die sich eben auch hier volkreicher zeigt, als sie es wirklich ist. Das Zudrängen nach diesem Ort macht es, dass mancher sich mit einer kleineren Wohnung, als sein Bedürfnis eigentlich erfordert, begnügt, und so kommt es, dass manches von mehreren Familien bewohnte Haus einem Bienenkorbe gleicht.
Bis heute bildet die Straße Unter den Linden einen Anziehungspunkt für Besucher aus nah und fern. Mit den Beschreibungen Friedrich Nicolais oder E. T. A. Hoffmanns hat sie, und dieses Los teilt sie mit anderen Straßen und Plätzen der Stadt, freilich nur noch wenig gemein. Die Gründe dafür benannte der Berliner Journalist und Schriftsteller Walther Kiaulehn in seinem 1958 veröffentlichten Buch „Berlin. Schicksal einer Weltstadt“:
Zwei Ursachen haben Berlin zerstört: Bomben im Krieg und Mutwillen im Frieden! Die erste Flut des Mutwillens erhob sich im Jahre 1850 und dauerte bis 1900. Sie kam zusammen mit der Sturmflut der Industrialisierung über die Stadt. 1850 hatte Berlin 450.000 Seelen, 1900 waren es zwei Millionen; man nannte sie jedoch schon nicht mehr Seelen. In diesen fünfzig Jahren vollzog und vollendete sich die Verhässlichung Berlins.
Von dieser Entwicklung blieben auch die Linden nicht verschont. Hatte etwa der Schinkel-Schüler Eduard Knoblauch 1840 die Russische Botschaft noch unter Einbeziehung des Vorgängerhauses, dem einstigen Stadtpalais der Prinzessin Amalie, der jüngsten Schwester von Friedrich II., erbaut, so fiel knapp sieben Jahrzehnte später das Palais Redern kurzerhand der Spitzhacke zum Opfer. An seiner Stelle entstand das Hotel Adlon. Der Schriftsteller Günter de Bruyn, vor allem mit Romanen wie „Buridans Esel“ oder „Preisverleihung“ bekannt geworden, schreibt dazu in seinem Buch „Unter den Linden“:
Lorenz Adlon, ein aus Mainz stammender gelernter Kunsttischler, den der Umgang mit reichen Leuten zum Wechsel in die feinere Gastronomie veranlasst hatte, war als Betreiber zweier Berliner Restaurants mit französischer Küche zu Geld gekommen und hatte in einer Audienz den Kaiser für den Bau eines Luxushotels in bester Lage so sehr begeistern können, dass Majestät persönlich 1907 nicht nur das Haus als erster besichtigte, sondern es auch zur Unterbringung von Staatsgästen nutzte und sich hier bis zu seiner Abdankung 1918 Bankette ausrichten ließ.
Mark Twain und Upton Sinclair, Charlie Chaplin und Greta Garbo, Gerhart Hauptmann und Thomas Mann zählten zu den prominenten Gästen des Hotels.
Vor und nach dem Ersten Weltkrieg siedelten sich Unter den Linden zunehmend die Repräsentanzen großer Firmen an. Der altehrwürdige Prachtboulevard wurde Geschäftsstraße und musste dem modernen „Tempo“ Tribut zollen. Für das Kabarett Schall und Rauch verfasste der Dichter Walter Mehring Anfang der 1920er Jahre den Chansontext „Heimat Berlin“:
Die Linden lang, Galopp! Galopp! Zu Fuß, zu Pferd, zu zweit! Mit der Uhr in der Hand, mit’m Hut auf’m Kopp Keine Zeit! Keine Zeit! Keine Zeit!
Auch die architektonischen Zeugnisse dieser Epoche gingen teilweise im Zweiten Weltkrieg verloren. Im westlichen Abschnitt der Straße und am Pariser Platz dominieren inzwischen Stahl, Glas und Beton. Neuerrichtet wurde in den 1950er Jahren das russische, damals sowjetische Botschaftsgebäude. Und selbst das historisch anmutende Hotel Adlon ist ein Neubau der 1990er Jahre. Allein das von Carl Gotthard Langhans 1788–1791 geschaffene Brandenburger Tor kündet noch von der bis in die 1730er Jahre zurückreichenden Geschichte des Areals. Unter König Friedrich Wilhelm I. angelegt, wurde der Platz wegen seiner Form zunächst Quarré oder Viereck genannt. In Erinnerung an den Einzug der Verbündeten in Paris im August 1814 erhielt er im selben Jahr seinen heutigen Namen.
Eingebunden in die Akzisemauer, bezeichnete das Brandenburger Tor die westliche Stadtgrenze Berlins. Die seitlichen Durchgänge dienten dem allgemeinen Verkehr, die breitere Durchfahrt in der Mitte blieb den Angehörigen des Königshauses vorbehalten. In den beiden Torhäusern waren rechts der Steuereinnehmer und links die Wache untergebracht.
Am 8. Dezember 1804 kam es zu einem Zwischenfall, da die Posten die Einfahrt des Königs verpassten und nicht, wie bei dieser Gelegenheit vorgeschrieben, hervortraten und das Gewehr präsentierten. Die Verantwortung für den Vorfall trug der diensthabende Offizier Adelbert von Chamisso, der daraufhin mit Arrest bestraft wurde.
Erst zwei Jahre später, nach der verheerenden Niederlage der preußischen Armee in der Schlacht von Jena und Auerstedt, gelang es Adelbert von Chamisso den ungeliebten Militärdienst zu quittieren und seinen naturwissenschaftlichen wie literarischen Neigungen nachzugehen. Die 1813 entstandene Novelle „Peter Schlehmils wundersame Geschichte“ machte ihn europaweit als Schriftsteller bekannt. Mit seinen Nachdichtungen der Chansons von Pierre-Jean Béranger und den eigenen Gedichten wurde er darüber hinaus einer der Väter des politischen Liedes in Deutschland. Seine wissenschaftliche Karriere beschloss der aus Frankreich stammende Chamisso, der zu den bedeutendsten Pflanzenkundlern seiner Zeit zählte, als Direktor des Botanischen Gartens in Berlin.
Mit der Biographie eines anderen romantischen Dichters ist das Grundstück Pariser Platz 4 verbunden. In dem im Zweiten Weltkrieg zerstörten Gebäude erblickte Achim von Arnim 1781 das Licht der Welt. Nach dem Studium in Halle a. d. S. und Göttingen, ließ er sich zunächst in Heidelberg nieder, wo er zu einem der führenden Köpfe des dortigen Romantikerkreises wurde. Die von ihm und Clemens Brentano herausgebrachte dreibändige Volksliedsammlung „Des Knaben Wunderhorn“ zählt zu seinen bleibenden literarischen Leistungen. 1808 kehrte Achim von Arnim nach Berlin zurück und heiratete drei Jahre später Bettina Brentano, die Schwester seines Freundes.
Ab 1907 residierte im Haus die Preußische Akademie der Künste, deren Präsident der Maler Max Liebermann von 1920 bis 1932 war. Von allen Akademiemitgliedern hatte er zu den Sitzungen und Veranstaltungen den kürzesten Weg, besaß er doch das am Nordflügel des Brandenburger Tores gelegene Haus Pariser Platz 7. In seiner erstmals 1889 publizierten Skizze „Autobiographisches“ schreibt er:
Ich bin in meinen Lebensgewohnheiten der vollkommenste Bourgeois: Ich esse, trinke, schlafe, gehe spazieren und arbeite mit der Regelmäßigkeit einer Turmuhr. Ich wohne in dem Hause meiner Eltern, wo ich meine Kindheit verlebt habe, und es würde mir schwer werden, wenn ich woanders wohnen sollte. Auch ziehe ich Berlin jeder anderen Stadt als bleibenden Wohnsitz vor.
Am 30. Januar 1933, nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler, musste Max Liebermann den Fackelzug der Nazihorden durchs Brandenburger Tor miterleben. Seine Arbeiten wurden von den NS-Behörden bald darauf aus den Museen entfernt, beschlagnahmt und teilweise ins Ausland verhökert. Als der Maler 88-jährig starb, wagte keines der großen Berliner Blätter einen Nachruf zu veröffentlichen. Martha Liebermann, seine Witwe, nahm sich, als ihre Deportation bevorstand, 1943 das Leben. Das kriegszerstörte Haus der Familie Liebermann ist in den 1990er Jahren nach Plänen von Josef Paul Kleihus durch einen Neubau ersetzt worden.
1926 wurde die Preußische Akademie der Künste um die Sektion Dichtkunst erweitert. Der Dichterakademie gehörten Persönlichkeiten wie Alfred Döblin, Ludwig Fulda, Ricarda Huch oder Heinrich und Thomas Mann an. Nach der Ausschaltung der Institution durch die NS-Behörden zogen Albert Speer und die Generalbauinspektion in die Räume ein.
Im Nachbarhaus, an dessen Stelle heute das von Frank O. Gehry errichtete DZ-Bank-Gebäude steht, fand im Februar 1944 die Berliner Journalistin Ursula von Kardorff eine provisorische Unterkunft, nachdem ihre Wohnung in der Rankestraße ausgebombt worden war. In ihrem Buch „Berliner Aufzeichnungen. Aus den Jahren 1942 bis 1945“ schreibt sie:
Das Haus am Pariser Platz 3 ist hübsch, im Stil der Wilhelmstraße erbaut, etwas an Potsdam erinnernd. Sein winziger Garten – allerdings durch den Bunkerbau halb zerstört – gibt eine Vorstellung davon, wie es früher hier aussah, in den achtziger Jahren, als hier die „Casino-Gesellschaft“ ihre Klubräume hatte. Damals hieß es das „Schautenhaus“. Hinter einer Mauer die Gärten des Auswärtigen Amtes und der Reichskanzlei. Es gibt auch eine Terrasse, auf deren Balustrade altmodische Sandsteinfiguren stehen. Der Portier, Herr Belling, ein ungemein freundlicher Mann, erzählte mir von den großen Bällen, die früher hier stattfanden. So verweben sich die Zeiten – vorn Rüstungsministerium und hinten das Berlin Fontanes.
Der im Zweiten Weltkrieg zerstörte und zu DDR-Zeiten weitgehend abgeräumte Pariser Platz lag nach dem Mauerbau von 1961 im Ostteil, der Reichstag im Westteil der Stadt. Das Brandenburger Tor war weiträumig von den DDR-Grenztruppen abgesperrt. Besucher konnten es nur aus gehörigem Abstand betrachten. Am 9. November 1989, dem Tag der Maueröffnung, wurde das Brandenburger Tor zu einem der Schauplätze des Geschehens. Der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom weilte zu dieser Zeit in der Stadt und hielt seine Eindrücke in dem Buch „Berliner Notizen“ fest.
Das düstere Schiff des Reichstags liegt in einem Menschenmeer, jeder versucht, auf die hohen Säulen des Brandenburger Tores zu klettern, zu den rasenden Pferden ganz oben, die früher in die andere Richtung stürmten. Das Podest, von dem aus man Unter den Linden überblicken kann, schwankt unter der Last der Menschen, mühsam kämpfen wir uns nach oben, wenn jemand herunterkommt, rücken wir wieder um einen Körper weiter. Der leere Halbkreis vor den Säulen wird von unechtem, orangefarbenem Licht beleuchtet, die geschlossene Front der Grenzsoldaten darin sieht aus wie eine machtlose Reihe gegen die Gewalt der Menge auf unserer Seite. Wenn ein Jugendlicher auf die Mauer klettert, versuchen sie ihn herunterzuspritzen, aber der Strahl ist meistens nicht stark genug, und die einsame Gestalt bleibt stehen, nass bis auf die Knochen, ein lebendiges Standbild in einer Aura weiß erleuchteten Schaumes.
Längst ist das Brandenburger Tor nicht mehr Sinnbild für die Teilung Berlins, sondern wieder Wahrzeichen der Stadt. Zu den touristischen Attraktionen gehört inzwischen auch das Reichtagsgebäude, in dem der Deutsche Bundestag seinen Sitz hat. Es wurde 1995–1999 von Sir Norman Foster umgebaut und mit einer begehbaren gläsernen Kuppel versehen, die den Besuchern einen prächtigen Blick über die Stadt gestattet.
Ehe nach Plänen von Paul Wallot 1884–1894 das Reichstagsgebäude am heutigen Standort errichtetet wurde, tagte das Parlament in einem Provisorium, dem Haus der Königlichen Porzellanmanufaktur, in der Leipziger Straße. Dieses lernte noch der französische Journalist Victor Tissot kennen, als er nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 Deutschland bereiste und darüber in seinem Buch „Reportagen aus Bismarcks Reich“ berichtete:
Die Abgeordneten des Reichstages tagen zur Zeit in dem Saal einer früheren Porzellanmanufaktur. Dies soll sie wahrscheinlich an die Zerbrechlichkeit der Dinge dieser Welt erinnern. Um ein Bauwerk zu errichten, das der Würde seiner Bestimmung im neuen Kaiserreich entspricht, hat man zwar den erforderlichen Betrag von den französischen Milliarden genommen, konnte sich jedoch bei der Standortwahl noch nicht einigen. Bismarck möchte den Reichstag im Schatten der Siegessäule sehen, die Abgeordneten fürchten aber diese kriegerische Nachbarschaft. Da liegt das Problem.
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck setzte sich jedoch bei der Standortwahl durch. Allerdings steht heute die Siegessäule nicht mehr am Platz der Republik, dem früheren Königsplatz. Bei den gigantischen Planungen Hitlers und Speers für die Welthauptstadt Germania war die Siegessäule mit der von Friedrich Drake geschaffenen Viktoria an den Großen Stern im Tiergarten versetzt worden.
Der Tiergarten, Berlins älteste Naherholungsanlage, ist der Rest eines ausgedehnten Waldgebietes, das von den brandenburgischen Kurfürsten als Jagdrevier genutzt wurde. Unter König Friedrich II. begann die allmähliche Umgestaltung zum öffentlichen Park. Theodor Fontane, der hier fast täglich zu spazieren pflegte, hat den Tiergarten in „Cécile“ und in „Stine“ zum literarischen Ort gemacht. Aber auch von Dichtern ist der Park immer wieder besungen worden, so von Max Herrmann-Neiße in dem Gedicht „Letzter warmer Tag im Tiergarten“:
Mit bunten Blättern ist der Teich beschneit. Es raschelt auf den Wegen, die ich schreite, auch unter meinem Fuß Vergänglichkeit. Es gibt mir welke Liebe das Geleite.
Max Herrmann, der sich nach seinem schlesischen Geburtsort Max Herrmann-Neiße nannte, hatte Literatur- und Kunstgeschichte studiert. Seit 1917 lebte er in Berlin, wo er dem expressionistischen Kreis um Franz Pfempferts Zeitschrift „Aktion“ angehörte. 1933 emigrierte der Antifaschist über die Schweiz, Frankreich und Holland nach England. Im Schweizer Exil lernte er Thomas Mann kennen, der, wie dessen Tagebücher bezeugen, seit langem zu den Bewunderern des Dichters zählte und 1936 das Vorwort für dessen Lyrikband „Um uns die Fremde“ schrieb.