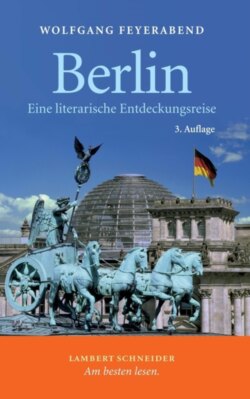Читать книгу Berlin - Wolfgang Feyerabend - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Vom Alexanderplatz durch das Scheunenviertel in die Spandauer Vorstadt
ОглавлениеDer Abbruch der Befestigungsanlagen in der Mitte des 18. Jahrhunderts und die damit einhergehende Verschiebung der Stadtgrenzen rückte das vor dem Königstor und dem Stadtgraben gelegene Gelände, auf dem Viehmärkte und Exerzierübungen abgehalten wurden, aus der Vorstadt ins Zentrum. Anlässlich des Berlin-Besuches von Zar Alexander I. erhielt der Platz 1805 seinen Namen. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein bewahrte sich der „Alex“ jedoch einen vorstädtischen Charakter.
Berlins erster literarischer Flaneur Arthur Eloesser, Theaterkritiker, Literaturhistoriker und Publizist, erinnert sich in seinem 1919 erschienenen Buch „Die Straße meiner Jugend. Berliner Skizzen“:
Der Königsgraben wurde also zugunsten der Stadtbahn zugeschüttet oder vielmehr zugeschippt, wie wir Jungen sagten. Und was hat man da an Erinnerungen mit begraben! Da zog sich am Ufer entlang der Garten der Gesellschaft der Freunde, in dem uralte Kastanien und Linden es sich sauer werden ließen, jedes Frühjahr wieder um die Wette zu blühen. Aber die Blüten gingen uns nichts an, unsere Sache waren vielmehr die abgefallenen, trockenen Herbstblätter, aus denen wir schon vor Zeiten des Tabakersatzes unsere ersten Zigaretten drehten.
Mit der Errichtung der Stadtbahntrasse auf dem Stadtgraben, dem Ausbau des Straßenbahnnetzes und der Fertigstellung der Zentralmarkthallen entwickelte sich der Alexanderplatz noch vor der Jahrhundertwende zum quirligen Verkehrs- und Einkaufszentrum des Berliner Ostens. 1911 öffnete das Warenhaus Tietz seine Pforten, und zwei Jahre später nahm auch die U-Bahn ihren Betrieb auf. 1930–1932 entstanden nach Plänen von Peter Behrens das Berolina-Haus und das Alexander-Haus. Beide Gebäude blieben von der zu DDR-Zeiten vorgenommenen Umgestaltung des Platzes verschont und erinnern als einzige in diesem Bereich an die bauliche Vorkriegssituation.
Untrennbar verbunden mit dem Namen des Platzes ist Alfred Döblins Roman, „Berlin Alexanderplatz“, der 1929 erschien und seinen Autor über Deutschland hinaus bekannt machte. Als 10-Jähriger war Döblin mit der Mutter und den Geschwistern aus Stettin in die Hauptstadt übersiedelt, nachdem sein Vater die Familie verlassen und sich in Richtung Amerika abgesetzt hatte. In wechselnden Wohnungen nahe dem Alexanderplatz wuchs er auf und betrieb später jahrelang eine Praxis als Kassenarzt in der Frankfurter Allee, der heutigen Karl-Marx-Allee. Als Jude und Nazigegner doppelt gefährdet, ging er bereits einen Tag nach dem Reichstagsbrand ins Exil. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam er als kulturpolitischer Mitarbeiter der französischen Militärregierung nach Deutschland zurück und besuchte 1946 auch die Stadt, aus der er dreizehn Jahre zuvor vertrieben worden war:
Diesen Platz, ich kenne ihn noch. Ich kannte ihn schon, als sich noch nicht einmal der mächtige Tietz-Palast hier erhob, derselbe Platz, den man jetzt samt Kuppel niedergeboxt hat. (Das Gebäude sieht aus wie ein Mann, dem ein Stoß das Genick gebrochen und den Schädel in den Brustkasten heruntergeschoben hat.) Ich kenne den Platz noch aus der Zeit, wo es hier sehr ruhig herging und sich in seiner Mitte ein kleiner Hügel erhob, den ein freundlicher grüner Rasen bedeckte; da gab es auch ein Gebüsch, in dem Bänke standen, auf denen man friedlich beieinander saß, friedlich im Grünen, mitten in Berlin auf dem Alexanderplatz.
Wir saßen oft hier, meine Mutter und ich, auch einer meiner Brüder, wenn wir zur großen Markthalle gingen und der Mutter die Tasche trugen. Wir gingen gerne mit. Wir wohnten Blumenstraße, Grüner Weg, später Landsbergerstraße. Ich besuchte die Gemeinde-Schule am Friedrichshain, Höchststraße, etwa 1888–90. Wie weit das zurückliegt. Es fuhren noch Pferdebahnen, es gab noch kein elektrisches Licht.
Heimat wurde ihm Berlin nach dem Krieg nicht mehr. In den Jahren 1946–1951 lebte Alfred Döblin in Baden-Baden, wo er als Herausgeber der Zeitschrift „Das goldene Tor“ tätig war. 1949 gehörte er zu den Mitbegründern der Akademie für Wissenschaften und Literatur in Mainz, zu dessen Vizepräsidenten man ihn berief. Später sowohl von der politischen Nachkriegsentwicklung in beiden deutschen Staaten als auch von der weitgehenden Nichtbeachtung seines literarischen Werkes enttäuscht, lebte er ab 1953 in Paris. Erst als Schwerkranker kehrte er drei Jahre später nach Deutschland zurück, wo er in Emmendingen bei Freiburg starb.
In Nachbarschaft zum Alexanderplatz, getrennt durch die Prenzlauer Straße (heute Karl-Liebknecht-Straße), befand sich das Scheunenviertel. Es war 1672 vor dem Georgentor angelegt worden, um das Erntegut außerhalb der Stadt zu lagern und Feuersbrünsten vorzubeugen. Das „Scheunenfeld“, wie es zunächst hieß, bestand ursprünglich aus sieben Gassen mit mehr als dreißig Scheunen. Ab dem späten 18. Jahrhundert nach und nach zum Wohnquartier umfunktioniert, lebten in dem Viertel jahrzehntelang Handwerkerfamilien, Kaufleute und kleine Angestellte. Erst mit dem Aufstieg Berlins zur Reichshauptstadt und den damit verbundenen sozialen Verwerfungen geriet die Gegend als Problembereich und Unterweltbezirk in den Fokus; „s’ dunkle Berlin“ nannte es Heinrich Zille in einer seiner Radierungen.
In den Jahren 1906–1908 erfolgte der Abriss des Scheunenviertels. An dessen Stelle entstand der Bülowplatz (heute Rosa-Luxemburg-Platz), auf dem 1913/14 nach Plänen von Oskar Kaufmann die Volksbühne erbaut wurde. Aus Spendenmitteln der Theatervereinsmitglieder finanziert, sollte hier der realistisch-zeitnahen Bühnenkunst ein Forum geboten werden. Unter der Intendanz von Erwin Piscator, später von Karlheinz Martin gehörte die Volksbühne in den 1920er Jahren zu den Spielstätten Berlins, in denen prononciert linkes Theater gemacht wurde.
Ein wenig Skepsis gegenüber dem Theaterhaus scheint in der Reportage „Östlich um den Alexanderplatz“ mitzuschwingen, die Alfred Döblin unter dem Pseudonym Linke Poot 1923 im „Berliner Tageblatt“ veröffentlichte:
Der Bülowplatz trägt die pompöse „Volksbühne“; umringt ist er von wüsten Lagerplätzen für Alteisen, Schienen. Sehr lebhafter Wagenverkehr; es wimmelt von Menschen. Und immer „Gelegenheitskäufe“, Tuchläden, Uhrmachergeschäfte, Stiefel. – Links die Grenadierstraße. Hier scheint ein Dauerauflauf zu sein. Der Damm ist von Menschen besetzt; sie kommen und gehen aus den winkligen, uralten Häusern. Das ist ein ganz östliches Quartier, das gutturale Jiddisch dominiert. Die nicht zahlreichen Läden tragen hebräische Inschriften; ich treffe Vornamen: Schaja, Uscher, Chanaine. In Schaufenstern zeigt ein jüdisches Theater an: „Jüdele der Blinde, fünf Akte von Joseph Lateiner“. Jüdische Fleischereien, Handwerkerstuben, Buchläden. Das bewegt sich in unaufhörlicher Unruhe, blickt aus den Fenstern, ruft, bildet Gruppen und tuschelt in finsteren Hausfluren.
Nach der Niederlegung des historischen Scheunenviertels war ein Teil der Bewohnerschaft in die umliegenden Straßen des Bülowplatzes gezogen, so dass der Volksmund nun auch auf Bereiche der Spandauer Vorstadt den Namen Scheunenviertel übertrug. Im Zentrum dieses „neuen“ Scheunenviertels lagen Hirten-, Grenadier- und Dragonerstraße (heute Almstadt- und Max-Beer-Straße). Im und nach dem Ersten Weltkrieg fanden hier die mittellosen ostjüdischen Flüchtlinge Unterkunft.
Der junge Journalist Joseph Roth, der nach dem Ende des Ersten Weltkrieges von Wien in die deutsche Hauptstadt kam und hier für Berliner Zeitungen wie das „Zwölf-Uhr-Blatt“, den „Börsen-Courier“ oder den sozialdemokratischen „Vorwärts“ arbeitete, schildert in seinem 1927 erschienenen Essay „Juden auf Wanderschaft“ eine der Straßen dieses Viertels:
Die Hirtenstraße ist eine Berliner Straße, gemildert durch ostjüdische Einwanderer, aber nicht verändert. Keine Straßenbahn durchfährt sie. Kein Autobus. Selten ein Automobil. Immer Lastwagen, Karren, die Plebejer unter den Fahrzeugen. Kleine Gasthäuser stecken in den Mauern. Man geht auf Stufen zu ihnen empor. Auf schmalen, unsauberen, ausgetretenen Stufen. Sie gleichen dem Negativ ausgetretener Absätze. In offenen Hausfluren liegt Unrat. Auch gesammelter, eingekaufter Unrat. Unrat als Handelsobjekt. Altes Zeitungspapier. Zerrissene Strümpfe. Alleinstehende Sohlen. Schnürsenkel. Schürzenbänder. Die Hirtenstraße ist langweilig vororthaft. Sie hat nicht den Charakter einer Kleinstadtstraße. Sie ist neu, billig, schon verbraucht, Schundware. Eine Gasse aus einem Warenhaus. Aus einem billigen Warenhaus.
Um die Not der ostjüdischen Flüchtlinge zu lindern, hatte der junge Mediziner Siegfried Lehmann zusammen mit einer Gruppe jüdischer Studenten bereits 1916 das Jüdische Volksheim in der Dragonerstraße 22 (heute Max-Beer-Straße 5) gegründet. Der Einrichtung waren ein Kindergarten, eine Beratungsstelle für Eltern und eine Tischlerwerkstatt angeschlossen, in der arbeitslose Jugendliche Beschäftigung fanden. Außerdem wurden Diskussionsabende, Lesungen und Vorträge veranstaltet. Gershom Scholem, der in den 1920er Jahren nach Palästina ging und als Religionsphilosoph namhaft wurde, schloss sich auf Anregung von Martin Buber diesem sozial engagierten Kreis junger Leute an:
Als ich im September 1916 zum erstenmal ins Volksheim kam, bot sich mir ein seltsames Bild. Die Helfer und Besucher saßen auf den Stühlen; am Boden, höchst malerisch um Gertrude, die Röcke hochästhetisch drapiert, saßen die jungen Mädchen, unter denen, wie wir jetzt wissen, Franz Kafkas Braut Felice Bauer war. Kafka hatte sie energisch dazu ermuntert, am Volksheim mitzuarbeiten. Die Zusammenkunft war literarisch. Siegfried Lehmann las aus Franz Werfels Dichtungen, und ich höre noch in meiner Erinnerung das „Gespräch an der Mauer des Paradieses“, das sicher nicht zu seinen schlechtesten Gedichten gehört. Aber ich war schockiert. Was mich umgab, war eine Atmosphäre ästhetischer Ekstase, wohl das letzte, was zu finden ich hergekommen war.
Ab 1926 entstand unter Leitung des Architekten Hans Poelzig die Randbebauung des Bülowplatzes. Von den Baumaßnahmen waren auch einige der Nebenstraßen betroffen. Der Schriftsteller und Journalist Franz Hessel konstatierte 1930 in einem Beitrag für die Zeitschrift „Atlantis“:
Das Wahlghetto der Ostjuden in dem einst „Scheunenviertel“ genannten Stadtteil zwischen Alexander- und Bülowplatz ist jetzt schon leerer Bauplatz geworden oder unter neuen Häuserblöcken verschwunden, und man sieht nicht mehr Männer mit alttestamentarischen Bärten und Schläfenlocken und heißäugige Fleischerstöchter auf dem Straßendamm abends promenieren …
Nach dem Machtantritt der Nazis wurden die in Berlin verbliebenen Ostjuden in ihre Herkunftsgebiete abgeschoben, unabhängig davon, ob sie dort willkommen waren oder nicht.
Das „Wahlghetto“, wie es Franz Hessel nannte, hörte auf zu sein. Hier und da ließen sich zu DDR-Zeiten noch einige verblasste jüdische Firmeninschriften an den Fassaden entdecken. Mit der zur 750-Jahr-Feier Berlins vorgenommenen teilweisen Sanierung des Stadtteils verschwanden um 1980 auch diese allerletzten Spuren. Selbst an dem erhalten gebliebenen Haus des ehemaligen Jüdischen Volksheims sucht der interessierte Spaziergänger bis heute vergeblich einen erinnernden Hinweis.
Die Münzstraße, südliche Begrenzung der Almstadt- und Max-Beer-Straße, war im 18. Jahrhundert Standort des Königlichen Münzgebäudes. In dem durch einen Neubau ersetzten Haus Nr. 10 wohnte der Schriftsteller Karl Philipp Moritz, der mit dem 1785–1794 in vier Bänden erschienenen „Anton Reiser“ einen der großen Entwicklungsromane deutscher Sprache schuf.
Im frühen 20. Jahrhundert entwickelte sich die Straße zur Amüsier- und Kinomeile des Berliner Ostens. In Irmgard Keuns 1932 veröffentlichtem Roman „Das kunstseidene Mädchen“ findet die Heldin hier bei einer Freundin Unterkunft. Doris, Sekretärin eines Rechtsanwalts, hat ihre Stelle gekündigt und ist aus der Provinz nach Berlin gekommen, um beim Film Karriere zu machen:
Und ich wohne bei Tilli Scherer in der Münzstraße, das ist beim Alexanderplatz, da sind nur Arbeitslose ohne Hemd und furchtbar viele. Aber wir haben zwei Zimmer, und Tilli hat Haare aus gefärbtem Gold und einen verreisten Mann, der arbeitet bei Essen Straßenbahnschienen. Und sie filmt. Aber sie kriegt keine Rollen, und es geht auf der Börse ungerecht zu.
Die gebürtige Berlinerin Irmgard Keun begann als Schauspielerin, ehe sie sich, von Kurt Tucholsky gefördert, ganz dem Schreiben zuwandte. Mit ihren humoristisch-satirischen Romanen feierte sie große Erfolge. Nach dem Machtantritt der Nazis verweigerte sie den Beitritt zur Reichsschrifttumskammer und erhielt daraufhin Berufsverbot. 1936 emigrierte sie über mehrere europäische Länder in die USA und kam vier Jahre später illegal nach Deutschland zurück. Obwohl sie nach dem Zweiten Weltkrieg weiterhin publizierte, geriet ihr Werk zunehmend in Vergessenheit und wurde erst spät mit dem in den 1970er Jahren wachsenden Interesse an der Frauenliteratur wiederentdeckt.
In der Münzstraße, Ecke Neue Schönhauser Straße befand sich das Geburtshaus von Carl Friedrich Zelter. Als er sich mit fünfzig Jahren entschloss, seine Autobiographie zu schreiben, leitete er sie mit den Worten ein:
Im Jahre 1758, am 11. Dezember, während des Siebenjährigen Krieges, in Berlin, in dem Hause, wo ich dieses schreibe, bin ich geboren.
Erbaut hatte das heute nicht mehr erhaltene Haus Münzstraße 1 (heute Nr. 20) sein Vater, ein erfolgreicher Bauunternehmer, der 1787 starb und dem Sohn die Firma hinterließ. Neben dem väterlichen Betrieb, den er noch lange Jahre weiterführte, machte sich Zelter aber schon bald in der Musikwelt einen Namen. Als Nachfolger seines Lehrers Carl Friedrich Fasch übernahm er 1800 die Leitung der Berliner Singakademie und formte sie zu einem der herausragenden Chöre seiner Zeit. Gemeinsam mit seinem Schüler Felix Mendelssohn Bartholdy trug er entscheidend zu der im frühen 19. Jahrhundert einsetzenden Bach-Renaissance bei. Seine Vertonungen von mehr als achtzig Goethe-Texten brachten ihm darüber hinaus die Freundschaft des Weimarer Dichterfürsten ein.
Schräg gegenüber residierte in den 1830er Jahren die Konditorei Anthieny, zu deren regelmäßigen Gästen der junge Theodor Fontane zählte. Für den ungestörten Kaffeehausbesuch wurde manche Unterrichtsstunde in der Klödenschen Gewerbeschule geschwänzt, die er zu dieser Zeit besuchte:
An der Ecke der Schönhauser- und Weinmeisterstraße, will also sagen an einer Stelle, wohin Direktor Klöden und die gesamte Lehrerschaft nie kommen konnten, lag die Konditorei meines Freundes Anthieny, der der Stehely jener von der Kultur noch unberührten Ostnordost-Gegenden war. Da trank ich dann, nachdem ich vorher einen Wall klassisch-zeitgenössischer Literatur: den „Beobachter an der Spree“, den „Freimütigen“, den „Gesellschafter“ und vor allem mein Leib- und Magenblatt, den „Berliner Figaro“, um mich her aufgetürmt hatte, meinen Kaffee. Selige Stunden.
Auf Betreiben des Vaters hatte der 14-jährige Theodor Fontane 1833 das Neuruppiner Gymnasium mit der Berliner Schule vertauscht, die er drei Jahre später beendete, um eine Lehre als Apotheker anzutreten. Von wenigen Ausnahmen abgesehen – den Wanderjahren als Apotheker und der Zeit als Korrespondent in London –, blieb er der Stadt, in der er später zehn seiner Romane ansiedelte, bis an sein Lebensende verbunden.
Besaß die Spandauer Vorstadt noch bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein ihre gutbürgerlichen Ecken und Winkel, so begann mit der Abwanderung der Besserverdienenden in Richtung Westen der unaufhaltsame Abstieg des Viertels. Unterweltkneipen und der Straßenstrich bestimmten um die Münzstraße herum das Bild. In den 1921 verfassten Reportagen „Nächte in Kaschemmen“ heißt es bei Joseph Roth:
Die Romantik der Kaschemmennächte bricht am Bahnhof Alexanderplatz, Ausgang Münzstraße, ein und überwuchert groß, schwellend, die Gegend, ich glaube, die ganze Welt. Zu dem Wesen dieser Kaschemmennächte gehört die Neue Schönhauser Straße, aus deren Pflastersteinen, als wären es Laternenpfähle oder sonstwie der Straße gehörende Gegenstände, Zuhälter und ihre Mädchen wachsen, und auch die Polizeidirektion, deren Tore bereits zu sind und von zwei Grünen bewacht. Die Sehnsucht dieser zwei Schutzpolizisten ist eine Zigarette, die man nicht rauchen darf im Dienst, oder eine Stunde in einem rötlich angehauchten Lokal und nicht eine Dirne, die man abfassen kann, weil ihr Zuhälter nicht rasch genug zur Stelle war, sondern ein Zigarettengeschäft gewissenlos, pflichtvergessen in einer Haustornische abwickelte.
Zu den zwielichtigen Etablissements gehörte das Reese-Lokal in der Neuen Schönhauser Straße 20. Der Journalist PEM, der in der Nazi-Zeit nach England emigrierte und nach dem Zweiten Weltkrieg sein Erinnerungsbuch „Heimweh nach dem Kurfürstendamm“ veröffentlichte, weiß zu berichten, dass hier
am Vormittag die Prostituierten der vorletzten Klasse feierten, wenn die polizeiärztliche Kontrolle bei der Sittenpolizei, der sie sich jede Woche zweimal unterwerfen mussten, gut abgelaufen war.
In diesem Viertel fand 1884 der 22-jährige Gerhart Hauptmann eine Unterkunft. Nach Bildhauerstudium in Breslau, Geschichtsstudium in Jena und einem zweijährigen Italien-Aufenthalt war er in die Spreemetropole gekommen, um seine Studien fortzusetzen und Schauspielunterricht zu nehmen. In der am Alten Garnisonfriedhof gelegenen Kleinen Rosenthaler Straße, unweit des Rosenthaler Platzes, wohnten er und sein Freund Ferdinand Simon zur Untermiete:
Wir kamen im Rosenthaler Viertel unter. Es ist eine Gegend, die man kennen muss, um zu wissen, dass sie mit dem Westen Berlins nicht in einem Atem zu nennen ist. Wir hatten Zimmer im ersten Stock und blickten auf einen Kirchhof hinaus … Um das Rosenthaler Tor sah ich Berlin aus der Froschperspektive. Dort wurde man mit den Strömungen der Massen hin und her bewegt, jederzeit in Gefahr, darin zu versinken. Wie oft beim Scheine des nächtlichen Gaslichts habe ich mich von ihnen drängen und schieben lassen, von der unendlich bunten Fülle menschlicher Typen in Bann gehalten … Man war beinah kein einzelner mehr, sondern war in den Volkskörper, in die Volksseele einbezogen. Man erlebte hier weniger sich als das Volk und war mit ihm ein Puls, ein und dasselbe Schicksal geworden.
Die Heirat mit Marie Thienemann, der Tochter eines Großkaufmannes, enthob ihn des weiteren Studiums. Hauptmann begann, seine Existenz auf den Beruf des freien Schriftstellers zu gründen. Im Rahmen der „Freien Bühne“ wurde 1889 im Lessing-Theater sein Stück „Vor Sonnenaufgang“ uraufgeführt, das einen Theaterskandal verursachte, ihm aber den literarischen Durchbruch brachte. Für sein Schaffen, das der deutschsprachigen Dramenkunst wieder internationale Geltung verschaffte, erhielt er 1912 den Literaturnobelpreis.
Der schon zur Rosenthaler Vorstadt gehörende Rosenthaler Platz und die in die Spandauer Vorstadt hineinführende Rosenthaler Straße bilden den Hintergrund der Eingangsszenen in Alfred Döblins Roman „Berlin Alexanderplatz“. Franz Biberkopf, aus dem Gefängnis in Tegel entlassen, wo er eine zehnjährige Strafe wegen Totschlags verbüßt hat, steigt aus der Straßenbahn und versucht sich zurechtzufinden:
Man riss das Pflaster am Rosenthaler Platz auf, er ging zwischen den anderen auf Holzbohlen. Man mischt sich unter die anderen, da vergeht alles, dann merkst du nichts, Kerl. Figuren standen in den Schaufenstern in Anzügen, Mänteln, mit Röcken, mit Strümpfen und Schuhen. Draußen bewegte sich alles, aber – dahinter – war nichts! Es – lebte – nicht! Es hatte fröhliche Gesichter, es lachte, wartete auf der Schutzinsel, gegenüber Aschinger zu zweit oder zu dritt, rauchte Zigaretten, blätterte in Zeitungen. So stand das da wie Laternen – und – wurde immer starrer. Sie gehörten zusammen mit den Häusern, alles weiß, alles Holz. Schreck fuhr in ihn, als er die Rosenthaler Straße herunterging und in einer kleinen Kneipe ein Mann und eine Frau dicht am Fenster saßen: die gossen sich Bier aus Seideln in den Hals, ja was war dabei, sie tranken eben, sie hatten Gabeln und stachen sich damit Fleischstücke in den Mund, dann zogen sie die Gabeln wieder heraus und bluteten nicht. Oh, krampfte sich sein Leib zusammen, ich kriege es nicht weg, wo soll ich hin?
Der Erfolg des Romans, der im Übrigen weniger am Alexanderplatz selbst als in dessen Nachbarvierteln spielt, hat, wie Döblin später mehrfach beklagte, sein literarisches Schaffen derart überdeckt, dass die Öffentlichkeit kaum noch die weiteren Bücher wahrnahm. In die Preußische Dichterakademie war er allerdings bereits vor dem Erscheinen von „Berlin Alexanderplatz“ aufgenommen worden und auch späterhin entstand eine ganze Reihe bedeutender Werke, darunter „Pardon wird nicht gegeben“, „November 1918“, „Hamlet oder Die lange Nacht nimmt ein Ende“.
Im Haus Schwarzenberg, in der Rosenthaler Straße 39, befand sich im Hofgebäude die Bürstenfabrik von Otto Weidt. Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges beschäftigte der Unternehmer hier blinde jüdische Zwangsarbeiter- und arbeiterinnen und gewährte ihnen auf diese Weise Schutz. Die heute in Berlin und Tel Aviv lebende Schriftstellerin Inge Deutschkron, damals als Sekretärin bei Weidt tätig, schreibt über ihn in ihrem Buch „Ich trug den gelben Stern“:
Weidt übergab mir die Expedition und das Telefon – keine Aufgaben, die eine volle Arbeitskraft erfordert hätten. Ich tat mein möglichstes, um mich dankbar zu erweisen und mein Gehalt zu verdienen … Ich bewunderte Weidt. Er war für mich eine Art Vaterersatz. Sein kämpferischer Geist imponierte mir, da ich durch mein Elternhaus kämpfen gewohnt war … Er arrangierte gesellige Abende in seinem Büro. Auf dem schwarzen Markt kaufte er Fleisch ein und ließ herrliche Mahlzeiten von der eine Treppe höher wohnenden Portiersfrau, die auch nicht ohne Grund freundlich zu uns war, zubereiten … Diese Abende an einer improvisierten Tafel im Büro gehören zu den wenigen schönen Stunden, die mir aus jener Zeit in Erinnerung geblieben sind.
Im Hofgebäude ist heute eine Gedenkstätte eingerichtet, die von der Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand betreut wird. Im Nachbarkomplex, den Hackeschen Höfen, erinnert im Eingang eine Gedenktafel an den Dichter Jakob van Hoddis. In den ehemals hier befindlichen Festsälen gründete er gemeinsam mit Kurt Hiller, Erwin Loewenson und anderen 1910 den „Neuen Club“, aus dem die expressionistische Dichtervereinigung, das „Neopathetische Cabaret“, hervorging.
Die Rosenthaler Straße mündet in den Hackeschen Markt, an dem einst das Spandauer Tor stand, das der Spandauer Vorstadt, die ab dem späten 17. Jahrhundert angelegt wurde, den Namen gab. Die Schleifung der Wallanlagen erfolgte um 1750. Mit der Leitung der Arbeiten betraute König Friedrich II. den Stadtkommandanten Generalleutnant Johann Christoph Friedrich Graf von Hacke. 1878 schließlich wurde der Stadtgraben zum Bau der Stadtbahntrasse zugeschüttet. Der Bahnhof Börse (heute S-Bahnhof Hackescher Markt) entstand. 1883 verfasste der umtriebige Verlags- und Zeitschriftengründer Emil Dominik ein Buch unter dem Titel „Quer durch und ringsum Berlin. Eine Fahrt auf der Berliner Stadt- und Ringbahn“, in dem er sich auch dem Hackeschen Markt, seinem Namensgeber und den frühen prominenten Bewohnern widmete:
Die „alte Kommandantenstraße“, die heutige „Neue Promenade“, erhielt, wie schon erwähnt, von diesem Manne, der Berlins Kommandant war, ebenfalls ihren Namen.
Nr. 10 dieser Straße war einst die Wohnung Fichte’s und gehörte später den Banquiers Gebrüder Veit. Simon Veit war der Schwiegersohn Moses Mendelssohn’s gewesen, seine Frau ging später mit Wilhelm von Schlegel durch, wurde dessen Gattin und wurde weiterhin von ihrem ersten Mann unterstützt.
In Nr. 3 der „Neuen Promenade“, gerade dem Bahnhof „Börse“ gegenüber, an der Ecke des Hacke’schen Marktes, lebte die Dichterin Karschin von 1787 bis zur ihrem Tode.
Anna Louisa Karsch(in), die aus einfachen Verhältnissen stammte und in Berlin durch die Aufklärer Gotthold Ephraim Lessing, Moses Mendelssohn, Carl Wilhelm Ramler und Johann Georg Sulzer gefördert wurde, war die erste freiberufliche Schriftstellerin in Deutschland. Ständig von Existenzsorgen geplagt, hatte ihr Friedrich II. bei einer Audienz in Sanssouci finanzielle Unterstützung zugesichert, auf die sie allerdings jahrelang vergeblich wartete. Erst Friedrich Wilhelm II. löste das Versprechen seines Onkels ein und ließ ihr ein Haus errichten. In dem „Versuch einer Danksagung an König Friedrich Wilhelm den Vielgeliebten Im Februar 1787“ gab die Dichterin ihrer übergroßen Freude Ausdruck:
Monarch und Schöpfer eines Glücks, Das meinem Alter Blumen streuet, Ich habe nur im Ausdruck meines Blicks Die Sprache, die kein Wörterbuch verleihet, Nur Thränen hab’ ich statt des Tons, Wenn ich Dir danken will, Dir Schutzgott auf der Höhe Des landesväterlichen Throns – Ich fühl’s, daß ich auf Rosen gehe, Auf Rosen schlummre leicht und süß, Seitdem Dein Wöllner mir’s verkündet, Was ihm sein König hieß: Ein Haus, ein Haus wird mir gegründet, Wird aufgebauet, wird geschmückt, Als wär’s ein Tempelchen der Musen – O wenn’s mein Auge nun erblickt, Dann wird mein abgelebter Busen Zu enge für des Herzens Drang, Es flammt bei dieser Augenweide Vielleicht nur Tage lang, Wird wonnekrank Und stirbt den schönen Tod der Freude Sein letzter Schlag ist Dank!
Nicht viel mehr als drei Jahre blieben der Karsch(in), sich an dem Haus zu erfreuen. Sie starb 69-jährig im Oktober 1791 und wurde auf dem Kirchhof der Sophiengemeinde an der Großen Hamburger Straße beigesetzt. Lesenswert geblieben sind ihre Naturgedichte und Kriegsklagen sowie ihr Briefwechsel mit Ludwig Gleim und anderen Schriftstellergrößen der Zeit.
Von der am Hackeschen Markt beginnenden Oranienburger Straße zweigt die Große Hamburger Straße ab, die Teil des alten Landwegs in Richtung Hamburg war. 1672 wurde hier der erste Jüdische Friedhof Berlins angelegt, auf dem Persönlichkeiten wie Marcus Herz oder Jacob Herz Beer, der Vater des Komponisten Giacomo Meyerbeer, ihre letzte Ruhestätte fanden. Marcus Herz, der bei Immanuel Kant in Königsberg studiert hatte, wirkte als Arzt und Philosoph. Seine Gattin, Henriette Herz, wurde die erste berühmte Saloniére Berlins. In ihrem Salon verkehrten Carl Friedrich Zelter und Karl Philipp Moritz, Alexander und Wilhelm von Humboldt, August und Friedrich Schlegel, Friedrich Schleiermacher und Ludwig Börne.
Auf dem von den Nazis zerstörten Begräbnisplatz ist heute nur noch ein Gedenkgrab zu finden. Es ist Moses Mendelssohn gewidmet, der als 14-Jähriger aus Dessau kam, um in Berlin zu studieren. Später als Buchhalter in der Bernhardschen Seidenfabrik tätig, begann er sich auch mit Fragen der Philosophie und Religion auseinander zu setzen.
Gedenkgrab für Moses Mendelssohn, Alter Jüdischer Friedhof
1767 erschien Moses Mendelssohns religionsphilosophische Schrift „Phädon oder Über die Unsterblichkeit der Seele“, die ihn in ganz Europa bekannt machte. Ihm, der zeitlebens für die jüdische Emanzipation und die Gleichberechtigung der Religionen eintrat, verdankte die Aufklärung in Preußen entscheidende Impulse. Gleichwohl lehnte es König Friedrich II. ab, ihn in die Akademie der Wissenschaften aufzunehmen. Mit seinem dramatischen Gedicht „Nathan der Weise“ setzte Gotthold Ephraim Lessing dem Wirken des Freundes ein literarisches Denkmal.
Die Anlage des Friedhofs, um den herum sich ab Mitte des 18. Jahrhunderts weitere Jüdische Gemeindeeinrichtungen ansiedelten, darunter das Krankenhaus, das Altenheim und die Knabenschule, trug dazu bei, dass sich in dem Quartier vor dem Spandauer Tor schon früh Familien jüdischen Glaubens niederließen. Vom „Toleranzviertel“ war denn zuweilen die Rede, weil Christen und Juden hier gemeinsam lebten.
Nach der Wende von 1989 wurde die baulich vernachlässigte Spandauer Vorstadt, insbesondere die Gegend um die Oranienburger Straße, das Szene-Viertel des wiedervereinten Berlins. Eines der ersten Lokale, das hier eröffnete, war das von Künstlern mit Eisenmöbeln anarchisch eingerichtete Silberstein Café in der Oranienburger Straße 27. Der Erzähler Alban Nikolai Herbst machte es zum Schauplatz seines 1998 erschienenen phantastischen Romans „Thetis. Anderswelt“:
Ich sitze doch schon im Café Silberstein, das zu meiner Überraschung wirklich Samhain heißt. Jedenfalls steht das auf der Speisekarte. Ich warte. Vielleicht, denke ich, haben die Pächter gewechselt. Verändert hat sich sonst aber nichts; ein sehr witziger chaotischer Ort, der mich von dieser Diskette wenigstens vorübergehend ablenken kann. Etwas Dunkel-Utopisches. Skulpturen stehen herum, die an H. R. Giger erinnern. Und man sitzt auch auf Kunst. Das gibt dem sozialen Raum etwas Kultisches. Über der der Eingangstür gegenüberliegenden Wand leuchten Dia-Projektionen. An die Wand ist ein Gedicht geschmiert …
Neben dem „Silberstein“, das seine Gäste inzwischen in gewandeltem Ambiente empfängt, befindet sich das um die Wende zum 20. Jahrhundert erbaute Verwaltungsgebäude der Jüdischen Gemeinde. Hier waren einst die Hauptverwaltung der Gemeinde, das Gesamtarchiv der deutschen Juden, die Freie Jüdische Volkshochschule und die Hauptbibliothek untergebracht.
Gleich nebenan, Oranienburger Straße 30, steht die Neue Synagoge. Nach Plänen Eduard Knoblauchs erbaut, war sie mit über 3000 Plätzen das größte jüdische Gotteshaus Deutschlands. Dass das Gebäude in der Pogromnacht am 9. November 1938 der Zerstörung entging, ist dem mutigen Einschreiten des Polizeioffiziers Wilhelm Krützfeld zu verdanken. Gewürdigt hat diesen seltenen Fall von Zivilcourage der Schriftsteller Heinz Knobloch in seinem 1991 veröffentlichten Buch „Der beherzte Reviervorsteher“:
Aber auch in der Pogromnacht hatte es in ihren Räumen gebrannt, SA-Leute waren eingedrungen und hatten Feuer gelegt. Doch nicht lange, da erschien der Vorsteher des zuständigen Polizeireviers mit ein paar Mann am Tatort und verjagte die Brandstifter. Mit vorgehaltener Pistole und einem Aktendeckel, in dem sich ein Schriftstück befand, das den bedeutenden Kunst- und Kulturwert des Gebäudes unter polizeilichen Schutz stellte. Gleichzeitig beorderte der Polizeioffizier die Feuerwehr zur Brandstelle. Die kam auch und löschte, was ebenfalls bemerkenswert war angesichts der Situation im Deutschen Reich. Die meisten Feuerwehren standen untätig wie befohlen oder griffen nur ein, wenn die Flammen auf die nichtjüdische Nachbarschaft überzugreifen drohten.
Von dem nach den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg als Ruine stehen gebliebenen Gotteshaus wurde 1988–1995 nur der Eingangsbereich wiederhergestellt. Das Gebäude dient heute als Museum und Begegnungsstätte sowie als Sitz der Stiftung „Neue Synagoge – Centrum Judaicum“.
In der Nähe der Neuen Synagoge entstanden im späten 19. Jahrhundert weitere jüdische Gemeinde- und Kultureinrichtungen. So bezog 1872 die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums das Haus in der Artilleriestraße 14 (heute Tucholskystraße 9). Neben der Rabbiner-Ausbildung legte man von Anfang an den Schwerpunkt auf die Lehr- und Forschungstätigkeit sowie die allseitige Vermittlung jüdischen Wissens.
1923 besuchte der Prager Schriftsteller Franz Kafka Lehrveranstaltungen der Hochschule. An den Freund Robert Klopstock schrieb er 1923:
Die Hochschule für jüdische Wissenschaft ist für mich ein Friedensort in dem wilden Berlin und in den wilden Gegenden des Inneren … Ein ganzes Haus schöne Hörsäle, große Bibliothek, Frieden, gut geheizt, wenig Schüler und alles umsonst. Freilich bin ich kein ordentlicher Hörer, bin nur in der Präparandie und dort nur bei einem Lehrer und bei diesem nur wenig, so dass sich schließlich alle Pracht wieder fast verflüchtigt, aber wenn ich auch kein Schüler bin, die Schule besteht und ist schön und ist im Grunde gar nicht schön, sondern eher merkwürdig bis zum Grotesken und darüber hinaus bis zum unfassbar Zarten (nämlich das Liberalreformerische, das Wissenschaftliche des Ganzen).
Das Haus, in dem seit 1998 der Zentralrat der Juden in Deutschland untergebracht ist, trägt heute den Namen von Leo Baeck, der hier von 1919 bis 1942 lehrte und zu den bedeutenden Lehrern der Hochschule gehörte. Nach der Machtergreifung der Nazis erhielt der Rabbiner und Wissenschaftler Stellenangebote aus aller Welt, entschloss sich aber zu bleiben. 1943 ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, wurde er 1945 von Soldaten der Roten Armee befreit. Albert Einstein würdigte 1953 das Wirken Leo Baecks in einem Brief zu dessen achtzigstem Geburtstag:
Oranienburger Straße 29 und 30, ehemaliges Verwaltungsgebäude der Jüdischen Gemeinde und Neue Synagoge
Was dieser Mann den in Deutschland gefangenen und dem sicheren Untergang entgegenstehenden Brüdern gewesen ist, kann der in dem Gefühl der äußeren Sicherheit Dahinlebende nicht voll begreifen. Er empfand es als selbstverständliche Pflicht, in dem Lande ruchloser Verfolgung auszuharren, um seinen Brüdern bis zuletzt eine seelische Stütze zu sein. Keine Gefahr scheuend, unterhandelte er mit den Vertretern einer aus ruchlosen Mördern bestehenden Regierung und wahrte in jeder Situation seine und seines Volkes Würde.
Die Tucholskystraße, die bis 1951 Artilleriestraße hieß, machte Erich Kästner 1930 zum Schauplatz seines Kinderbuches „Pünktchen und Anton“. Vierzig Jahre später widmete die Lyrikerin Sarah Kirsch der Straße ein Gedicht:
Tucholsky-Straße Aus meiner steinreichen Gegend In dieses schwindsüchtige Viertel. Kleine Fleischerläden, vorher Chamisso das steinige Lockenbild. In Evas Küche Töpfe auf dem Klavier. Offene Bilder und geschlossene Wände. Grün Wucherts aus platzenden Blumenvasen; Allerhand Hexenkraut Rab von der Decke. Wär ich die Malerin, ich malte Meinen Geliebten erst mal als Einhorn Und abermals unter blühenden Bäumen Leibhaft wie er herkommt Zweige aus allen Gliedern.
Sarah Kirsch, seit Mitte der 1960er Jahre mit Gedichtbänden, Erzählungen, Kinderbüchern und Reportagen bekannt geworden, zählt zu der Reihe namhafter Schriftsteller und Schriftstellerinnen in der DDR, die 1976 gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann protestierte und wenig später, durch die rigide Kulturpolitik in die Isolation gedrängt, in den Westen ging.
Unweit der Tucholskystraße befindet sich in der Oranienburger Straße 54–56a das Kunsthaus Tacheles. Die Ruine des ehemaligen Passage-Kaufhauses wurde 1990 von Künstlern besetzt und schnell zum Inbegriff alternativer Kunst. In dem im Haus untergebrachten Café Zapata fand zum ersten Mal die „Russendisko“ statt, die der aus Moskau stammende Wladimir Kaminer zur Titelgeschichte seines ersten und sogleich überaus erfolgreichen Buches machte:
Trotz der großen Anzahl zahlender Gäste war der Geschäftsführer des Zapata von den Russen im Großen und Ganzen enttäuscht, weil sie nicht so viel tranken, wie er gehofft hatte. Der Umsatz an der Bar ließ zu wünschen übrig, und die fünf Kisten von dem merkwürdigen Getränk „Puschkin-Leicht“, das er seit über einem Jahr auf Lager hatte und nun endlich loswerden wollte, verkauften sich nicht gut. Da die Mehrzahl der Gäste dennoch ziemlich schnell betrunken war, vermutete der Geschäftsführer, dass viele Russen nach alter Tradition ihre Getränke selbst mitgebracht hatten, und damit hatte er wohl gar nicht so Unrecht.