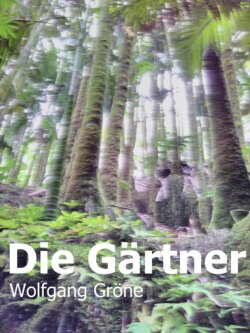Читать книгу Die Gärtner - Wolfgang Gröne - Страница 5
2. Brief, September 1710
ОглавлениеMein lieber S.
Bin ich doch endlich angekommen. Was für eine Fahrt! Die Postkutsche entließ mich in einer kleiner Stadt nahe meines Ziels. Dort erkundigte ich mich nach einem weiteren Transport zum Schlosse. Tatsächlich wurde für meinen Weitertransport schnell gesorgt und nach etwas weniger als einer halben Stunde saß ich bereits in einem etwas wackeligen Zweispänner, der mich die restlichen Meilen an mein Ziel bringen sollte. Die Straße dorthin, wenn man sie überhaupt so nennen kann, war durch den unausgesetzten Regen der letzten Tage aufgeweicht, und so ging es nur langsam voran. Ich hörte, wie der Kutscher, ein roher rotgesichtiger Kerl begleitet von einem jungen tumben Burschen, unausgesetzt die Peitsche gegen die erbarmungswürdigen Pferde führte.
Kurz noch etwas zur Landschaft, durch die wir fuhren. Wald, Feld und Flur lagen im sanftem Wechsel wie in Wellen vor mir. Aber nur sanft gingen diese Wellen. Der Charakter des Landes war dennoch der einer weiten, ruhigen, erhebungslosen Fläche und nur östlich und südlich durch ferne Hügelketten begrenzt. Menschen sah ich kaum, was am Wetter und der Jahreszeit liegen mochte, und wenn doch, waren es Bauern oder hin und wieder ein fahrender Händler mit Holzgaloschen an den Füßen und schwerem Gepäck auf dem Rücken. Auch erblickte ich eine Vielzahl Rinder, Schweine und vor allem Pferde auf den Wiesen. Das Frühjahr in dieser Landschaft würde für einen Maler sicherlich eine ergiebige Vorlage für einige hübsche Bilder abgeben, die man bei uns im städtischen Berlin zu schätzen und zu verkaufen wüsste.
Wie gesagt, die Landschaft ist recht flach, der Tag nach einem Regen klar, und so konnte ich in der Ferne ein breites schwarzes Dach und einige gelb gestrichene Mauern hinter Bäumen erkennen, die ich dem Schloss zugehörig vermutete. Zumal ich von keinem anderen Adelssitz in der Gegend wusste. Durch mein Kutschfenster beobachtete ich, dass der jugendliche tumbe Bursche eiligst vom Bock gesprungen war und querfeldein über die Felder in Richtung des Schlosses davonlief. Bestimmt sollte so mein Eintreffen gemeldet werden.
Bald darauf fuhren wir durch eine lange Allee an der Seite des Besitzes entlang. Zu meiner Linken konnte ich einen aufwändig gestalteten Park liegen sehen, darin einige mythologische Skulpturen, meandernde Kieswege und mit Hingabe gepflegte Buchsbäume und Blumenbeete, die allesamt in geometrischen Formen angelegt waren. Ein Park also, wie man ihn häufig bei kleinen Landpotentaten sieht, die ihn wiederum von den Landesfürsten abgeschaut haben, welche nun ihrerseits die Gärten der Könige als Beispiel genommen. Letztere aber waren überwältigt von der Pracht und Macht und also auch der Schlösser und Parks des französischen Königs, dem sie nun alle nacheifern. Ewig gleiches, eitles Spiel der Narren.
Die Kutsche umrundete das Anwesen und rumpelte schließlich durch das hohe schmiedeeiserne Tor des Schlosses, dass mir in einem kurzen Moment der Irritation wie die geöffneten Klauen eines mythologischen Wesens vorkam. Vielleicht lag das an der Manieriertheit der Fertigung, denn das Eisen war seltsam verdreht und mit unzähligen Verzierungen versehen. Jedenfalls erkannte ich im Vorbeifahren, dass wohl ein wuchernder Wald als Inspirationsquelle gedient hatte, und es schien mir, dass die kenntnisreich gefertigten eisernen Wurzeln und Äste nach mir greifen wollten.
Zum Schloss gelangt man, wenn man nach dem Tor eine kurze Allee aus Eichen durchquert, zwei Steinbrücken überquert und noch ein kleineres Holztor durchfahren hat. Deutlich hörte ich auch den Kies unter den Rädern knirschen, als wir auf den Cour d'honneur, den dreiseitig umschlossenen Innenhof fuhren.
Das Schloss, das ich auf vielleicht zweihundert Jahre schätzte, war nicht sonderlich groß, zweiflügelig, mit zwei Wohngeschossen, einfach in seiner Architektur und ohne überflüssigen Zierrat oder schwülstigen Pomp. Etwas nach vorn versetzt standen zwei in der gleichen Art erbaute runde Häuser, die wohl als Wohnstätten der Bediensteten dienten und wie steinerne Wächter die Zufahrt zum Innenhof bewachten. Die Kutsche beschrieb einen Halbkreis, und ich entdeckte ein rundes Beet voller roter und gelber Blumen, in dessen Mitte eine bunt in blau, rot, grün und gold bemalte Statue Mariens stand; ihr Haupt in Trauer geneigt, auf dem Arm in quietschrosa ein wahres Schweinchen von einem Jesuskind. Fast hätte mir der Anblick dieser Kunstsünde den positiven Eindruck des ganzen Hauses getrübt, so sehr war ich erschrocken über diesen jähen Ausbruch christlicher Frömmigkeit und schlechten Geschmacks.
Jetzt in meiner Kammer, mache ich mir Gedanken ob dieses Gegensatzes. Zuerst ein in seiner Verdrehtheit und organischen Anmut schon schrulliges Klauentor, das aber nicht ohne Fantasie gefertigt war; dann das fast schon bescheidene Schloss, in architektonischer Schlichtheit errichtet, und schließlich diese schreckliche, bunt bemalte Madonnenstatue. Fast kommt es mir so vor, als hätten zwei Gestalter unterschiedlicher künstlerischer Anschauung hier eine Art petit Guerre del Art ausgetragen.
Aber zurück zu meiner Ankunft. Die Kutsche hielt und ich entstieg ihr mit steifen Gliedern. Meine Knochen schienen, einige jedenfalls, nicht mehr an ihrem angestammten Orte zu sein, sondern die Zeit der Reise genutzt zu haben, um auf Erkundungstour durch meinen Körper zu gehen. Ich konnte nicht anders, als mich zu strecken, um ihnen so zu befehlen, ihre ursprüngliche Position wieder einzunehmen. Ich schaute mich dabei um und da war auch der junge tumbe Bursche wieder, der nun mit der Hilfe des Kutschers mein Gepäck vom Wagen wuchtete.
Ich vernahm leises Kichern und wandte mich der Quelle zu. Auf einer breiten Freitreppe standen zuoberst eine Frau mit zwei Kindern, Jungen, so weit ich es sehen konnte und wohl meine zukünftigen Zöglinge. Die Frau hinter ihnen trug ein schwarzes Kleid und eine dunkelblaue Haube. Ihre Hände steckten in dunklen Handschuhen, deren jeweils eine auf den Schultern der Jungen ruhte. Ich nahm ertappt Haltung an und verbeugte mich. Die Frau zwackte den beiden Jungen schnell in die Hälse und das Kichern erstarb.
„Herr Thomasius, nehme ich an?“
„Ja. Zu ihren Diensten, Gräfin von C.?“
„Ich heiße Sie willkommen, mein Herr. Mein Name ist Apollonia von C. Und dies sind meine Söhne Wilhelm und Alexander.“
Ich muss zugeben, dass es eine wunderbar melodische und seltsam tiefe Stimme war, die der Gräfin eigen war und mich neugierig machte. Verband ich sie doch mit ruhiger Intelligenz und natürlicher Würde, Eigenschaften also, die in unseren eitlen Tagen selten geworden sind und die ich sicherlich nicht hier in einer Provinz Westfalens erwartet hätte. Zudem sprach sie mit einem, ohne Zweifel, italienischen Akzent.
„Gebt dem Herrn Thomasius. die Hand, Kinder!“
Die Kinder traten einzeln vor, knicksten, nannten ihre Namen und stellten sich wieder neben ihre Mutter. Eine kurze Stille trat ein, in der wir uns alle eindringlich musterten und ich überlegte, ob es an mir wäre, die Konversation zu beginnen. Aber die Gräfin kam mir zuvor, fragte nach der Reise, nach meinem Gepäck und ob ich vielleicht nach den Strapazen ein warmes Getränk zu mir nehmen wolle. Als ich verneinte, schickte sie die Jungen fort, gab dem Kutscher Anweisungen, meine Koffer ins Schloss zu bringen, und forderte mich auf, ihr zu folgen.
Sie führte mich durch die Räumlichkeiten, die, ohne mich in einer detailreichen Schilderung zu ergehen, in einem recht erbärmlichen Zustand waren. Feuchtigkeit schien ein nicht zu übersehendes Problem zu sein, das auch die Gräfin beklagte. Vor allem im westlichen Flügel, betonte sie, wäre noch einiges zu tun, da dieser nie vernünftig fertiggestellt worden sei, und daher auch unbewohnt wäre. Daher müssten die Türen stets abgeschlossen sein, denn es sei dort nicht sicher. Der Eindruck des Verfalls änderte sich im Ostfügel etwas, denn dieser wurde von der Familie bewohnt. Im Erdgeschoss befand sich ein Kaminzimmer, ein Billardzimmer, eine Bibliothek mit einer recht ansehnlichen Büchersammlung, ein Musikraum, ausgestattet mit einem Cembalo und ein großes Esszimmer mit einer langen Tafel. An den Wänden hingen einige dunkle Gemälde längst vergessener Vorfahren und oft auch verstaubte Tapisserien mit den üblichen Szenen adligen Geltungsbedürfnisses. Über mir entdeckte ich Fresken, die Allegorien der Musen, der Jagd oder der Tugenden darstellten, in ihrer Machart aber nicht übermäßig kunstvoll ausgeführt waren. Die Wände waren entweder ebenfalls bemalt oder in den Wohnräumen vertäfelt.
Im ersten Stockwerk durchschritten wir einen Flur, an dem die einzelnen Wohnräume der gräflichen Familie lagen. Am südlichen Ende, zum Hof hinaus betraten wir schließlich einen hell erleuchteten Raum, der als Studierzimmer fungierte und in dem ich wohl die meiste Zeit des Tages verbringen würde. Aber wie gesagt, er war hell und lag nach Süden, was mir half, den Eindruck des dunklen, muffigen Schlosses etwas zu vergessen. Mit einem unhörbaren Seufzer blickte ich mich um, ließ meine Finger über die Pulte gleiten und schaute mit wachsendem Interesse die zur wissenschaftlichen Unterrichtung angeschafften Utensilien an. Ein kunstvoll gerfertigter Globus, zahlreiche aufgerollte Landkarten, Lineale mit verschiedenen Längeneinteilungen. Ein Pendel, ein Jakobsstab, sogar ein recht neues Fernrohr, einige ausgestopfte Tiere und Schaukästen, gefüllt mit Insekten. Dazu eine Tafel, drei Pulte, Bücherregale, gefüllt mit den bunten Einbänden verschiedenster Bücher. Ohne Übertreibung musste ich mir eingestehen, das ich in vielen wohl begüterten Familien Berlins nicht solch' eine mit Bedacht ausgestattete Lehrstube vorgefunden hatte.
„Vorzüglich, Gräfin. Ganz vorzüglich eingerichtet. Ich merke, die Bildung Eurer Söhne liegt Euch wirklich am Herzen. Vor allem die naturphilosophische.“
„Dieses Lob kann ich nicht annehmen. Mein geliebter verstorbener Mann war sehr an der Natur interessiert und viele Dinge, die sie hier sehen, gehörten ihm.“ Sie rauschte mit ihrem schwarzen Kleid an mir vorbei, wie ein dunkle Wolke und trat an das Fenster, drehte sich halb von mir fort, und schaute sinnend auf den Innenhof während sie sprach. Dabei rieb sie unaufhörlich ihre rechte Hand, die, wie mir schien, leicht gerötet war. „Aber das ist es nicht, was ich will. Meine Söhne sollen auf eine Laufbahn bei Hof oder beim Militär vorbereitet werden. Sie sehen es ja an der Verfassung des Schlosses, wohin die Beschäftigung mit der Naturphilosophie führt.“
„Darf ich fragen, wie ihr Mann zu Tode kam?“
Sie holte tief Luft, fast klang es wie der Blasebalg in einer Schmiede, bevor die Luft das Feuer zum Glühen brachte, faltete die Hände und drehte sich zu mir. „Nach einer Reise kam er krank hierher zurück. Zu krank, als das man ihn heilen konnte. Er starb an einem ihn langsam verschlingenden Fieber. Das war im letzten Frühling. Bis dahin unterrichtete er unsere Kinder.“
„Das tut mir leid, Gräfin!“
„Es war sein Schicksal. Er hat es gesucht! Und es hat ihn gefunden.“
So wie sie das sagte, klang es hart und herzlos. Hatte sie ihm sein Ende gegönnt? Oder war es nur der Schutz einer beinah zerschundenen Seele, die mit einem Trick sich zu schützen versuchte und sich vormachte, ihren Mann nie wirklich verstanden zu haben? Den Tod eines geliebten Menschen zu überwinden, führt manche Menschen zu überaus findigen Versuchen des Selbstbetruges.
Sie trat auf mich zu. Ihre schwarzen Pupillen blickten mich klug und forschend an. Oder war es drohend? „Ich will nicht, dass das dunkle Schicksal meines Ehegatten auch noch meine Söhne findet. Entfachen Sie keine unnötige Neugier in ihnen. Sie werden mir dabei helfen, ihnen unnützes Wissen vorzuenthalten. Lehren Sie sie, was sie brauchen, um in der Welt, der wirklichen, zu bestehen. Alexander und Wilhelm sind zweifellos begabt und meine Hoffnung, dieses Schloss und alles hier zu bewahren, liegt in Ihnen. Wenn Sie das tun, mein Herr, werden wir gut miteinander ausgkommen.“
Das erste Mal erkannte ich hinter dem schmalen etwas knochigen Gesicht der Gräfin die Erinnerung an eine schöne Frau. Sie war nicht immer so gewesen und die Härte mochte ihre Züge befallen haben, wie ein plötzlicher Frost den Winter anzeigt, um dann nicht eher zu weichen, bevor er nicht seine maßlose Not verbreitet hat. Sie tat mir leid und ich konnte mir vorstellen, dass die Geschichte des Todes ihres Mannes nur ein Partikel ihrer Gram gewesen war. Der kleine Teil einer Aschewolke voller Leid.
„Und noch etwas, Herr Thomasius! Beschränken Sie ihre Besuche im Dorf auf das Nötigste, wobei mir im Augenblick nicht einfallen will, was das Nötigste überhaupt sein könnte. Es sind allesamt Bauern ohne einen Funken Geist oder Verstand. Kinder, die geführt werden müssen! Allesamt!“
„Ich werde es versuchen“, antwortete ich, „allerdings nehme ich an, dass Sie die Messe in der Kirche trotz der Dummheit der Menschen besuchen?“
„Die Messe. Ja, natürlich. Ich hoffe, Sie werden mich und die Kinder begleiten?“
„Ich bin reformiert.“
Einen Augenblick schaute sie dermaßen erschrocken, als hätte sie den Leibhaftigen persönlich gesehen, dann fing sie sich wieder und mit einer wedelnden Armbewegung schien sie die bösen Geister der Reformation nachträglich verscheuchen zu wollen. „Nun ja. In Berlin sind es ja viele. So sei es! Sie werden sicherlich einen Ort für ihre … Rituale finden.“
Schließlich zeigte sie mir mein Kammer, die, eine schmale Stiege hinauf, am Ende eines langen Ganges unter dem Dach lag. Kammer ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, denn sie war recht geräumig und voller Licht. Ein Bett, Tisch und Stühle, ein schwerer alter Eichenschrank, einige Bücherregale, in denen ich Standardlehrwerke erblickte und eine wurmstichige Truhe. Alles in allem nichts besonderes und bescheiden, aber für mich mehr als genug. Ich bedankte mich und die Gräfin forderte mich auf, meine Wünsche zu äußern, falls noch etwas benötigt würde.
Als sie gegangen war, schaute ich mich nochmals um, öffnete das Fenster, nahm einige der Bücher aus dem Regal und schlug sie auf. Sie waren alt und abgegriffen, und auf den inneren Bucheinbänden fanden sich jeweils die Initialen T. v. G. Wohl ein vorheriger Besitzer. Ach ja, das Wichtigste ist ein großer, schwarzer, überaus bequemer Sessel, in dem ich gerade sitze und diese Zeilen schreibe, und den ich augenblicklich in mein Herz geschlossen habe. Vieles gibt es von diesem Tag auch nicht mehr zu berichten. Heute Abend werde ich mit der Gräfin und ihren Söhnen zu Abend essen. Ich hoffe, dass ich dann daran denke zu fragen, wann und wie hier Briefe zur nächsten Poststation gebracht werden. Sollen sie dich doch recht schnell erreichen.
Dein Thomasius.