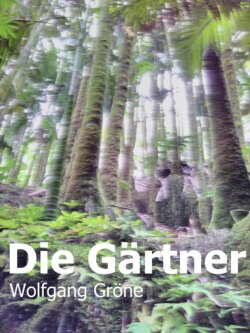Читать книгу Die Gärtner - Wolfgang Gröne - Страница 6
3. Brief, November 1710
ОглавлениеMein lieber S.
Hatte ich mir doch vorgenommen, dir jeden Abend von meinen Erlebnissen in meiner neuen Stellung zu berichten, um dich ein wenig vom täglichen Einerlei abzulenken und dir abends ein wenig Einsicht in das provinzielle Leben zu geben. Jetzt erkenne ich, dass dies nicht möglich ist. Die Zeit hier vergeht mit verblüffender Leichtigkeit, und an den Abenden bin ich oftmals zu müde und setze mich nicht mehr an meinen Schreibtisch, sondern gehe erschöpft zu Bett. Also entschuldige, wenn ich des öfteren passen muss. Wo also war ich stehen geblieben? Ach ja. Das Abendmahl am Tage meiner Ankunft.
Man merkte, dass die Gräfin mir von Anfang zeigen wollte, dass wir uns zwar auf dem Lande befanden, weit entfernt von jeglichem höfischen Leben, aber dennoch nicht abgeschnitten von den Genüssen verfeinerter Lebensfreuden. Das Essen, ein gefüllter Kapaun, wurde im Esszimmer des rechten Flügels an einer langen, mit Blumengestecken geschmackvoll verzierten Tafel eingenommen. Alles war mit sauber brennenden Kerzen erhellt. Zahlreiche Spiegel verstärkten noch das Licht und im Kamin prasselte ein nach Tanne duftendes Feuer. An der Tafel selbst saßen bereits die Gräfin, rechts und links von ihr ihre Söhne. Gegenüber hockte ein älterer, riesenhafter Herr in einem mit lächerlichen Applikationen überreichen Rock, einem Heringsfass von Bauch und einem etwas zu kleinen roten Kopf, der von den rotblonden Wollwellen einer Allongeperücke umrahmt wurde. Links neben ihm, eine in ihrer schlichten Nebelhaftigkeit kaum zu erkennende klapprige Alte, die, wie ich annahm, sein Weib war. Rechts ein pickeliger Junge von vielleicht siebzehn Jahren, der immer wieder stutzerhaft an einem parfümierten Taschentuch roch und über den es nichts weiter zu sagen gibt. Wie sich im Verlaufe einer zähen Konversation herausstellte, handelte es sich bei dieser Familie um einen Freiherrn, der ganz in der Nähe wohnte, die Gräfin mit Jagdwild versorgte und sich selbst wohl als ihr galanter Beschützer sah.
Wie gesagt, mein lieber S., wir führten eine ermüdende Unterhaltung, in deren Verlauf sich die Gräfin als recht untalentierte Gesprächspartnerin entpuppte. Nachdem ich mit verschiedenen Allerweltsthemen versucht hatte, die Konversation anzuschieben und damit jäh gescheitert war, überließ ich dem urzeitlichen Freiherrn das Feld. Das hätte ich besser nicht getan, denn es folgten unendliche Jagdgeschichten, bei der eine Göttin Diana ob ihrer Blutrünstigkeit zurückgeschreckt wäre, währenddessen der Sohn des dicken Freiherrn ab und zu seine glucksende Zustimmung rülpste. Die dürre Freiherrin hatte ich schon komplett vergessen, obwohl sie noch bei Tische saß. Es gibt Menschen, die sich in Gesellschaft tatsächlich in Luft aufzulösen scheinen, so unscheinbar und still sind sie, und diese Dame gehörte zweifellos dazu. Fast tat mir die Gräfin leid, dass sie mit diesen rustikalen Langeweilern ihre gesellschaftliche Zeit verplempern musste und hoffte inständig, dass wenigstens ein interessanter Mensch hier ab und zu auftauchte und heute nur verhindert war. Im Verlauf des Jagdmonologs nickten die Söhne der Gräfin hin und wieder ein, was ich überaus sympathisch fand. Ein dezenter Ellbogenstoß ihrer Mutter aber brachte sie schnell wieder in die Realität des Abends zurück. Die Ärmsten.
Irgendwann war es vorbei. Man verabschiedete sich, betonte, alsbald wieder zusammenzukommen und ging seiner Wege. Ich bedankte mich und mit einer Verbeugung verschwand ich direkt ins Bett, denn ich war hundemüde.
Der folgende Tag war ein Sonntag und ich erwachte durch laute Geräusche auf dem Hof. Ich trat ans Fenster und sah, wie die Gräfin gerade ihre Söhne in eine Kutsche drängte, selbst einstieg und fortfuhr. Wahrscheinlich ging es in die Kirche, die im Dorf auf einer Anhöhe lag. Mich hatte man schlafen lassen, zweifellos weil man nicht wusste, was ein Reformierter an einem Sonntag so tat und es auch nicht wissen wollte. Tatsächlich hatte ich tief und traumlos geschlafen und da der Unterricht erst am nächsten Tag beginnen sollte, überlegte ich, ob ich mich wieder ins Bett legen sollte. Aber was würde die Gräfin vom Hauslehrer ihrer Kinder denken, wenn dieser nach ihrer Rückkehr vom Kirchgang noch immer im Bett lag. Zudem war ich ausgeschlafen und unternehmungslustig. So unternahm ich es, das Schloss, die Gärten und das umliegende Gelände zu erkunden. Immerhin würde ich hier das ganze folgende Jahr verbringen.
Das erste, was ich bei meinem morgendlichen Spaziergang entdeckte, war eine recht imposante, neu gebaute Orangerie auf der östlichen Seite des Schlosses. Ich muss zugeben, dass ich solch' ein Pflanzhaus hier nicht erwartet hatte. Bedurfte der Betrieb doch zumindest eines erfahrenen wenn nicht sogar gelehrten Gärtners. Aber vielleicht war die Gärtnerei ein Steckenpferd des verstorbenen Grafen gewesen. Ich schaute durch die bodentiefen von innen beschlagenen Fenster, konnte aber außer reichlich Grün und einigen roten Farbtupfen, die sicherlich Blüten waren, nicht viel erkennen. Anscheinend wurde das Gebäude weiter benutzt. Ich nahm mir vor, die Gräfin danach zu fragen.
Anschließend schlenderte ich über den Hof, überquerte die Brücke hinüber zu den Wirtschaftsgebäuden, die westlich von der kleine Allee lagen. Hin und wieder begegneten mir Bedienstete der Gräfin, die mit einer kurzen Verbeugung oder einem Knicks grüßten. Dann stand ich auf dem angegliederten Gutshof, der ein halbes Karree bildete und mit Speichern, Scheunen und Remisen bestanden war. Dazu erkannte ich eine Schmiede, ein Backhaus und eine weitere Unterkunft für das Gesinde. Insgesamt waren wohl aufgrund des Sonntages nur wenige Leute zu sehen, aber schon morgen würde es hier vor emsiger Tätigkeit surren, wie in einem Bienenstock im Frühjahr. Ich schritt langsam voran, denn ich hoffte den Durchgang zum dahinterliegenden Park zu finden. Das entpuppte sich aber schwieriger als erwartet, denn immer wieder stieß ich auf eine übermannshohe Hecke, die den Park umschloss und die zumindest an dieser Stelle keinen Durchgang zu haben schien. Ernüchtert wollte ich mich auf den Rückweg machen, als ich durch die offene Tür eines zweistöckigen Speichers ein überaus seltsames Objekt gewahrte. Ich trat näher und erschrak.
Eine grässliche Fratze grinste mich an. Eine Fratze, die aus einem Holzstamm heraus gearbeitet und etwa beinlang war. Oben hatte man anscheinend Rosshaar als Haar in den Klotz gesteckt, darunter blickten rot bemalte starrende Augen über einem wie zum Fraße aufgerissenem Maul voller schmutzig schauriger Reißzähne. Mein lieber S., du erinnerst dich sicherlich, dass wir einmal eine Ausstellung in Berlin besuchten, in der die Seeleute, die für den König in Afrika Handel trieben, einige fremdartige Artefakte von diesem Kontinent ausgestellt hatten. Und du erinnerst dich sicherlich auch daran, wie befremdlich ihr Anblick gewesen war. Nun, ungefähr die gleichen Gefühle bestürmten mich in diesem Augenblick, denn diese Figur war sicherlich nicht aus unseren Breiten, sondern hierher gebracht worden. Wie ein stummer bösartiger Wächter stand sie am Fuße einer dunklen Stiege, die hinauf in das erste Stockwerk führte und vor einer Tür endete. Neugierig geworden, fragte ich mich, was wohl dort oben auf dem Speicher verborgen war und kletterte die engen Stufen hinauf. Kein Schloss hing an der Türe und kurz scholt' ich mich ob meiner Unverfrorenheit, denn eigentlich hatte ich kein Recht, in fremde Zimmer und Kammern zu schauen. Aber was soll ich dir sagen? Meine Neugier war größer. Als ich die Tür langsam aufschob, hoffte ich inständig, dass ich nicht einer überrascht kreischenden, halbnackten Magd auf einem Nachttopf ansichtig würde.
Gottseidank geschah nichts dergleichen. Vor mir öffnete sich ein von staubigen Sonnenstrahlen erhellter Raum voller, ich kann es nicht anders beschreiben, wunderbarer Dinge. Zuerst Kisten mit Büchern erlesensten Inhalts, allerdings wenig geordnet und wie mir schien, ohne Liebe hinein geworfen. Da schlief Descartes' Discours de la méthode neben Schriften des Horaz; Newton neben Lukrez; das Halkyon klemmte zwischen Büchern über die Kunst des Festungsbaus, und Abhandlungen zur Navigation lehnten an Folianten, welche Botanik zum Thema hatten. Wolff und Pufendorf schlummerten auf den Schriften mittelalterlicher Kanoniker und Kirchenlehrer. Welch Frevel! Sogar ein Foliant des Andreas Vesalius ruhte an einer der Kisten. Kurz gesagt, ein fürchterliches, aber dennoch abenteuerliches Durcheinander. Doch nicht nur Bücher entdeckte ich. An den Wänden waren Regale aufgereiht und darin befanden sich unzählige Gläser, gefüllt mit einer trüben gelblichen Flüssigkeit, die sich bei näherer Betrachtung als eine Legion in Alkohol eingelegter exotischer Tiere und Pflanzen, und nicht minder zahlreicher Exponate mir völlig unbekannter Lebewesen darstellten. Dazu stieß ich mit meinen Füßen an Bilder und Aquarelle, die auf ganz natürliche Art Landschaften, Tiere, Pflanzen und Menschen einer weit entfernten Welt darstellten. Weiter eine Batterie eingerollter Landkarten ferner Länder und Küsten. Auch erkannte ich überall im Raum verteilt primitive Gebrauchsgegenstände fremder Art, deren Funktion mir oft nicht ersichtlich war. Ebenso einige hölzerne Figuren und Statuetten ebensolcher Machart wie jene unten am Eingang zu dieser Kammer.
Ich war wie erschlagen. Ja überwältigt! Nichts hatte ich erwartet außer ermüdender Lehrtätigkeit und nun dies! Ein Universum! Alles, was ich in diesem Raum sah, roch und berührte, atmete die Aura des Fremdartigen, des Unbekannten, den Geruch der Reise und des Abenteuers. Ganz ohne Zweifel war dies alles die Ernte einer langen Expedition. Einer sicherlich sehr erfolgreichen Expedition. Aber warum hatte die gelehrte Welt, zu der ich mich ganz bestimmt zähle, noch nie etwas von diesen Kuriositäten gehört? Warum ist dieses Monstrositätenkabinett nicht den gebildeten Kreisen zugänglich gemacht und von ihnen begutachtet, gezählt und geordnet worden? Warum solch' eine Verschwendung?
Ich weiß nicht, wie lange ich in der Kammer verbracht hatte, als ich vom Eingang her ein leises Rascheln vernahm. Ich drehte mich um und sah für einen kurzen Augenblick eine schlanke Gestalt im Türrahmen, die sich sofort meines Blickes entzog. Ich rollte die Karte, die ich gerade beschaut hatte, zusammen und ging langsam auf die Tür zu.
„Ich habe dich gesehen, mein Kind“, sagte ich, „du kannst dich mir zeigen. Nichts wird dir geschehen!“
Die Gestalt schob sich langsam mit gesenktem Kopf in den Türrahmen. Es war ein Mädchen. Angetan mit einem groben blauen Kleid und weißer Schürze. Fünfzehn, sechzehn Jahre, mochte sie vielleicht alt sein. Sie trug einen langen blonden Zopf unter einem weißen Häubchen, und als ich mit zwei Fingern ihr Kinn anhob, schaute ich in klare blaue Augen, unter denen gerötete Wangen glühten. Die Frage kam mir in den Sinn, wer hier wen ertappt hatte.
Ich fragte sie nach ihrem Namen: „Elisabeth“, antwortete sie schüchtern.
„Elisabeth, du arbeitest hier im Schloss?“
„Ja, mein Herr. Im Stall. Mit meinen Eltern und Brüdern. Wir wohnen hier.“
„Warum bist du nicht in der Kirche?“
„Mein Vater liegt krank zu Bett. Meine Mutter und die Brüder sind in der Kirche. Ich passe auf Vater auf. Aber er schläft jetzt. Da bin ich 'rum gelaufen und hab' gesehen, dass die Tür zur Kammer aufstand. Die steht nie auf. Ist immer abgeschlossen. Da bin ich arg neugierig geworden.“
Wie ich, dachte ich amüsiert. Wir schienen unter der gleichen Krankheit zu leiden. Die Stimme des Mädchens zitterte leicht. Ich kam mir vor wie ein Pfaffe, der die Beichte einer Sünderin abnimmt.
„Wenn diese Tür immer verschlossen ist, wer hat den Schlüssel und warum ist sie jetzt offen?“
„Ich weiß nicht, mein Herr. Sie ist sonst immer zu!“
„Und vor dem bösen Dämon dort unten hast du wohl keine Angst?“ Ich lächelte sie an und sah, wie sich ihre Gesichtszüge entspannten, obwohl ihre Wangen gerötet blieben.
„Nein. Der steht dort Tag ein Tag aus und schaute immerzu böse. Wenn ich vorbei gehe, mache ich selbst ein Gesicht und er tut nichts. Ein Heidendämon kann mir nichts anhaben.“
„Bestimmt nicht. Wie lange ist die Kammer schon verschlossen, Elisabeth?“
„Vor einem Jahr, da standen hier Getreidesäcke. Manchmal auch Fässer Bier und Wein. Dann kam der Herr zurück von seiner Reise. Als er dann gestorben ist, war sie ein paar Tage später verschlossen. Als Meister Frans gefragt hat, wie lange die Kammer jetzt abgesperrt sein sollte, da hat die Gräfin nichts gesagt. Hat sich nur umgedreht und ist gegangen, hat Meister Frans gesagt.“
„Meister Frans?“, fragte ich.
„Der erste Diener der Gräfin. Er fährt auch die Kutsche!“
„Ah“. Ich nickte und blickte zurück in Kammer, übersah den wissenschaftlichen Reichtum, die verpackte Bibliothek und versuchte, das alles mit dem Grafen zusammenzubringen, um mir ein Bild zu machen. Denn zweifellos war dies hier die Sammlung eines wissbegierigen Mannes, welcher er wohl gewesen war. Aber warum hatte die Gräfin all diese wunderbaren Dinge hierher schaffen lassen? Damit ihre Söhne nicht zu neugierig wurden? Also Bitte! Das wäre absurd!
Woher aber stammte vor allem diese große Menge fremdartiger Artefakte und zoologischer Exponate? Soviel Wunderliches konnte er nur auf einer längeren Expedition gesammelt haben. Aber hatte die Gräfin nicht eher nebensächlich davon gesprochen, dass ihr Mann von einer Reise zurückgekommen war? Es hätte sonst eine Reise sein können. Kurz oder lang. Zu Freunden oder zu einem Fest. In Gelddingen oder gesellschaftlicher Pflichten wegen. Den Grund hatte sie nicht erwähnt. Dass es aber eine Expedition bis in die südlichen Zonen unserer Welt gewesen war, hätte ich nicht erwartet. Von einer solchen Forschungsfahrt hätte man sicherlich in der Akademie erfahren. Weiter erinnerte ich mich des verwaisten Westflügels des Schlosses, den zu bewirtschaften, wie die Gräfin gesagt hatte, sich nicht lohne. Mit der Ausstellung dieser Reiseausbeute könnte sie sicherlich eine nicht geringe Menge Geldes verdienen. Stattdessen kerkerte sie diese Kostbarkeiten ein, verbarg sie vor der interessierten Welt. Konnte es sein, dass sie nicht um ihren Wert wusste? Ich befand mich immerhin auf dem Land. Fern jeder Neuerung im Denken, jeder Neugierde; von diesem neugierigen hübschen Mädchen vor mir einmal abgesehen. Mein erster Impuls war, die Gräfin sofort nach ihrer Rückkehr vom Kirchgang auf diese Kammer anzusprechen, aber dann kam mir ihr toter Mann in den Sinn. Vielleicht war ihre Liebe innig gewesen und sie hatte aus Trauer, vielleicht aus Wut, alles hierher bringen lassen. Etwas Zurückhaltung schien mir angebracht. Ich entschied mich, vorläufig nichts zu sagen.
„Elisabeth, wir wollen einen Pakt miteinander schließen. Gib mir deine Hände.“
Zögerlich streckte sie ihre Hände vor, die von Spuren harter Arbeit gezeichnet waren, und ich ergriff sie so, dass sie mit den meinen über Kreuz lagen. Das einfache Volk liebt zeremonielle Dinge. „Du hast mich hier nicht gesehen, ich dich nicht. Das sei besiegelt! Nun du!“ Ich hob unsere Hände im Takt der Silben auf und ab und schaute Elisabeth dabei eindringlich an. Sie erwiderte meinen Blick mit einer halb religiösen Inbrunst und nickte mir verständig zu, während sie den Schwur wiederholte.
Vom Dorfe her hörte ich die Kirchenglocken läuten, blickte noch einmal sehnsüchtig in die Kammer mit ihren Kostbarkeiten und hoffte, sie möge öfters offen stehen. Kurz überlegte ich, ob ich mir eines der Bücher ausleihen sollte, aber ich seufzte stattdessen nur.
„Eines noch Elisabeth.“ Sie nickte und schaute mich fragend an. „Wie werden hier im Schloss die Briefe verschickt?“
Sie blickte mich mit ihren großen blauen Augen an und zuckte mit den Schultern.
„Ich kann gar nicht schreiben!“
Am folgenden Tag begann ich meinen Dienst als Hauslehrer. Ich muss zugeben, ich war über den Verstand und die Aufgewecktheit der beiden Jungen mehr als überrascht. Sie stellten scharfsinnige Fragen und setzten mich mit gescheiten Diskussionen immer wieder in Erstaunen. Der Ältere, Wilhelm, erstaunte mich mit seiner Begabung für Sprachen, von denen er bereits das Französische und Italienische mehr als überzeugend beherrschte. Das nahezu perfekte Italienisch war natürlich ihrer Mutter geschuldet, denn des öfteren sprachen beide Jungen mit ihr in ihrer Muttersprache. Auch waren bei Wilhelm recht passable Kenntnisse des Lateinischen und Altgriechischen vorhanden und die Lektüre altsprachlicher Texte hatte ihn bereits mit den Grundfragen der Philosophie bekannt gemacht, und seine Neugier in dieser Hinsicht schien durchaus angemessen.
Der Jüngere, Alexander, schien mir nicht ganz so begabt wie sein Bruder, aber nichtsdestoweniger mit einer schneller Auffassungsgabe gesegnet und an allen Dingen der belebten Natur interessiert. So sprach auch er schon fließend italienisch und, wie ich später feststellte, besser Latein als sein Bruder. Das lag wohl vor allem daran, dass er mit großer Leidenschaft Bücher über Botanik, Geografie und die Tierwelt las, nein verschlang. Mit allem, was ich zuvor in der Kammer gesehen, hatte ich mir ein Bild des Vaters gemacht, der diesen beiden Kindern die Welt erklärt hatte: Er musste ein wahrhaft an der Erkenntnis interessierter Mann gewesen sein, der auch seine Söhne bis zu seinem Tod vorzüglich unterrichtete. Fast fühlte ich so etwas wie Bedauern über seinen Verlust, obwohl ich ihn gar nicht gekannt hatte. Wie müssen erst die Jungen ihm nachgetrauert haben?
Dennoch blieben sie mir gegenüber seltsam distanziert. Obwohl ich so manches Mal hitzige Gespräche mit ihnen führte, schienen sie in mir nur einen gelehrten Dienstboten zu sehen, dem jede Vertraulichkeit vorzuenthalten war. War dies von der Mutter gewollt? Hatte sie ihre Söhne aufgefordert, nicht zu vertraulich mit ihrem Lehrer zu sein? Wir lernten, erkundeten, diskutierten in den folgenden Wochen, aber ich schaffte es nicht, ihre Herzen zu erreichen, die Mauer ihrer Unnahbarkeit zu durchbrechen und bis auf ein flüchtiges Lächeln und einige Formulierungen, die einen seltenen Blick auf ihre Seelenwelten zuließen, waren Wilhelm und Alexander immer beherrscht und unnahbar. Hin und wieder hörte ich sie miteinander auf italienisch tuscheln, wenn sie sich allein glaubten, und dann kamen sie mir vor wie zwei Verschwörer, die etwas Hinterhältiges planten. Trat ich hinzu, verstummte ihr vertrautes Gespräch und sie waren wieder ganz und gar konzentriert auf den Unterricht. Fürwahr irritierend. Auch kam es des öfteren vor, dass sich ihre Mutter in einen Winkel des Raumes setzte und dem Unterricht lauschte. Sie sagte zwar nichts, stickte währenddessen, aber ich wusste, dass sie mich genau beobachtete, denn ab und zu trafen sich unsere Blicke und ihre schwarzen Augen funkelten mich beunruhigend durchdringend an. So als wolle sie einen kurzen Blick auf meine Gedanken werfen.
Aber genug von meinen Eindrücken hinsichtlich der Kinder, denn du fragst dich sicherlich, was es nun mit der Orangerie und der Wunderkammer auf sich hat? Nun, in einem passenden Augenblick fragte ich Alexander, der ja recht vernarrt in die Botanik ist, was er über das Pflanzhaus weiß. Er antwortete ausweichend: Sein Vater habe den Bau kurz vor seiner Geburt errichtet, um darin ergiebigere Pflanzen für den Feldanbau zu züchten, aber durch seinen Fortgang sei es gänzlich verwildert. Seine Mutter erlaube ihm daher nicht, dort nach dem rechten zu schauen und es wieder zu nutzen. Er sagte dies alles recht stoisch, fast geschäftsmäßig, aber ich konnte an einer Stirnfalte, die zusehends tiefer und länger wurde, erkennen, dass es ihn doch bedrückte und er mit der Entscheidung seiner Mutter haderte. Auf meine Frage, ob ich seine Mutter nach einer Erlaubnis fragen solle, heiterten sich die Gesichtszüge auf und er war einverstanden.
Beim Abendessen, das wir immer gemeinsam einnahmen, sprach ich das Thema an. Die Gräfin aber erteilte mir, ja ich kann es nicht anders nennen, eine Rüge. Die Kinder sollten vor allem auf ein Studium der Theologie oder Jurisprudenz vorbereitet werden, da spiele die Botanik wohl eine untergeordnete Rolle. Auf meine Entgegnung, alles Wissen fördere den Verstand und ich sähe die Beschäftigung mit den Erscheinungen der Natur als zukunftsweisend, schnaufte sie nur kurz, warf ihre Serviette auf den Tisch und schnaubte: „Ich dulde es aber nicht, dass jemand die Orangerie betritt. Es ist nur Ablenkung. Und damit genug! Wir wollen zu Bett gehen.“
Du kannst Dir denken, dass ich nach dieser Abfuhr nicht mehr die geringste Hoffnung verspürte, das Thema auch noch auf die Speicherkammer zu bringen. Die Gräfin schien nach dem Tod ihres Mannes eine tiefe Aversion gegen jegliche Form der Naturphilosophie zu hegen. Wohl gab sie ihr die Schuld am Tode ihres Mannes. Welch' weite Reise hatte er gemacht, von der er schwerkrank zurückgekommen war, und was war es schließlich gewesen, das ihn getötet hatte? Alle weichen mir aus und schürzen Geschäftigkeit vor, wenn ich frage. Ich muss mehr über das Schicksal des Grafen herausfinden, denn je mehr ich über ihn erfahre, desto stärker empfinde ich ihn als einen Bruder im Geiste, dessen Schicksal auch meines sein könnte. Fast kommt es mir so vor, als sei ich aus einem ganz bestimmten Grunde hier: Sein Geheimnis zu ergründen.
Nun bin ich müde und sehe, dass mein Brief doch recht lang geworden ist. Also beende ich ihn an dieser Stelle. Ach ja, gleich erwarte ich noch ein Ereignis, dass ich hier vom Fenster meiner Dachkammer jeden Abend beobachten kann und über das ich mir noch immer nicht im klaren bin, was es bedeutet. Doch davon im nächsten Brief.
Dein Thomasius