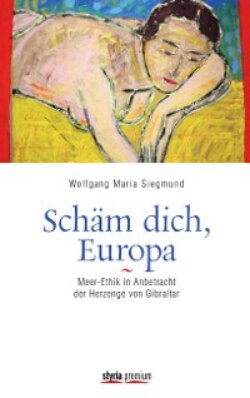Читать книгу Schäm dich, Europa! - Wolfgang Maria Siegmund - Страница 12
2.I Zu Monsieur Emmanuel Lévinas oder Die Unendlichkeit ist mitten unter uns
ОглавлениеAbb. 4
Müsste man das philosophische Werk von Emmanuel Lévinas mit wenigen Worten beschreiben, könnte ein Satz von Robert Musil hilfreich sein: „Die Reise an den Rand der Möglichkeit.“ Monsieur Lévinas würde in sanfter Rabbimanier dazu nicken und dabei eine kleine Korrektur vornehmen, die sein Werk so wundervoll schwer in seiner Leichtigkeit macht. Er würde sagen: „Reise an den Rand der Möglichkeit, ja, und danach wage die Reise darüber hinaus …“ Er hätte damit in keinster Weise übertrieben, im Gegenteil. Lévinas versteht sich in der Kunst, dem Bodenschweren, dem niemals Verrückbaren, dem Steindenken deutscher Gigantenschaft jene Spannbreite an Flügel zu verleihen, damit das Blei im Denken fliegt, damit es flirrt und lodert. Dieser Mann, ein moralischer Nietzsche aus Frankreich, der 1906 in Litauen geboren wurde und als erster Husserl ins Französische übersetzte, wird ein Zertrümmerer der sanftesten Art. Er wird ein zweiter Ikarus, der sich aus Klugheit der Sonne nicht nur nähert, nein, der mit ihr fliegt, auf ihr, in ihr. Nur einmal wird er stürzen, 1942 – 45 gerät er in die Gefangenschaft der Nazis. Dieses Deutschland wird er danach nie mehr betreten, dieses Deutschland, das die Seinen zu Tode gebracht hat. „Denn der Tod“, wie er einmal sagen wird, „der Tod des anderen ist dein erster Tod.“
Diese jüdische Kollektiv-Wunde, in keinem Exil des Exils sein zu dürfen, diesen Hiat wird er mit dem weißen Laken der Philosophie notdürftig verbinden, tagaus, tagein. Für ihn, für uns, für das Andere. Nie wird man ihn dabei klagen hören, nur der stampfende Rhythmus des Dagegenhaltens strömt auch noch aus dem neunzigjährigen Körper seiner Schrift. Die Unmöglichkeit denken, mit dem Denken darüber hinaus. Der Inhalt einer Vase kann größer als deren Umfang sein. Das sind die Werkzeuge seiner Zauberschaft.
Ich schlage sein Werk auf, Totalität und Unendlichkeit, und mit diesem Aufklappen nehme ich ungewollt den vordersten Platz an der Reeling ein. Hier beginnt die Meeresfahrt mitten hinein in das dichteste Staunen. Allein für diesen Eröffnungssatz hätte es sich gelohnt, das Lesen zu erlernen. Ein wundervoll zerrissener Satz, vollkommen in seiner komplizierten Einfachheit, wird uns, die Leser, hier erwarten. „DAS WAHRE LEBEN IST ABWESEND, ABER WIR SIND AUF DER WELT.“3
Doch dann nach einer Weile spüre ich den Hinterhalt und wie diese Wörter hart in meinen Nacken schlagen. Immerzu. Allein, die Umkehr dieser Aussage, dass ich die Anwesenheit eines falschen Lebens wäre, raubt mir für eine Weile den Atem, verweigert mir den Ausstieg. Wo will Monsieur Lévinas mit uns hin, ins wahre Leben, aber dort sind wir dann ja nicht mehr. Will er zu jenem Meridian, wo noch keiner war, in die fremdeste Fremde? Aber wer führt uns von dort wieder sicher zurück? Vor mir stößt sich das Meer immer weiter in den Himmel hinein und wird mit der Zeit zum anderen Blau.
Mit jeder Stunde dieser Fahrt gerate ich tiefer hinein in diesen Sog einer „Taghellen Mystik“. Vertrautes schleicht sich davon und kehrt als Frage wieder. Ermattung, ich schlafe ein. Mein Ich liegt immer bei mir. Dieses immer Bei-mir-Sein bezeichnet Lévinas als die „Totalität des Seins“. Ich ist für ihn nur ein vom Tod begrenztes Kreisen, das sich nur dann und wann aus den eigenen Ketten sprengt. Gibt es denn keine Flucht aus den Umrissen der eigenen Haut, frage ich mich. Gibt es denn keine Architektur des Seins, die mich abreißt, neu gestaltet? Monsieur Lévinas, könnte ich an dieser Stelle schreien, greifen Sie ein, tun Sie doch was! In Die Zeit und der Andere lese ich seine Meinung dazu:
„Man kann zwischen Seienden alles austauschen, nur nicht das Existieren. In diesem Sinn heißt Sein, sich durch das Existieren isolieren. Insofern ich bin, bin ich Monade (…), bin ich ohne Tür und ohne Fenster.“4
Ich ist also ein Ding, dem ich lebend nie entweichen werde. Eine große, schrecklich schöne Einsamkeit. Ich ist der Nachname meiner ewigen Gefangenschaft in mir. Ich frage mich, ich frage den Mann hinter der Schrift, ob nicht Sokrates, dieser allwissende Nichtwisser, eine Lösung hätte. Über meinen Vorschlag kann Monsieur Lévinas nur lachen, er flüstert mir zwischen den Buchstaben zu: „Bei Sokrates beginnt ja das Problem, es ist diese Stelle im Dialog Alkibiades. Dort fängt das Dilemma an.“
Und ich blättere zurück, und das Schiff nimmt Kurs auf Athen. Mit jeder Seemeile nähern wir uns dem Marktgeschrei der Händler. Ich sehe, wie sich auf dem Rücken der Frauen und Sklaven Kisten stapeln, die sich schaukelnd durch die Agora bewegen. Auch wenn die Träger ein juristisches Nichts bedeuten, ihre Last bewegt sich doch. Vorbei an diesem abendländischen Zug der Ungerechtigkeit, der sich in mich einritzt wie der Geruch von Safran, Pfeffer, wildem Majoran. Zwischen hängenden Gänsen und Fischen, die in Salzlaugen liegen, wage ich mich näher an zwei Männer heran, die ganz erhaben durch die Menge schreiten. Der eine schön und eitel, der andere von einer Klugheit, die sich nur selten wäscht. Ich höre nur Wortfetzen, die Sokrates zu diesem Alkibiades spricht, ich höre nur, dass die Sorge um sich selbst, das epimeleia heautou, das Wichtigste sei. Dann käme lange nichts, dann käme erst der andere. „Finde das Selbst deines Selbst, das auto to auto. So wird alles gut und du, Alkibiades, wirst herrschen.“
Das war soeben die völlig missglückte Geburtsstunde des Ichs“, flüstert Monsieur Lévinas plötzlich im weißen Knitterleinen neben mir und fächelt uns mit seinem Panamahut keuchend zurück ins Heute. „Wie du siehst, sind Ich-Werdung und Herrschen ein kraftstrotzendes Brüderpaar, unter dem wir immerfort zu leiden haben“, fügt er dann noch hinzu. Und über dem heutigen Athen, diesem erblindeten Auge des Philosophen, senkt sich die Zeit, da alle Läden schließen. Nervöses Hupen setzt ein, so von Auto zu Auto. Hinter verdunkelten Scheiben sieht man schwer gepanzerte Gesichter mit ihrer Tötungsabsicht ringen … Aber ich schweife ab …
Die Reise ins Rätsel Lévinas beginnt mit jenem Aufsatz, geschrieben im Jahre 1935. De lévasion. Hier steckt der Grundgedanke, die Wurzel, die sich später zur prächtigen Platane erheben wird. Drei Jahre vor Sartre nennt er darin den Ekel als „die eigentliche Erfahrung des Seins“, oder auch: „Das Übel zu sein“ (male d’ être). Das Sein als Last. Männer wie er spüren, was bald auf Europa zukommen wird: dieser Brandgeruch mitten aus dem Herzen der kantischen Ländereien. Und die Spitze der Windrose weist längst in Richtung Ekel, weist auf Leichengeruch und auf das gestiefelte Näherrücken der Nazis. Gleich wie Sartre denkt er an Ausbruch, aber wie kommt man aus diesem anonymen Sein, aus diesem „Es gibt“, wie Lévinas es nennt? Und er hat einen Plan: Wir Seiende müssen aus dem Sein hinaus und dann noch einmal weiter. Descartes hilft ihm dabei. In seiner dritten Meditation5 spricht er von der Idee des Unendlichen, die ein Mensch zwar nicht zu denken vermag, aber dennoch hätten wir ohne diese Idee keine Vorstellung darüber, wie endlich, wie unvollkommen wir sind.
Aber wo liegt diese Küste, dieses Jenseits des Seins, wie gelangt man dorthin? Ein Ich, das unentwegt das Fremde zum Eigenen macht, diese Aneignungsmaschine ist doch der verfehlteste Reisebegleiter dorthin. Aber mit wem sonst könnten wir reisen, außer mit uns? Und wieder stellt Lévinas eine Frage auf den Kopf. Er fragt nicht: Was ist das Sein? Er fragt sich: Wer ist das Sein? Wer steckt da in dieser Maske? Die deutsche Jemeinigkeit ist ihm zu wenig. Und er fordert, dass die Ontologie der Ethik als erster Philosophie zu weichen habe.
Diese Umkehr der Frage bildet den schmerzvollen Abschied zwischen Lévinas und Heidegger. Für Heidegger, der als Rektor eine Zeit lang das stramme Heil deckt, ist das neutrale Sein der heilige Gral. Nach seiner Lehre, die Lévinas trotz aller Gegensätze als Jahrhundertleistung schätzt, wird uns das Dasein – in dem unser Ich ein Leben lang suizidgefährdet steckt – vom großen, götterhaften Sein geschickt. Dieses Denken birgt für Lévinas keine Lösung. Er spürt zwar den Ekel, aber er hat im Unterschied zum Heideggermenschen keine Angst. In diesem Moment hilft ihm Platon weiter. Im Staat spricht dieser erstmals von einem Guten jenseits des Seins. Die Spur ist gelegt. Das Jenseits des Seins blitzt auf im Antlitz des Anderen. Das Jenseits des Seins liegt dort, wo der Andere ganz anders als ich seit Jahrtausenden wohnt.
Aber was führt mich da hin? Auf keinen Fall das Bedürfnis, meint Lévinas. Das Bedürfnis sei bloß ein Hunger, den man stillt. Unser Reisebegleiter sei das Begehren. Und so heißt es in Totalität und Unendlichkeit:
„Das Begehren ist Begehren des absolut Anderen. Unabhängig vom Hunger, den man sättigt, vom Durst, den man löscht, von den Sinnen, die man befriedigt.“6
Aber damit eröffnet sich ein weiteres Problem. Es muss ein Land sein, in das wir wollen, und das wir doch niemals besuchen werden. Sonst wäre es kein Begehren. Das Begehrte muss unsichtbar bleiben. Das Gelingen des Begehrens liegt in seiner Unerfüllbarkeit. Doch dieses Land, Jenseits des Seins, liegt nach Lévinas nicht jenseits von uns. Aber was heißt das?
Tagtäglich taucht es im Antlitz des Anderen vor uns auf. Doch dieser Andere ist absolut und unentwegt anders als ich. Kein Alter Ego, wie noch bei Husserl, kein Du, wie bei Martin Buber. Ich und der Andere bilden nach Lévinas keine Symmetrie, beide sind nicht reziprok. Und so heißt die Lévinassche Losung: erst der Andere, dann ich. Aber er spricht hier nicht aus Frömmigkeit, und so wären wir beim nächsten Punkt seines paradoxalen Denkens. Unser Ich sei ein entfremdetes Ich, angekettet an sich selber. Und das macht den Schwindel bei der Lektüre von Lévinas aus – diese Entfremdung sei gut, äußerst brauchbar, wie er meint. Erst über die dritte Person, erst über das ER, SIE, ES, über den Anderen, wird unser kleines, unfertiges, ans Gitterbett geschnalltes Ich erwachsen. Autonomie durch Heteronomie. Dazu kommt noch: Dieser Andere verfügt über einen Ruf, den mein unfertiges Ich zu erfüllen hat, und der lautet: Du kannst und wirst mich nicht töten, deine Hand langt nicht in dieses Unsichtbare hinein. Es entzieht sich, wenn du es wagst. Diesen Ruf zu beantworten, mich zu äußern und somit einen Fuß ins Undenkbare zu stellen, bildet meine Verantwortung vor diesem Antlitz. Diese Denkfigur nennt Lévinas den Widerstand der Ethik. Und so schreibt er im besagten ersten Großwerk:
„Dieses Buch stellt die Subjektivität als etwas dar, das den anderen empfängt, es stellt sie als Gastlichkeit dar. In der Gastlichkeit erfüllt sich die Idee des Unendlichen. (…) Subjektivität ist Gastlichkeit“.7
Doch das Mehr-Denken als man denken kann, hört hier noch lange nicht auf. Die Forderung in Form der Lévinasschen Überforderung greift noch weiter: Jeder kann für den anderen ein Messias sein. Muss es sein. Jeder von uns trägt die Verantwortung für die gesamte Welt. Trüge ein jeder von uns das Echo der Weltantwort ein Stück weiter, wäre die Last des Seins um vieles leichter. Doch es gibt eine Frage, die diese Ethik fast zerstört, in sich auflöst, in Unruhe versetzt: Der kürzlich verstorbene Philosoph Paul Ricœur hat sie gestellt: Was ist, wenn der Andere dein Henker ist, was geschieht dann? Seiner Aufforderung zu folgen, hieße freiwillig in den Abgrund zu gehen. Masochismus als Ethik? Auch auf diese Frage hält Lévinas eine Antwort bereit, die aber sein Schüler Derrida erst viel später entblößen wird. In die Paarung von Angesicht zu Angesicht, zwischen mir und dem Andern gesellt sich immer auch die Gestalt des Dritten. Erst diese Figur sorgt für Maß, für Ausgleich, für Gerechtigkeit. Mit seinem Beitritt zur Zweierrunde entsteht erst Gerechtigkeit. Lévinas schreibt:
„Der Dritte ist anders als der nächste. (…) Was also sind sie, der Andere und der Dritte (…) Was haben sie einander getan? Welcher hat Vortritt vor dem anderen? (…) Von selbst findet die Verantwortung nun eine Grenze, entsteht die Frage: Was habe ich gerechterweise zu tun? (…) Es braucht die Gerechtigkeit, das heißt den Vergleich.“8
Derrida, Schüler und großer Verehrer von Lévinas, problematisiert in seinem wunderschönen Nachruf Adieu á Emmanuel Lévinas jene mysteriöse Figur des Dritten. Und er rettet Lévinas, steht ihm bei gegen den Angriff, dieses ethische Konzept sei monströs, habe jedes Augenmaß verloren.
Darin schreibt Derrida über Lévinas:
„Aber was tut er denn, wenn er [Lévinas, d. Verf.] über das Duell oder mit dem Duell eines Von-Angesicht-zu-Angesicht zwischen zwei ‚Einzigen‘ sich an die Gerechtigkeit wendet und immer wieder bekräftigt: ‚es braucht‘ die Gerechtigkeit, es braucht‘ den Dritten? Geht er da nicht auf jene Hypothese ein (…) von einer potenziell entfesselten Gewalt in der Erfahrung des Nächsten und absoluten Einzigkeit? Von der Unmöglichkeit, dabei das Gute vom Bösen, Liebe von Hass, das Geben vom Nehmen, den Lebenswunsch vom Todestrieb, den gastlichen Empfang von der egoistischen oder narzißtischen Abkapselung zu unterscheiden? Der Dritte würde demnach gerade vor dem Taumel ethischer Gewalt schützen.“9
So weit Derrida. Doch wer ist dieser Dritte, soll hier abschließend gefragt werden? Er ist nicht der Nächste des Nächsten, nicht der Andere des Anderen. Und schon gar nicht so wie ich. Er trennt sich mit allen Grenzen von uns ab, mit allen Grenzen, die es nur geben kann. Er ist der Urabdruck des Fremden schlechthin, die absolute Andersheit. Lévinas nennt diese Erscheinung Illeität. Erheit. Doch auch dieses Unsichtbare, dieses Sich-nicht-zeigen-Wollen, dieser Verzicht auf ein eigenes Gesicht, um stattdessen dem gesichtslosen Antlitz ein wirkliches verletzbares Gesicht zu übertragen, ihm zu schenken, auch diese Illeität können wir nicht mit unseren bloßen Augen erblicken, sondern nur mittels der „Optik der Ethik“. All das verspricht uns Lévinas. Und er meint, das mysteriöse Unbekannte zeigte sich uns immer bloß in der Spur. Es ist die vom Wind in den Sand geschriebene Schrift der Wüste oder der rötliche Blattwirbel über deiner Mütze im Herbst. Es ist das Vorbeigehen eines Passanten, der niemals an dir vorübergegangen war. Lévinas schreibt dazu:
„Die Spur ist die Gegenwart dessen, was eigentlich niemals da war, dessen, was immer vergangen ist.“10
„Zu ihm hingehen heißt nicht, dieser Spur, die kein Zeichen ist, folgen, sondern auf die Andern zugehen, die sich in der Spur halten.“11
Den Anderen begegnen, bedeute für uns die Begegnung mit der Unendlichkeit. Das ist das eigentliche Wunder am Denken dieses französischen Meisters, der das Unendliche ohne Aneignung in unser Diesseits holt. Es sei möglich, sagt er, dass unser totales, hybrides Ich, wenn es sich aufgibt und zum Mich wird, also reine Passivität, das Fremde in Gastfreundschaft empfängt. Wenn dieses alte Ich einer neuen Selbstbesinnung in Form einer Selbstbeschränkung weicht, rein aus dem Wissen heraus, dass auch die Ressourcen dieser Erde nicht unendlich sind, sondern ebenfalls begrenzt, wenn es somit diese Reise aus sich heraus wagt, dann sei es möglich, dass dieses Ich letztlich das Wunder des Menschseins erfüllt. Die Lévinassche Formel wird dadurch evident, nämlich den Mord am Anderen mehr zu fürchten als den eigenen Tod. Das wäre wiederum die höchste Form des Ausbruchs aus der ewigen Verlustangst rund ums Eigene. Die Zeit, sagt Lévinas, ist die Geduld des Todes.
Lassen wir den Denkprozess bei Lévinas noch einmal kurz Revue passieren, zusammengestutzt auf sein Gerüst:
Aus dem neutralen Sein ins Seiende mit unserem halbleeren Ich, dann hinaus ins Jenseits des Seins mittels unseres Begehrens, hinein in diese Exteriorität, wo das Antlitz des Anderen mit einem Ruf auf uns wartet, den wir in Absprache mit dem Dritten gerecht zu beantworten haben, und das alles, um einmal nicht als aufgedunsener Ichling im Whirlpool der Verwöhnung zu verdampfen. Wir erreichen dieses Nicht-Land nur, in dem wir uns sprachlich äußern, doch nur menschliche Güte und Liebe sind die Träger jener Worte, die mit uns in dieses Außen gehen. Aber das heißt auch: Das gnothi seauton, das Erkenne dich selbst, dieser Knoten kann nur entwickelt werden, wenn du im gleichen Atemzug den Anderen verstehst.
Abb. 5
Logbucheintragung für eine gewagte Behauptung …
Für den Ethiker der Unendlichkeit, wie ich Lévinas an dieser Stelle bezeichnen möchte, ist unser Ich ein unentwegtes Werk, ein Tätigsein an mir, das niemals seine Abgeschlossenheit erfährt, damit wir in Bewegung bleiben, nicht ermüden in Anbetracht eines statischen Seins. Und so lässt er sein Werk mit dem erwähnten Satz beginnen: „Das wahre Leben ist abwesend, aber wir sind auf der Welt“. Im wahren Leben einmal beheimatet zu sein, hieße demnach, uns radikal anders zu denken. Meine bescheidene Formel hieße demnach: Ich + der Andere = Wir-Andere-Alle. Doch nach dieser Ortsverschiebung wären wir nicht mehr auf der Welt, sondern erstmals mitten in ihr. Ist die Unendlichkeit hier und jetzt? Von meiner winzigen Kabine aus sehe ich unendlich erschrocken nach draußen …