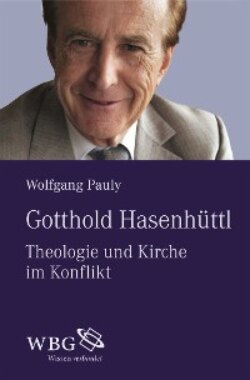Читать книгу Gotthold Hasenhüttl - Wolfgang Pauly - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|7|Einleitung
Оглавление„Dieses Projekt braucht Mitdenkende und Mitdiskutierende; und gemäß seinem dialogischen Wahrheitsverständnis wird auch Hasenhüttl selbst sein Werk nicht als letztes Wort verstehen wollen. Kritiker wie Anhänger sollten ihm also nun die Ehre erweisen, in ein leidenschaftliches Gespräch mit ihm einzutreten.“ (Dankert 2002, S. 111) Diese Ermunterung von Jürgen Dankert zum Dialog mit dem theologischen Neuansatz des Saarbrücker Theologen Gotthold Hasenhüttl soll hier aufgegriffen und in kritischer Solidarität ausgeführt werden.
Hasenhüttl hat sein umfangreiches Werk und seinen theologischen Neuansatz in den beiden Bänden „Glaube ohne Mythos“ (2001) systematisch dargestellt und im Band „Glaube ohne Denkverbote. Für eine humane Religion“ (2012, 2. erweiterte Auflage 2014) auch für theologische Laien verständlich zusammengefasst. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde Hasenhüttl durch seine Einladung an evangelische Christen zur Teilnahme an der katholischen Eucharistiefeier mit Kommunionempfang beim ersten Ökumenischen Kirchentag in Berlin 2003. Diese Einladung entsprang nicht einer spontanen Eingebung, sondern ist Konsequenz seines theologischen Ansatzes.
Zentrum seiner – wie jeder – theologischen Reflexion ist und bleibt die Gottesfrage. Sie soll auch im Zentrum dieser Ausführungen stehen. Da aber von Gott nicht geredet werden kann, ohne über den Menschen nachzudenken, in dessen Handeln und Denken das Wort „Gott“ vorkommt, soll unsere Darstellung mit den Ausführungen Hasenhüttls zur Anthropologie beginnen. Die seit Karl Rahner geforderte „anthropologische Wende“ der Theologie, die allerdings bereits im zentralen christlichen Glaubensbekenntnis von der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus ausgesprochen ist, findet ihren Niederschlag darin, dass die Anthropologie hier vor den anderen Traktaten der Dogmatik behandelt wird. Dadurch wird auch deutlich, dass letztlich jede Theologie eine spezifische Form der Anthropologie ist. Dies entspricht Hasenhüttls grundlegender These, dass Aussagen über Gott Aussagen über den Menschen sind.
Die kritische Rezeption vielfältiger theologischer Deutungsmodelle in Geschichte und Gegenwart ermöglicht es Hasenhüttl, eine eigenständige Position zu entwickeln. Diese kann dann wiederum in den Diskurs über das Wesen des Menschen und über die Funktion der Rede von Gott in der |8|(Post-)Moderne aufgenommen werden. Insbesondere das immer wieder neu zu diskutierende Spannungsverhältnis zwischen dem Individuum, wie es exemplarisch in der Existenzphilosophie und deren theologischer Rezeption durch Rudolf Bultmann betrachtet wird, und der Gesellschaft – exemplarisch beschrieben in der kritischen Rezeption der Schriften von Karl Marx durch Jean-Paul Sartre – bildet für Hasenhüttl einen sein ganzes Werk durchziehenden Fragehorizont. Die existenziale Interpretation der Bibel durch Rudolf Bultmann ist folgerichtig auch das Thema von Hasenhüttls theologischer Promotion in Theologie, der Dialog mit Jean-Paul Sartre steht im Zentrum der philosophischen Promotion.
Gemäß seinem dialogischen Ansatz stellt Hasenhüttl in seiner Habilitation „Charisma. Ordnungsprinzip der Kirche“ (1969) die (Glaubens-)Gemeinschaft als eine dialektische Synthese von Person und Gemeinschaft dar, wie er sie in seinen beiden Promotionen entwickelt hatte. Auf die Breite und Diskursfähigkeit dieses Ansatzes verweisen bereits die unterschiedlichen theologischen Ausrichtungen der beiden Gutachter der Habilitationsschrift: des späteren Leiters der römischen Glaubenskongregation und nachfolgenden Papstes Benedikt XVI., Joseph Ratzinger, und des Tübinger Dogmatikers Hans Küng, dem später von dieser Glaubenskongregation die kirchliche Lehrerlaubnis entzogen werden sollte, wenn auch noch nicht unter dem Vorsitz Ratzingers.
Wie sehr sich die Reflexion über den existenziellen Vollzug des Menschen mit gesellschaftlicher Praxis verbinden kann, zeigt Hasenhüttl mit seinen zahlreichen Forschungsreisen in fast alle Länder dieser Erde und seinem Engagement für die von Gesellschaft, Wirtschaft und Kirche Ausgeschlossenen. Auch darüber gibt er Rechenschaft in zahlreichen Werken, wie zum Beispiel in „Freiheit in Fesseln. Die Chance der Befreiungstheologie“ (1985) und „Schwarz bin ich und schön. Der theologische Aufbruch Schwarzafrikas“ (1991). Dass Hasenhüttl sich an seinem 80. Geburtstag im Jahr 2013 in Bangladesch für die Rechte der Textilarbeiterinnen einsetzt und bei seiner Rückkehr über deren Ausbeutung informiert, zeigt die aus Persönlichkeit und Werk resultierende Verbindung von Praxis und Theorie.
Das Werk Hasenhüttls ist nicht zu verstehen ohne die von ihm über fünfzig Jahre lang als Priester praktizierte Seelsorge. Er segnete nicht nur Menschen, die ihren Lebensweg gemeinsam gehen wollten, und feierte über Jahrzehnte hinweg täglich die Eucharistie, sondern erwies auch zahlreichen |9|Menschen die letzte Ehre. Dabei begleitete er auch diejenigen zu ihrer letzten Ruhestätte, für die kein Priester offiziell zuständig war.
In der Spannung zwischen der Vielfalt postmoderner Sinnangebote einerseits und der bereits vor hundert Jahren von Martin Buber beschriebene „Gottesfinsternis“ andererseits gibt es insbesondere in Westeuropa nicht viele eigenständige und insofern auch diskussionswürdige theologische Neuansätze. Das römische Lehramt, aber auch die Auswahlkriterien bei der Neubesetzung theologischer Lehrstühle sorgen für eine immer stromlinienförmigere Ausrichtung des Faches. Gerade aber die Vielfalt menschlicher Lebensweisen und die Pluralität der entsprechenden Sinnentwürfe in der Gegenwart erfordern einen Dialog mit und eine kritische Reflexion von Aussagen der Theologie und des kirchlichen Lehramtes. So erst könnte das alte Wort „kat-holon“, das „katholische“ Kennzeichen der christlichen Gemeinschaft, das ihre multidimensionale Grundstruktur aufzeigt, eine neue Bedeutung erlangen, die vielleicht noch nie so umfassend war wie gegenwärtig.
Im 6. vorchristlichen Jahrhundert sprach der Philosoph Heraklit davon, dass gerade aus der Polarität und aus der ihr zugrunde liegenden Spannung die schönste Harmonie entstehen kann. (Post-)moderne Lebens- und Weltdeutung stehen in vielfacher Spannung zu tradierten Lebensformen und Glaubensaussagen der christlichen Kirchen. Spannung und Polarität aber müssen existenziell vom Einzelnen und organisatorisch von Institutionen aufgenommen und fruchtbar gestaltet werden. Die Stadtobrigkeit von Ephesus verbannte Heraklit wegen seiner Überzeugung aus der Heimat. Funktionsträger der katholischen Kirche entzogen Gotthold Hasenhüttl die kirchliche Lehrerlaubnis und verboten ihm die Ausübung seiner priesterlichen Berufung. Damals wie heute haben es neue Ideen schwer, sich gegenüber festgefahrenen Lebens- und Deutungssmodellen durchzusetzen. Die Konflikte verstärken sich noch, wenn durch alternative Gedanken die bisherigen Herrschaftsstrukturen und Machtverhältnisse hinterfragt werden.
Neue theologische Konzeptionen sollten aber als Bereicherung und als kreative Erweiterung bisheriger Deutungen eines christlichen Lebensvollzuges verstanden werden. Letztes Kriterium ihrer Wahrheit und Richtigkeit ist dabei, ob sie zum Gelingen des menschlichen Lebens beitragen. Wie das Leben und Werk Jesu Christi eine Alternative gegenüber den Lebens- und Herrschaftsformen seiner Zeit darstellt, so könnte ein moderner Neuansatz neue Wege eines wirklich menschenwürdigen Lebens |10|und Glaubens aufzeigen, der die Engführungen und Einseitigkeiten der bisherigen kirchlichen Lehre aufbricht.
Eine Einführung in das Leben und Werk eines Theologen kann dessen zentralen Gedanken systematisch zusammenfassen und in ihrem Zusammenhang vorstellen. Jede Ausführung über einen Wissenschaftler und Autor sollte aber letztlich eine Anregung sein, dessen eigene Werke neu oder wieder neu zu lesen.