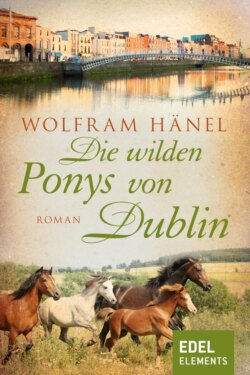Читать книгу Die wilden Ponys von Dublin - Wolfram Hanel - Страница 6
1.
ОглавлениеNeill hat gemeint, dass wir am besten den Expressbus von Dublin nach Wexford nehmen. Bis zum See rauf. Von da an müssen wir dann laufen. Ein, zwei Stunden, hat er gesagt. Vielleicht auch länger. Falls die Herde weitergewandert ist und wir sie nicht gleich finden.
Mir soll es egal sein, wie lange wir laufen müssen. Ich laufe jeden Tag acht Kilometer. Morgens vier Kilometer hin zur Schule und nachmittags wieder vier Kilometer zurück. Seit die Busgesellschaft letzten Monat unseren Stadtteil aus dem Fahrplan gestrichen hat. Sie haben behauptet, dass sie nicht länger für die Sicherheit ihrer Fahrer garantieren könnten. Haha! Als wären wir in New York oder in Chicago oder was weiß ich wo.
Mann, das hier ist Dublin, und Angst haben muss hier überhaupt niemand. Jedenfalls nicht, so lange er nicht gerade mit dem Sozialhilfegeld vom letzten halben Jahr in der Gegend rumwedelt. Aber so blöd wird ja wohl keiner sein. Und außerdem hat hier sowieso keiner die Chance, seine Stütze ein halbes Jahr lang aufzuheben. Weil die paar Pfund nämlich schon am nächsten Tag wieder weg sind. Für die Miete. Oder die Hausrate. Oder für ein paar Klamotten vom Flohmarkt. Oder einfach für Kippen und Guinness. Manchmal auch für was zu essen. Aber wirklich nur manchmal, wenn noch was übrig ist.
Ich glaube eher, dass sich die Typen von der Busgesellschaft geärgert haben, weil bei uns nichts zu holen ist. Wir sind nämlich schon vorher gelaufen. Die meisten von uns jedenfalls. Weil es sich keiner leisten kann, für eine blöde Busfahrt fast ein Pfund auszugeben. Also haben sie alles von Palmerston bis Clondalkin aus dem Fahrplan geschmissen und behaupten auch noch, wir seien selber schuld!
Neill und ich treffen uns unten an der Kanalbrücke. Und dann latschen wir erst mal im Nieselregen bis nach Tallagh rüber, bis zu der Haltestelle, die Neill ausgesucht hat. Neill kennt sich verdammt gut aus hier. Klar, ist ja auch seine Gegend. Irgendwann hat er mir mal erzählt, dass er hier schon als kleiner Junge Kohlen ausgefahren hat. Noch mit Michael, seinem älteren Bruder, als sie ihren Platz noch an der N 4 hatten, lange bevor sie zur Kiesgrube umgezogen sind.
Neill weiß auch, dass der Busfahrer jedes Mal zum Zeitungsladen am Friedhof rübergeht, um sich seine Times zu holen. Weil der Typ vom Zeitungsladen sein Schwager ist oder so was und weil er die Zeitung umsonst kriegt. Und dabei lässt er immer die Türen offen, auch hinten. Wahrscheinlich, weil er seine Karre noch mal richtig durchlüften will, bevor er weiterfährt.
Ist auch besser so. Zwischen den letzten beiden Sitzreihen ist nämlich eine schöne, große Guinnesspfütze. Und daneben noch was, das ein bisschen aussieht wie alte Kotze. Aber vielleicht ist es auch nur ein matschiger Hamburger. Neill und ich brauchen uns jedenfalls nur durch die hintere Tür zu quetschen und als der Busfahrer mit seiner Times zurückkommt, hängen wir schon längst auf der Rückbank und gucken zum Fenster raus. Als würden wir schon seit dem Busbahnhof auf der Rückbank hängen und Dublins Sehenswürdigkeiten bewundern. Morgens um kurz nach sechs, bei Nieselregen!
Der Fahrer knallt den Gang rein und Neill boxt mich grinsend in die Seite. Ich grinse zurück, aber ich fürchte, es gelingt mir nicht besonders. Ich bin so aufgeregt, dass mir fast schlecht ist. Und außerdem sind meine Turnschuhe total durchgeweicht und ich habe Füße wie Eis.
Der Bus ist fast leer. Nur weiter vorne sitzen ein paar mittelalterliche Tanten, die über ihre Wochenend-Abenteuer im Ballroom quatschen. Und ein junger Typ im Anzug und mit Aktenkoffer, der andauernd gähnt (der Typ, nicht der Aktenkoffer!). Wobei er sich jedes Mal zur Seite dreht, damit niemand was merkt.
Bis Brittas reden wir beide kein Wort. Das ist auch so was, was ich an Neill wirklich mag. Man braucht nicht die ganze Zeit zu labern. Nicht so wie bei den anderen. Ich kann einfach neben ihm sitzen und muss nicht immerzu denken: Mann, was sage ich bloß?
Ich starre durch die verschmierte Fensterscheibe, ohne irgendwas zu sehen. Ich denke an Johnny-Gut-Drauf. Ich habe Neill noch nichts davon gesagt, aber so werde ich ihn nennen: Johnny-Gut-Drauf. Denn dass er gut drauf ist, ist ja wohl klar. Ich hoffe nur, meine Eltern ticken nicht völlig aus. So ganz sicher bin ich mir nicht, vor allem nicht, was meine Mutter angeht. Aber das hat Zeit bis heute Abend, jetzt müssen wir ihn überhaupt erst mal finden. Neill hat gesagt, er wäre fast weiß. Mit dunkler Mähne und dunklem Schweif …
„Verdammt“, stößt Neill zwischen den Zähnen hervor und ich merke, wie er plötzlich jeden Muskel anspannt, als wollte er gleich aufspringen. Ich brauche einen Moment, bis ich kapiere, was überhaupt los ist.
Wir stehen an einer Haltestelle. Das muss Brittas sein. Und gerade ist jemand eingestiegen. Erst sehe ich nur seinen feisten Nacken, weil er mit dem Rücken zu mir steht, während er mit dem Fahrer redet. Aber als er sich dann umdreht und wie zufällig erst auf die Tanten und den Typen im Anzug und dann auf uns blickt, weiß ich Bescheid.
„Kontrolleur?“, flüstere ich trotzdem noch zu Neill rüber. Neill nickt kaum merklich und legt mir den Arm um die Schulter. Drückt mich an sich und vergräbt sein Gesicht in meinen Haaren, als wären wir irgendein blödes Liebespaar, das nichts Besseres zu tun hat, als in aller Herrgottsfrühe mit dem Expressbus durch die Gegend zu gondeln.
Ich schiele nach vorne zu dem Kontrolleur. Der steht immer noch zwischen den ersten Sitzreihen und klammert sich an die Haltestange, als der Fahrer jetzt die Gänge krachen lässt und gefährlich schlingernd durch die nächste Kurve rutscht.
„Ganz ruhig“, flüstert Neill mir zu. Aber er selbst ist alles andere als ruhig und ich weiß genau, dass er fieberhaft nach irgendeiner Idee sucht, wie wir aus der Mistkarre rauskommen, ohne erwischt zu werden.
Jetzt beugt sich der Kontrolleur zu den Ballroom-Tanten und die Show nimmt ihren Anfang: „Die Fahrausweise, bitte, meine Damen. Danke. Wünsche noch einen schönen Tag, am liebsten würde ich ja gleich selber mitkommen, aber der Job ruft und Paddy, der verdammte Halsabschneider, gibt mir schon lange kein Guinness mehr auf Kredit, Sie wissen, wie das ist …“ Und noch mal schäker, kicher und gacker, dann ist der Typ mit dem Anzug dran. Der kramt erst mal ungefähr eine Woche in seinen Taschen und dann fängt er an, irgendwas vor sich hin zu stottern, Mann, ich glaube fast, wir sind nicht die Einzigen, die es mit Schwarzfahren versucht haben!
Da springt Neill plötzlich auf und schreit: „Anhalten! Sofort anhalten! Da lag eben einer im Straßengraben!“
Neills Stimme überschlägt sich fast vor Panik und für einen Moment gehe sogar ich ihm auf den Leim, aber dann blinzelt er mir kurz zu, bevor er durch die Sitzreihen zum Fahrer stürmt und dabei wieder schreit: „Halt an, Mensch, da liegt einer im Straßengraben, ich hab’s genau gesehen, angefahren oder so!“
„He he, Junge, Moment mal …“ Der Kontrolleur will Neill am Arm packen, aber Neill reißt sich los und schreit und fuchtelt mit den Händen in der Luft rum und zeigt dabei immer wieder zum Rückfenster raus, bis die Ballroom-Tanten geschlossen nach hinten gestürmt kommen und sich die Nasen an der Scheibe platt quetschen: „Was denn? Wo denn? Ist er tot?“
„Okay, halt an!“, überbrüllt der Kontrolleur jetzt ganz wichtig das Chaos. „Da ist irgendwas!“
Und wirklich, der Bus fährt links ran, fauchend öffnen sich die Türen und Neill packt mich an der Hand und reißt mich vom Sitz hoch und aus dem Bus raus. Aber dann rennen wir erst noch ein paar Meter mit den anderen auf der Straße zurück, bevor Neill endlich zischt: „Jetzt!“ Im gleichen Augenblick setzt er auch schon über den Graben und ich natürlich hinterher, aber dann bleibe ich gleich an der erstbesten Wurzel hängen und schlage der Länge nach hin und denke schon, das war’s. Rappel mich aber doch wieder hoch und keuche hinter Neill her, bis meine Beine sich anfühlen, als wären sie aus Gummi, und ich kaum noch Luft zum Atmen habe.
Als wir schon längst quer über die Weide sind, hören wir sie an der Straße immer noch rufen und schimpfen. Und als wir zurückgucken und Neill ihnen zum Abschied seinen ausgestreckten Mittelfinger hinhält, dreht der Kontrolleur noch mal fast durch. Aber über den Graben zu springen traut er sich immer noch nicht. Schade eigentlich.
Plötzlich fängt Neill an zu lachen. Er japst und lacht, bis ihm die Tränen in den Augen stehen. Erst denke ich, jetzt hat es ihn erwischt, das sind die Nachwirkungen, Schock oder so, aber dann sehe ich es auch: Auf der anderen Seite, schon ein ganzes Stück vom Bus entfernt, macht sich gerade der Typ mit dem Aktenkoffer davon! Ich hatte also Recht, noch einer, der ohne Fahrkarte unterwegs war.
„Komm“, sagt Neill immer noch prustend, „wir verschwinden.“
Eine halbe Stunde und mindestens zwanzig Gräben und hundert Steinmauern später sind wir an der Landstraße zur Schlucht hoch. Und wir haben Glück. Gleich der erste Wagen hält. Na ja, Wagen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Kann sein, dass die Rostlaube früher mal als Ford Transit durchgegangen wäre, aber wirklich sehr viel früher. Und der Hippie, der uns jetzt die Tür aufhält, sieht auch nicht viel besser aus: Haare bis zum Hintern, lauter Rastazöpfe, total verfilzt und dick wie Kälberstricke. Und so fettig, dass er wahrscheinlich damit durch den Regen latschen kann, ohne jemals nass zu werden. Wahrscheinlich perlt der Regen einfach ab.
„Wohin?“, will der Hippie wissen.
„Ein Stück da rauf“, meint Neill und zeigt mit dem Daumen in Richtung Sally Gap.
Wir quetschen uns neben den Hippie. Der versucht ein paar Mal ein Gespräch in Gang zu kriegen: „Verdammtes Mistwetter, was?“, und: „Kommt ihr aus der Stadt?“ Und dann auch noch: „Bisschen früh, um schon unterwegs zu sein, was?“
Aber Neill ist ungefähr so gesprächig wie eine leere Dose Ölsardinen. Ich weiß, weshalb: Neill hat was gegen Hippies. Unter normalen Umständen wäre er auch garantiert gar nicht erst eingestiegen. Er hält alle Hippies für „Crusties“, für Dreckschweine. Er sagt, sie würden ihre Kinder genauso mies behandeln wie ihre Ziegen und Schafe. Kann sein. Aber das machen andere auch, ich brauche bloß an den Vater von Richard und Peter bei uns gegenüber zu denken. Der verprügelt seine Kinder bei jeder Gelegenheit mit dem Spaten. Nicht nur Richard und Peter, auch die kleine Breeda. Nur an Stewart traut er sich nicht mehr ran, weil der schon sechzehn ist und beim letzten Mal zurückgeschlagen hat.
Abigail, meine große Schwester, war mal mit einem Hippie zusammen. Fast ein Jahr lang, bevor sie nach Sligo gegangen ist. Ich schätze, Jamsie ist so ziemlich der einzige Hippie, mit dem Neill jemals einen vollständigen Satz geredet hat. Über Pferde natürlich, worüber sonst? Und Jamsie war auch wirklich in Ordnung. Fand ich jedenfalls. Jamsie mit den selbst genähten Lederhosen und der Quäkestimme. Er hat ganz alleine ein Stück Moor urbar gemacht, nur mit seinem Pferd, Warlock. Ein Shire-Horse so groß wie ein Haus. Aber total freundlich. Jamsie lebt oben in den Wicklow-Bergen, wo der Wind ohne Pause heult und wo du dir im Winter echt den Arsch abfrierst, vor allem, wenn du in so einer Bruchbude wohnst, von der der Sturm beim letzten Mal das halbe Dach weggerissen hat.
Aber Jamsie war trotzdem gut drauf. Er hat immer gesagt, dass man eigentlich nichts weiter braucht als ein gutes Pferd. Mit einem guten Pferd kriegst du den Pflug überall hin, hat Jamsie gesagt, auch noch in die letzten Felsnischen, wo jeder Traktor einfach verrecken würde.
„Kennst du eigentlich Jamsie?“, frage ich den Hippie neben mir.
„Der Spinner mit dem Pferd, was?“, fragt der Hippie zurück und grinst.
„Genau der“, sage ich und ärgere mich, dass ich überhaupt was gesagt habe. Ich glaube, das Problem ist, dass man bei Hippies immer denkt, sie müssten irgendwie anders sein. Besser oder so. Einfach weil sie Hippies sind. Aber stinkende Rastazöpfe zu haben heißt noch gar nichts, der Crustie neben mir ist der lebende Beweis dafür.
Jetzt fischt er sich seinen Tabak aus der Hemdtasche und fängt an, sich eine Zigarette zu drehen. Wobei er mit den Ellbogen lenkt und immer wieder zu uns rüber grinst.
„Was wollt’n ihr bei Jamsie?“, fragt er dann, als er sich die Kippe anzündet und uns zunebelt.
„Hab ich was davon gesagt, dass wir zu Jamsie wollen?“, blaffe ich ihn an und starre demonstrativ auf die Scheibenwischer, die über die Windschutzscheibe quietschen. Der Regen ist stärker geworden. Und die Straße windet sich immer weiter ins Hochmoor hinauf.
Aber wenigstens hält der Hippie erst mal die Klappe. Grinst nur weiter dämlich vor sich hin. Bestimmt denkt er, Neill und ich wären ein Liebespaar. Irgendwie mit Dreck am Stecken auf der Flucht vor der Polizei wie Bonnie und Clyde. Soll er ruhig. Da hat er wenigstens was, womit er seine Gehirnzellen ein bisschen beschäftigen kann.
„Du kannst uns jetzt rauslassen“, sagt Neill nach ein paar Kilometern. Ein Stück unterhalb der Straße steht ein verlassenes Bauernhaus. Grau und in den Regen geduckt, mit Fensterscheiben, die blind vor Dreck sind. Der Hippie stößt einen lang gezogenen Pfiff aus.
„Wollt ihr zu dem Haus da, oder was?“
„Warum nicht?“, gibt Neill zur Antwort.
„Manche sagen, da würde es spuken …“ Der Hippie grinst.
„Vergiss es“, meint Neill nur und knallt die Tür zu. Ohne danke zu sagen oder sonst irgendwas.
Und während der Transit sich wieder zurück auf die Straße quält, ziehen wir uns die Jacken über die Köpfe und rennen zum Haus rüber.
Auf der Rückseite ist es fast windstill. Neill weiß genau, wo er den Schraubenzieher ansetzen muss, und Sekunden später hat er den Fensterrahmen aufgehebelt und wir klettern ins Trockene.
Wir sind in der Küche. Auf dem Tisch stehen noch eine Kaffeekanne und zwei Tassen, auf dem Stuhl daneben liegt eine Zeitung. Ich schiele auf das Datum: 6. Dezember 1989. Das war vor über zehn Jahren! Und doch habe ich irgendwie das Gefühl, als käme gleich der Bauer rein, verschwitzt und verdreckt und mit Kuhscheiße an den Gummistiefeln, fluchend bückt er sich zum Kamin und fummelt eine Weile mit Papier und Streichhölzern, bis beißender Torfrauch durch die Küche mölmt …
Ein Spukhaus, ein haunted house, hat der Hippie gesagt, ein Haus, auf dem ein Fluch liegt, das bewohnt ist, obwohl schon lange keiner mehr da wohnt, ein Platz, an dem sich um Mitternacht die Todesfeen treffen – alles Quatsch. Aber ich weiß, dass Neill normalerweise an solche Sachen glaubt, an Feen und Elfen und Zwerge, wahrscheinlich darf es nur nicht ausgerechnet ein Crustie sein, der ihn darauf hinweist!
Jedenfalls ist Neill ganz cool, steht am Küchentisch und kramt in seinem Rucksack: der Beutel mit dem Hafer, ein Halfter, drei Äpfel.
„Hier“, sagt Neill und hält mir einen Apfel hin, „einer für dich, einer für mich und einer für …“
„Johnny-Gut-Drauf“, sage ich.
„So willst du es nennen?“, fragt Neill verblüfft. „Johnny?“
„Johnny-Gut-Drauf“, sage ich noch mal.
Neill fängt an zu kichern. „Wart’s ab“, sagt er und ich habe keine Ahnung, was er daran so komisch findet, aber da zieht er mich schon zum Fenster: „Dort drüben, siehst du, von da kommen sie.“
Ich sehe nichts als strömenden Regen. Und irgendwo weit hinten über dem Moor die Wicklow-Berge.
„Bist du dir sicher, dass sie kommen?“, frage ich leise.
„Sie kommen“, sagt Neill und gräbt seine Zähne in den Apfel.
Ich weiß nicht, wie lange wir da nebeneinander am Fenster stehen. Und ich weiß auch nicht, was ich denke. Oder ob ich überhaupt irgendwas denke. Mir ist einfach nur kalt und ich habe nasse Füsse und starre in die graue Nässe vor uns, bis mir fast schwindlig im Kopf wird. Aber ich halte durch.
Und dann sind sie plötzlich da! Erst noch nur wie ein Schatten, wie ein undeutlicher Fleck zwischen dem Ginstergestrüpp in der Ferne, dann teilt sich der Fleck, jetzt kann ich sie schon ganz deutlich unterscheiden, drei, vier, fünf, acht Pferde, die schnell näher kommen, sich gegenseitig überholen und wieder zurückfallen lassen, sich im Spiel umkreisen, dann wieder dicht aneinander gedrängt stehen, bis das Spiel von neuem losgeht. Und mittendrin ist ein weißes Pferd, mit grauen Sprenkeln auf der Hinterhand und mit dunkler Mähne und dunklem Schweif …
Wenn ich ein Dichter wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwas über dampfendes Fell und stampfende Hufe sagen können, ich bin aber kein Dichter, also flüstere ich nur: „Schön …“
„Wirklich schön“, flüstert auch Neill, und dann greift er nach meinem Kinn und dreht mein Gesicht, dass ich ihm genau in die Augen blicken muss: „Willst du immer noch?“, fragt er leise.
Ich weiß, was er meint. Und für einen kurzen Moment bin ich mir nicht sicher, aber dann …
„Ich will“, sage ich und lächele Neill an.
„Dann los“, sagt Neill. Er greift sich den Beutel mit dem Hafer und schwingt sich übers Fensterbrett nach draußen. Sie können die Bewegung eigentlich kaum gesehen haben, es sind mindestens hundert Meter vom Haus bis zur Herde, aber doch stehen die Pferde wie angewurzelt, kaum dass Neill auf den Boden gesprungen ist. Und als er jetzt langsam Schritt für Schritt auf sie zugeht, werfen sie aufgeschreckt die Köpfe zurück und tänzeln nervös, aber noch bleiben sie stehen.
Ich halte den Atem an vor Aufregung und beiße mir die Unterlippe blutig, am liebsten würde ich hinter Neill her, irgendwas machen, mich bewegen, aber Neill hat gesagt, das wäre sein Job, er war die letzten Wochen öfter hier oben, an ihn können sie sich vielleicht erinnern, vielleicht …
Neill hält den Haferbeutel weit vor sich, redet mit leiser Stimme irgendwelchen Blödsinn, ununterbrochen, und dabei setzt er ganz langsam einen Fuß vor den anderen, immer näher, die Pferde spitzen die Ohren, recken ihm die Hälse entgegen … Da! Das weiße Pferd bäumt sich auf, mein Pferd, Johnny-Gut-Drauf, und schon drehen sie sich und rasen in wilder Flucht davon. Neill lässt den Haferbeutel fallen und stößt einen gellenden Pfiff aus, Johnny-Gut-Drauf zögert, dreht einen Bogen, noch einmal pfeift Neill – und Johnny-Gut-Drauf kommt zögernd zurück, während die anderen Pferde hinter einer neuen Regenwand verschwinden.
Aber Neill versucht nicht länger, auf Johnny-Gut-Drauf zuzugehen, sondern entfernt sich sogar ein Stück in seitlicher Richtung, allerdings nimmt er dabei wie zufällig den Haferbeutel hoch. Und wenn ich es nicht selbst sehen würde, würde ich es nicht glauben: Johnny-Gut-Drauf folgt ihm! Kommt immer näher, zwei, drei Schritte noch, dann stößt er Neill das Maul gegen die Schulter. Langsam dreht Neill sich um. Johnny-Gut-Drauf hat die Vorderbeine weit gespreizt und die Ohren immer noch flach an den Kopf gelegt, aber er bleibt! Auch als Neill ihm beruhigend den Hals klopft und in die Mähne greift. Johnny-Gut-Drauf gräbt sein Maul in den Beutel und malmt Haferkörner, als hätte er seit Wochen nichts zu fressen gehabt.
Jetzt hebt Neill seine Hand, das ist das Zeichen für mich. Ich greife mir Halfter und Apfel, und während Neill Johnny-Gut-Drauf weiter den Hals klopft, gehe ich langsam auf sie zu. Und fast scheint es, als hätte Johnny-Gut-Drauf jetzt alle Angst vergessen, aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass der Haferbeutel inzwischen leer ist. Vorsichtig nimmt er den Apfel von meiner ausgestreckten Hand und für einen Moment spüre ich seine weichen Lippen …
Ohne Probleme kann Neill ihm jetzt das Halfter über den Kopf ziehen, Johnny-Gut-Drauf hält ganz still und zerkaut nur weiter seinen Apfel, dass ihm der Saft aus dem Maul tropft.
„Sie ist noch nicht lange auf der Weide“, sagt Neill zu mir, „du siehst ja, sie ist an Menschen gewöhnt. Und ihre Eisen sind noch gut, das habe ich beim letzten Mal schon überprüft.“
„Sie?“, frage ich und starre Neill mit offenem Mund an, „aber …“
„Guck selber“, sagt Neill und fängt wieder an zu kichern, „da baumelt ihr nichts zwischen den Beinen, dein Johnny-Gut-Drauf ist eine Stute!“
„Aber du hast doch selber gesagt …“
„Ich habe nur gesagt, ich hab ein Pferd für dich.“
„Oh Mann, du gemeiner Kerl“, rufe ich und boxe Neill in den Bauch, „und du hast es die ganze Zeit gewusst!“
„Klar“, sagt Neill und kichert immer noch, „ich bin ja nicht blind.“
Ich boxe Neill noch mal in den Bauch und dann vergrabe ich mein Gesicht in der Pferdemähne und flüstere: „Macht nichts, Johnny-Gut-Drauf, eine Stute ist mir eigentlich sowieso viel lieber …“
Und Johnny-Gut-Drauf bläst mir ihren warmen Atem ins Gesicht. Und ein paar Apfelreste.
Bevor wir uns auf den Rückweg machen, drehen wir ein paar Proberunden auf der Weide hinter dem Haus.
Neill kann wirklich reiten. Und ich glaube, Probleme hätte er erst, wenn man ihm einen Sattel geben und ihn zwingen würde, seine Turnschuhe in Steigbügel zu stellen. Diesmal muss ich kichern. Weil ich mir Neill gerade in Reiterklamotten vorstelle, mit richtigen Stiefeln und Helm und allem. Unvorstellbar. Ich lege ihm die Arme um den Bauch und mein Gesicht an seinen Rücken und bin glücklich. Johnny-Gut-Drauf reagiert auf jeden Schenkeldruck und den kleinsten Ruck am Halfter, bis Neill sagt: „Alles bestens. Wenn wir wieder von der Landstraße runter sind, wechseln wir.“
„Und wenn wir nach Cherry Orchard reinkommen …“, setze ich an.
„Klar“, Neill lacht, „nach Cherry Orchard rein reitest du alleine. Und ich laufe nebenher. Mann, die Gesichter möchte ich sehen.“
Dann sind wir auf der Landstraße. Und ich halte mein Gesicht in den strömenden Regen und rufe: „Yippiiieh! Ich hab ein Pferd!“
„Platz da, Platz da“, fängt Neill an zu singen, „hier kommt Johnny-Gut-Drauf! Johnny-Gut-Drauf, das ist ’ne Stute und kein Hengst, und wenn du vielleicht denkst, es wäre andersrum, dann bist du einfach schrecklich dumm …“
„Platz da, Platz da“, singen wir beide zum Klacken der Hufe, „hier kommt Johnny-Gut-Drauf …“
Zeitungsmeldung vom 6. Juni: