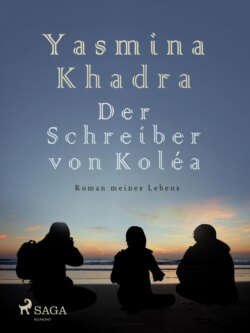Читать книгу Der Schreiber von Koléa - Yasmina Khadra - Страница 8
2.
ОглавлениеIch weiß nicht, ob ich übermäßig unter meiner Gefangenschaft gelitten habe. Ich war ja noch ein Kind. Mein Leben sah nun einmal so aus. Wenn schon die Erwachsenen daran nichts ändern konnten, was vermochte dann ein kleiner Junge auszurichten? Ich musste es nehmen, wie es kam. Meine Jugend und meine hundertdreißig Zentimeter waren hinreichende Entschuldigungsgründe. Ich durfte die Dinge so sein lassen, wie sie waren.
Einige Wochen hatten genügt, um mich zur Raison zu bringen.
Ich verspürte nicht mehr diesen unbändigen Drang, mich schmollend gegenüber dem großen Tor aufzubauen, wartete nicht mehr darauf, dass die hohen Festungsmauern krachend einstürzten und mich in die Freiheit entließen. Lange genug hatte ich nur zugeschaut, wie die anderen sich ihre eigene Welt erschufen, wie sie johlend Fußbälle aus Stoffresten durch die Gegend kickten, und mich ihnen irgendwann dann doch noch angeschlossen. Es brachte nichts, sich weiterhin selbst zu bemitleiden und ständig auszugrenzen. Auch die mächtigen Platanen hatten mir nichts als ihr Schweigen zu bieten. Und wenn ich mich noch so sehr im Winkel verkroch und fingerknetend alle Heiligen des Landes um Beistand anrief, irgendwann holte das Signalhorn mich doch wieder ein. Dann musste ich presto sämtliche Stoßgebete in die Ecke schieben und mich schleunigst meinem Trupp anschließen. Es wäre mir gar nicht gut bekommen, mir die Befehle, die auf uns einprasselten, erst noch wiederholen zu lassen.
Mein Cousin Kader hatte sich wesentlich schneller als ich akklimatisiert. Ich nehme an, mit sieben hat man es da einfach leichter. Er hatte schon seinen festen Platz in einer kleinen Fußballmannschaft und entpuppte sich als tüchtiger Torwart. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er aus nächster Nähe Torschüsse abfing oder, sich einem Gerangel entwindend, auf einen Ball zuschnellte, flink, hoch konzentriert und von erstaunlichem Kampfgeist beseelt. Ich dagegen war viel lieber mit Moumen zusammen, einem fabelhaften kleinen Kerl aus Perrégaux. Ein wenig dicklich war er, mit Bauchansatz und Nasenlöchern, die fast so breit wie sein Lächeln waren. Er faszinierte mich mit den abenteuerlichen Geschichten von seiner Angebeteten, die er wieder und wieder aus den Fängen eines launenhaften, grölenden Monsters befreien musste. Fesselnde Momente waren das. Moumen ersetzte uns den Märchenprinzen. Wir waren ein Dutzend Bengel, die sich nach dem Abendessen auf dem Treppenabsatz vor unserem Schlafsaal um ihn scharten, um immer ein neues Kapitel seiner atemberaubenden Geschichten zu hören, die alle auf dieselbe Art und Weise begannen und endeten, ohne dass wir ihrer je überdrüssig wurden. Unwillkürlich zitterten wir um unseren Helden, der sich mit gezücktem Krummsäbel auf sein weißes Maultier schwang und in den finsteren Wald hineingaloppierte, um seine Herzensdame zu suchen. Wenn es ihm am Ende gelang, den grausigen Menschenräuber zu stellen, flehten wir ihn an, ihn ohne langen Prozess zu enthaupten. Moumen war zwölf Jahre alt, und seine überschäumende Fantasie ein wesentliches Element meiner Eingewöhnung. Ich wurde sein bester Freund. Er übernahm es, mir meine Mutter zu ersetzen, die mir abends vorm Kamin, bei uns zu Hause, immer Geschichten erzählte …
Mein Gott, wie weit war das weg, unser Haus, mein Zuhause …
Wir wohnten in Choupot, einem ruhigen Viertel von Oran, in der Rue Aristide-Briand, Nummer 6. Unsere Villa war geräumig und lichtdurchflutet. Meine Brüder und ich spielten oft und gern Indianer. Mit einer Feder im Haar und roten Lippenstiftstrichen als Kriegsbemalung hielt ich mich für den Häuptling der Sioux. Wir hatten auch eine Garage, die als Bank herhalten musste, wenn wir wie im Gangsterfilm Bankräuber spielten. Und wir hatten einen Geflügelhof, wo wir Hühner, Gänse, Enten und Puten hielten, denn meine Mutter, eine romantische Beduinenseele, breitete ihr Landleben überall dort aus, wo sie sich niederließ – sehr zum Leidwesen meines Vaters, der vergeblich versuchte, sie zu größerer Urbanität zu bekehren. Über dem kleinen Patio, über den zwei ineinander verschlungene Zitronenbäume wachten, wucherte der Wein bis auf die Straße. Im Sommer verwandelten üppige Muskattrauben den Ort in ein wahres Schlaraffenland. Straßenbengel und Passanten mussten sich nur auf die Zehenspitzen stellen, um sich zu bedienen. Es gab Trauben in Hülle und Fülle. Wir gaben unseren Nachbarn, unseren Besuchern und den Bettlern davon ab, und von dem, was dann noch übrig blieb, verfertigte meine Mutter Konfitüren, die jeden Gaumen entzückten …
Ich verstand nicht, was mir widerfuhr.
Ich war doch so glücklich gewesen, bei uns zu Hause.
Früher hatte ich auf diese Dinge nie geachtet, sie fielen mir einfach nicht auf. Aber seit ich hinter den hohen Mauern des Mechouar lebte, wurde alles auf einen Schlag wieder höchst lebendig, selbst die belanglosesten Details: die rasenden Eifersuchtsanfälle meines Bruders Houari, unsere chronischen Raufereien; die Anhänglichkeit meines Hundes Rex; der kleine Laden an der Ecke, dessen Inhaber den vorwitzigen Poltergeistern, die seine Bonbongläser plünderten, auflauerte; die Wutausbrüche des Briefträgers, wenn er uns dabei erwischte, wie wir ihn hinter seinem Rücken nachäfften; die zwerchfellerschütternde Wampe des Schutzmanns; Negus, der alte hirnlose Landstreicher, der uns für zwei lumpige Kröten seinen phänomenalen Phallus vorführte und für einen Kanten Brot seinen Allerwertesten – all das fehlte mir, entzog sich mir, rief nach mir.
Vor allem aber begriff ich nicht, warum ausgerechnet ich unter Waisenkindern leben musste, ich, der ich einen einflussreichen Vater hatte, eine weitverzweigte Familie und eine Mutter, die mich heiß und innig liebte …
Die Kadettenanstalt war eine Schule wie jede andere, mit demselben Lehrplan wie der Rest der Nation; der Unterricht wurde von zivilen Lehrern erteilt, nur die Verwaltung oblag der Armee und unsere militärische Ausbildung wurde Unteroffizieren übertragen. Kader wurde ins erste Schuljahr aufgenommen, ich ins zweite. In meiner Klasse kamen an die zwanzig Schüler zwischen acht und vierzehn Jahren zusammen. Der Krieg war gerade erst vorbei, und es passierte des Öfteren, dass Heranwachsende sich in einer Klasse mit viel Jüngeren befanden. Die Tafel vor uns an der Wand war mindestens vorsintflutlich, Generationen von Schwämmen hatten darauf ihre verblichenen Spuren hinterlassen. Ich hatte die Nummer 118 zum Banknachbarn. Das war eine Nummer für sich: Tlemcens Armenviertel Boudghene entronnen, ein paar Jahre älter als ich, einen Kopf größer, mit hervorspringender Stirn. Er hatte mir vorgeschlagen, mit ihm die Bank zu teilen. Er meinte, er schätze meine Nähe, und wir würden sicher beste Freunde werden. Ich hatte nichts dagegen. 118 war amüsant, draufgängerisch und unwiderstehlich. Allerdings verachtete er die Streber, aber ich war ja keiner. Ein Problem freilich gab es: Er gab mir nie die Gegenstände zurück, die ich ihm ausgeliehen hatte; schlimmer noch: Er stibitzte mir meinen Bleistiftanspitzer, meine Radiergummis, meine Kreidestücke, meinen Federhalter und manchmal sogar meine Messingknöpfe, die er nur im gewaltsamen Tausch gegen meinen Nachmittagsimbiss wieder herausrückte. Ich konnte ihn überwachen, so viel ich wollte und meine Sachen außerhalb seines Zugriffs verwahren; kaum war ich einmal kurz abgelenkt, fehlte schon wieder etwas aus meinem Mäppchen. Eines Tages war ich so weit, dass ich ihn ernsthaft zur Rede stellen wollte. Mit der bloßen Faust. Doch bevor ich auch nur in Deckung gehen konnte, hatte er mir schon die Visage poliert. Der Ausbilder drang lange in mich ein, um herauszubekommen, wer hinter meinem blauen Auge steckte. Vergeblich. Ich hielt dicht. Mehrere Wochen ließ 118 mich seine Dankbarkeit spüren. Dann fing er von heute auf morgen wieder an, mich zu bemopsen. Dieser Drang war vermutlich stärker als er.
Unser Musiklehrer hieß Monsieur Point. Er brachte uns außer der Notenlehre auch noch andere Fächer bei. Ein kleiner, dürrer Franzose war das, und sehr alt. Sein struppiges Haar und sein ausgedünnter, nikotingeräucherter Schnäuzer verliehen ihm das Aussehen eines Gelehrten aus einem Comic Strip. Er siezte uns und nannte uns stets »Messieurs«, was im militärischen Umfeld einen seltsamen Beigeschmack hatte. Lange verdächtigten wir ihn, er habe es darauf abgesehen, uns hereinzulegen, doch wir taten ihm Unrecht. In Wahrheit war er aufrichtig und aufmerksam, und von exquisiter Höflichkeit. Er blieb nicht lange bei uns – falls doch, dann ist es mir entfallen. Ich weiß nur noch, dass er aufgrund einer ungeklärten Besoldungsgeschichte chronisch abgebrannt war; dass ihm als eingefleischtem Raucher die Pfeife permanent im Mundwinkel hing, sein Tabaksqualm den Klassenraum, den Flur, das ganze Gebäude verpestete. Da er seinen Stock lediglich dazu benutzte, um sich Ruhe auszubitten, war er keine Belastung für uns. Bei ihm durfte man mitten im Unterricht wegdösen, ohne dass es einer Gotteslästerung gleichgekommen wäre. Er erklärte jedem, der es hören wollte, dass ein Kind, ganz gleich ob Soldat oder Sträfling, zunächst einmal einfach nur ein Kind sei, das herumtoben müsse und dumme Streiche machen dürfe, und dass es nicht logisch sei, es wie einen Erwachsenen zu behandeln. Das war mal ein vernünftiger Mensch, auch wenn ihn alles anwiderte, und staubtrocken in seiner Art. Jeden Morgen trat er mit verkniesterter Miene an, wirkte ein wenig verloren in seiner Safarijacke, die er winters wie sommers trug, und brauchte länger, um die Riemen seiner Aktentasche zu lösen, als ein Schielender zum Einfädeln eines Fadens. Hin und wieder glitt ihm ein Buch oder Heft aus den Händen und fiel zu Boden. Nie hob er sie vor dem Ende der Stunde auf, so sehr war ihm jegliche Anstrengung, und vor allem jede unvorhergesehene Anstrengung zuwider. Und so weckte er, ohne allzu großen Eifer an den Tag zu legen, allmählich unser Interesse für Notenpapier, für die Tastatur der Klarinetten, bisweilen auch fürs Zeichnen, für die Fabeln La Fontaines und für uns selbst … Unser zweiter Lehrer, ein Algerier, war da ganz anders. Ein Versprecher oder ein unterdrücktes Kichern reichten ihm schon, um die Klasse in eine Turnhalle zu verwandeln und alle anzuherrschen, sich bäuchlings hinzulegen und zwanzig anständige Liegestützen zu machen. Er war ein hochgewachsener Vierziger mit wuchtigem Schädel, auf dem ein Fez thronte. Tagaus, tagein erschien er in einem Dreiteiler aus feinen grauen Nadelstreifen mit goldener Uhrkette auf der Weste. Sein gepflegtes Arabisch und seine übersteigerte Arroganz ließen an einen bürgerlichen Intellektuellen aus dem osmanischen Ägypten denken. Seinen Namen habe ich nicht behalten, aber ich sehe noch sein milchiges Gesicht vor mir, in dem zwei blaugrüne Augen blitzten, die imstande waren, unsere geheimsten Gedanken zu entziffern. Er war von schwindelerregendem Nationalstolz, erbebte förmlich beim Fahnenappell und hatte sich geschworen, veritable Genies aus uns zu machen, die im Konzert der Nationen ein glanzvolles Algerien errichten würden …
Die Ausbilder waren keine schlechten Menschen. Trotz der Strenge, die sie an den Tag legten, waren sie doch voller Mitgefühl für unser trauriges Los. Jeder Kadett trug sein eigenes am Bändel, manchmal war es auch seiner Stirn eingeritzt; es sprang einem in die Augen, dass sich unter der feldgrauen Uniform des kleinen Soldaten insgeheim eine Seele aufzehrte. Doch es gehörte zum militärischen Wertekodex, dass man seinen Kummer für sich behielt. Weder die Ausbilder noch ihre Schützlinge hatten ein Interesse daran, an offene Wunden zu rühren. Und das war auch besser so.
Zumindest unser Hauptfeldwebel, Si Tayeb, war dieser Meinung, auch wenn er sein Gebiss versehentlich schon einmal auf dem Ohr eines Schülers ablegte. In seinem Jähzorn, er entflammte schneller als jede Zündschnur, richtete er mit seinem Knüppel großes Unheil in den Reihen der Kadetten an. Er wütete wie der Marder im Hühnerstall. Feldwebel Bahous wiederum war der Typ klassischer Unteroffizier, stolz und feinsinnig. Wir bewunderten ihn mehr, als dass wir ihn fürchteten. Die Trillerpfeife immer griffbereit, wachte er über uns wie über seinen Augapfel. Als kühner Sohn der Sahara hatte er die Loyalität und das Pflichtbewusstsein seines Stammes geerbt, dazu einen ausgeprägten Sinn für Folklore. In seinen Freistunden trug er uns Ya ghorbati vor, »Mein Exil«, ein von ihm selbst verfasstes Lied. Sein südlicher Akzent und seine näselnde Stimme, die Moumen perfekt zu imitieren verstand, ließen kein Auge trocken. Der schemenhafte Sergent Kerzaz wiederum hatte Mühe, nicht mit seinem eigenen Schatten verwechselt zu werden; unsere teuflischen Streiche ließ er mit verblüffender Langmut über sich ergehen. Der Leiter des Schülerbataillons war ein gedrungener Leutnant namens Midas, ein Feuerschopf in jeglicher Beziehung. Seine heisere Stimme, die wie Kanonendonner hallte, ließ uns im Umkreis von Kilometern erstarren. Wessen Nase fatalerweise in den Zangengriff seiner Finger geriet, der bekam sie nicht mit heiler Haut zurück. Seine Ohrfeigen waren extrem rabiat, sein Tritt in den Hintern exakt kalkuliert, doch seine Vorliebe, die galt der falaqa, den Hieben auf die bloßen Fußsohlen – das war sein Hobby. Mit Unterstützung von Rabah, einem großen Kerl von Kadetten, dessen Aufgabe darin bestand, die Füße des Delinquenten zwischen seinen Schenkeln festzuklemmen, überprüfte Midas zunächst die Sauberkeit der Fußnägel des »Strolchs«, bevor er mit seiner Klopfpeitsche darauf einschlug. Die Strafe hatte immer im Schulhof stattzufinden, wenn alle zum Sammeln antraten. Damit es auch ja jeder mitbekam. Midas bestand darauf. Mein erstes Schauspiel dieser Art wurde mir von Nummer 53 geboten, einem Lausebengel aus Palikao. Er hatte die Reifen des Volvos durchstochen, mit dem wir einen Ausflug hätten machen sollen. Der Bus war eigens aus Oran geordert worden. Midas hätte sich fast die Haare ausgerissen. Ein Ausflug, der wegen eines Dummejungenstreichs ins Wasser fiel; das konnte man nicht durchgehen lassen. Nummer 53 bekam vierzig Peitschenhiebe zugeteilt, von denen ihn jeder einzelne wie ein Stromstoß durchfuhr. Nach etwa zwanzig Kontorsionen konnte der Ärmste nicht mehr. Er bäumte sich immer seltener auf, hatte kaum noch die Kraft zu schreien; irgendwann blieben ihm die Tränen aus, und er wimmerte nur noch leise vor sich hin. Auf allen Vieren kroch Nummer 53 am Ende zu seinen Kameraden zurück und musste tagelang auf den Gebrauch seiner Gehwerkzeuge verzichten.
Die wenigen Korporäle, die hin und wieder für die Ausbilder einsprangen, waren ohne erkennbare Gefühlsregung bei der Sache. Sie ließen sich weder anrühren noch bestechen; sie umzustimmen, war aussichtslos. Beim geringsten Verstoß schnappten sie uns beim Genick, um unsere Matrikelnummer zu sehen, die in Rot unserem Jackettkragen aufgenäht war. Da sie weder lesen noch schreiben konnten, begnügten sie sich damit, die Zahlen abzumalen, und zeigten uns unverzüglich bei der Schulleitung an. Wir verübelten es ihnen nicht. Sie waren nervig, aber korrekt.
Einen jedoch gab es, der seine Vorrechte missbrauchte: Sergent Ferrah. Das Barett nach Zuhälterart schräg über der Stirn und im Mund nichts als Unflat, war er von furchterregendem Sadismus. Manche Kadetten machten aus Angst vor ihm sogar in die Hose. Er war ein verbitterter, widerwärtiger Mensch. Er konnte niemanden ausstehen, am wenigsten aber die Offiziere. Als er erfuhr, dass ich der Sohn eines Offiziers mit höherem Dienstgrad war, legte er mit Freuden los. Wochenlang weckte er mich um drei Uhr morgens und zwang mich, die Stiefel meiner Stubenkameraden bei völliger Dunkelheit zu wichsen; und wehe mir, wenn sich auf dem Leder auch nur das kleinste Staubkörnchen zeigte. Bei Tage verfolgte er mich förmlich, ließ mich strammstehen, bis ich ohnmächtig wurde, oder endlos durch den Schlamm robben. Er hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Jede Nacht betete ich zu Gott, er möge ihn mir aus dem Weg räumen und dafür sorgen, dass er so weit wie möglich versetzt werden würde. Und eines Abends kam Sergent Ferrah tatsächlich stocktrunken zurück, torkelte herum und veranstaltete einen Riesenradau. Man sperrte ihn sofort in den Arrest. Am nächsten Morgen wurde er aus dem Dienst entfernt, und für sämtliche Kadetten war es, als ginge die Sonne auf … Zwanzig Jahre später kam in einem Café in Maghnia ein sehr ramponiert wirkender Mann auf mich zu:
»Erinnern Sie sich noch an mich, Herr Leutnant?«
Ich setzte meine Tasse ab, musterte ihn kurz, nur ganz kurz: »Und ob, Monsieur Ferrah.«
Er nickte, mit gesenktem Blick. Ich habe ihm einen Kaffee und eine Limonade spendiert und dann sofort das Café verlassen. Er hat nie wieder versucht, mich anzusprechen.
Jeden Sonntag wurden die Kadetten, sofern sie nicht zu den Kriegswaisen zählten, die ihren Glauben an die Märchenfee längst verloren hatten, von fieberhafter Erregung gepackt. In kleinen oder größeren Gruppen schwärmten sie in den Hof aus, mit klopfendem Herzen, den Blick erwartungsvoll auf den Verwaltungstrakt geheftet, den ein krächzender Lautsprecher überragte. Es war der Tag der Elternbesuche; der längste Tag von allen, der qualvollste Tag … Ab neun Uhr früh spuckte das Mikro die Namen der ersten Auserwählten aus und verscheuchte die Tauben von den Dächern ringsum. Wer sich im Geknister des Lautsprechers wiedererkannte, stürzte los zum Besucherzimmer, die Pupillen in panischer Vorfreude geweitet. Manchmal versuchte der Arm eines Freundes, ihn zum Spaß kurz zurückzuhalten. Die Reaktion fiel jedes Mal so heftig aus, dass jeder Anker gerissen wäre … Keine Kraft der Welt ist im Stande, ein Kind aufzuhalten, welches losläuft, um seine Familie wiederzusehen. Vor allem, wenn es schon vorher weiß, dass das Wiedersehen kaum länger als eine Umarmung dauert.
Bei jedem Namen, der erscholl, sprang mein Cousin bis unter die Decke, in der Gewissheit, diesmal sei es aber unser Name. Bedauernd verzog ich das Gesicht. Er kam wieder auf den Boden, untröstlich:
»Kommen die denn nie?«
Geschlagene zwei Monate sehnten wir uns nun schon nach dem Anblick einer geliebten Person, und unsere Leute ließen sich einfach nicht blicken. Mein Cousin wollte es sich nicht eingestehen. Und ich wusste nicht, was ich ihm hätte sagen sollen. Ich litt ebenso wie er, aber ich war der Ältere; ich war es mir schuldig, Haltung zu bewahren, ihm zu beweisen, dass wenigstens ich für ihn da war …
Am Ende der Besuchszeit, wenn sich das große Tor über unseren allerletzten Wünschen und Stoßseufzern schloss, kehrten die Auserwählten deprimiert zu uns zurück, betrübter denn je. Der festlich gedeckte Mittagstisch im Speisesaal vermochte den Grad ihrer Niedergeschlagenheit in keiner Weise zu mindern. Nur, wer ohnehin keine Familie hatte, ließ sich das Essen so richtig munden – ein kurzer Ausgleich für den Dauerstatus als Anonymus. Die anderen, die Glückspilze vom Vormittag und die weniger Glückhaften, wagten sich weder an die Obstkuchen noch an die Limonaden heran. Ihre Kehle war so zugeschnürt, dass sie schon an einem einzigen Löffel Suppe erstickt wären. Der nächste und noch die nachfolgenden Tage waren bestimmt von unterdrückten Wutanfällen.
Am Vorabend des kommenden Sonntags aber war alles wie ausgelöscht und ging von vorne los: Hastig wurde das Frühstück verdrückt, dann schwärmte man stumm hinaus auf den Hof. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!
Mit der Zeit indes strebten die Auserwählten dem Besucherraum mit immer weniger Enthusiasmus entgegen. Diese Glücksmomente, die schneller als die buttrigste Brioche zergingen, elektrisierten sie nicht mehr. Ein Verwandter, der kommt und geht, richtet mehr Unheil an als einer, der in Vergessenheit gerät. Doch für alle, die, genau wie Kader und ich, kläglich darauf warteten, endlich auch einmal in den Besucherraum gerufen zu werden, war das jede Mühe der Welt wert – und müssten sie auch für den Rest ihres Lebens darunter leiden.
Ich zählte mit meinem Cousin die Tage und Nächte an den Fingern ab, die uns noch vom Sonntag, dem 4., Sonntag, dem 11., Sonntag, dem 18., und so weiter trennten. Und je verstockter der Lautsprecher unseren Namen mied, umso beharrlicher zählten und zählten wir, anfangs mit frenetischer Besessenheit, dann mit einem ätzenden, immer größer werdenden Triumphgefühl – dem schmerzlichen Triumph zweier Knirpse, die glaubten, selber schuld daran zu sein, dass ihre Familien sich nicht für sie interessierten und die sich deshalb keine Schonung gönnten.
Und eines Nachmittags, just in dem Moment, als ich am allerwenigsten damit gerechnet hätte, passte Sergent Kerzaz mich bei Unterrichtsende ab, um mir mit monotoner Stimme mitzuteilen, dass mein Vater da sei.
»Aha«, erwiderte ich ohne rechte Begeisterung.
Es ging mir nicht gut. In meinen Kautschuksandalen fror ich mir beinahe die Füße ab. Es war Ende November, und die Kälte brutal. Die von Bulgarien zugesagte Kleiderlieferung verspätete sich, und unsere Sommerbekleidung schützte uns nicht. Der Schule, die sich noch im Aufbau befand, fehlte es an finanziellen Mitteln und an Material. Die Klassenzimmer und die unbeheizten Schlafsäle erinnerten an Kühlräume. Einige wenige, nämlich die am längsten aufgeschossenen Kadetten, gruben in düsteren Kleiderkammern alte Kriegsgefangenenmäntel aus, die muffig rochen und grotesk aussahen, und auf deren Rücken dicke weiße Nummern klebten. Der Rest begnügte sich mit Erwachsenenpullis und klapperte vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang mit den Zähnen.
Mein Cousin Kader hatte sich eine üble Bronchitis eingefangen. Man verweigerte mir die Erlaubnis, ihn im Krankentrakt zu besuchen. Ich selber hustete mir auch schon fast die Kehle aus dem Hals. Und ich war nicht der Einzige. Ich hatte rissige, schwärzlich verfärbte Hände, und meine Finger waren kältesteif bis unter die Achseln. Der Besuch meines Vaters kam extrem ungünstig. Es störte mich, ihm, der so sehr alles Heile und Gesunde liebte, einen solch kläglichen Anblick zu bieten.
Der Sergent forderte mich auf, mich zu schneuzen und die eines Soldaten unwürdige Jammermiene abzulegen. Er hob mein Kinn an, zupfte meinen Kragen zurecht und zeigte mir den Weg.
Mein Vater plauderte mit Leutnant Midas im Hof. Beide beobachteten sie mich, während ich versuchte, meinen von den Eisklumpen, die mir als Füße dienten, behinderten Gang zu korrigieren.
»Halt dich gerade!«, soufflierte Kerzaz in meinem Nacken. »Zeig ihm, was du bei uns gelernt hast.«
Im Laufschritt, die Fäuste auf Höhe der Brust, näherte ich mich den beiden Offizieren, stoppte exakt sechs Ellen von ihnen entfernt – wie unsere Ausbilder es uns beigebracht hatten – und salutierte. Mein Vater lächelte. Dann schlug er mit einer gewissen Nonchalance die Hacken zusammen und stand seinerseits stramm. Man hätte meinen können, wir seien bei der Truppenparade. Ich dachte, er würde nun auf mich zukommen, mich umarmen, mir gestehen, wie sehr ich ihm fehlte. Normalerweise setzte er ein Knie auf den Boden und öffnete mir seine Arme – so weit, dass sie mir weiter als der Himmel erschienen. Und ich lief dann auf ihn zu, schmiegte mich an ihn und versank in den Wolken …
Diesmal aber begnügte er sich mit einem Lächeln, die Lippen leicht vorgestülpt, um Leutnant Midas zu verstehen zu geben, dass dieser gute Arbeit geleistet hatte.
»Hast du auch nichts vergessen?«, fragte Midas vorwurfsvoll.
Sergent Kerzaz, der hinter den beiden Männern stand, versuchte diskret, mich an die geltenden Benimmregeln zu erinnern. Schlagartig fiel mir alles wieder ein. Erneut führte ich die Hand zum Salut an die Schläfe und brüllte meinen Vater an:
»Kadett Moulessehoul Mohammed, Nummer 129, zu Befehl, Herr Offizier.«
»Gut so«, brummte Midas. »Jetzt darfst du den Arm herunternehmen.«
Ich ließ den Arm sinken, stand aber weiterhin stramm. »Ein Kadett steht solange stramm, bis es heißt, ›Rührt euch!‹«, schnarrte Sergent Ferrah immer, während er unsere Gesichter mit seinem genagelten Patronengürtel peitschte. »Und wenn man strammsteht, dann rührt man sich nicht, was immer auch passiert. Kapiert?« – »Jawoll, Herr Unteroffizier!« – »Was tut ein Kadett beim Strammstehen, wenn ihn eine Schlange gebissen oder eine Wespe gestochen hat?« – »Er rührt sich nicht!« – »Ich habe nicht gehört!« – »Er rührt sich nicht!!!« – »Gut … Ein Kadett, der stramm steht, spricht nur, wenn man ihn dazu auffordert; er reicht einem Vorgesetzten nie als erster die Hand, wie eng auch immer der Grad der Verwandtschaft zwischen beiden sein mag.«
Mein Vater behielt seine Hand bei sich. Er musterte mich oberflächlich, bemerkte nicht, wie blass ich war, bemerkte überhaupt nichts …
»Gut«, sagte Midas, »jetzt lass ich euch mal unter Gentlemen plaudern.«
»Nicht nötig«, wehrte mein Vater ab. »Er ist hier in guten Händen, das sehe ich doch. Ich bin ja nur im Rahmen einer Dienstreise hier. Ich muss vor 16 Uhr zurück in Oran sein.«
»Na, ich hoffe, deine Zeit reicht wenigstens für einen Tee bei mir im Büro.«
»Natürlich, mit Vergnügen.«
Und weg waren sie.
Einfach so.
Ich traute meinen Augen nicht.
Seit jenem Tag habe ich es nicht ein einziges Mal mehr über mich gebracht, meinen Vater noch »Papa« zu nennen. Nicht dass ich ihn dessen für nicht mehr würdig erachtet hätte, aber da war etwas, das sich, mir bis heute unerklärlich, definitiv in meiner Kehle zusammenschnürte und jenes Wort, das dem Kindermund das liebste ist, für immer daran hinderte, seine Süße über meinen Gaumen zu träufeln. Es blieb mir wie ein Blutgerinnsel im Halse stecken, bevor es in die tiefsten Tiefen meines Ich wegsackte, sich von da in allen Fasern meines Seins verlor. Nirgends, in meinem ganzen Organismus nicht, sollte ich je wieder seine Spur oder einen Platz für es finden.