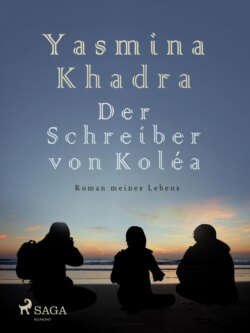Читать книгу Der Schreiber von Koléa - Yasmina Khadra - Страница 9
3.
ОглавлениеAus heiterem Himmel traf uns die Nachricht: Es geht in die Ferien!
Damit hatte niemand gerechnet.
Feldwebel Bahous teilte es uns beim Abendessen mit, was uns auf der Stelle unseren Hunger vergessen ließ. Ein gewaltiger Lärm erhob sich im Speisesaal, überzog schlagartig den ganzen Raum. Suppenkellen trommelten gegen Blechnäpfe, Fäuste hämmerten auf Eisentische ein, Bänke stürzten unter ohrenbetäubendem Krachen um. Man hätte meinen können, ein ganzes Straflager probe den Aufstand. Der Appell der Ausbilder, die Ruhe zu bewahren, ging im allgemeinen Tohuwabohu unter. Schon strömten die ersten Kadetten, die den Ort als zu beengt empfanden, um ihre überschäumende Freude zu fassen, ins Freie – eine Kettenreaktion war die Folge, die alle anderen in einen wilden, dissonanten Strudel hineinriss. Allergrößte Ausgelassenheit machte sich im Schulhof breit, der im Nu wie ein Exerzierplatz aussah. Wir verdrehten die Augen, rissen die Münder auf, lachten, tanzten, sangen, beglückwünschten uns, während die Kriegswaisen mit leerem Blick daneben standen und die Jüngeren, die unter Sechsjährigen, staunend mit uns feierten, ohne zu begreifen, worum es ging.
Nachdem er seinen Freudentaumel beendet und sich die Stimme aus dem Leib gebrüllt hatte, tauchte mein Cousin Kader irgendwann bei mir im Schlafsaal auf, in den ich mich zurückgezogen hatte, und wollte wissen, was das Ganze denn eigentlich zu bedeuten hätte.
»Wir haben Urlaub«, erklärte ich ihm.
»Das habe ich gehört, aber was heißt das?«
»Dass wir nach Hause fahren.«
»Wirklich? Stimmt das wirklich?«
»Na, ich wüsste nicht, warum Feldwebel Bahous uns anschwindeln sollte.«
»Also ist es vorbei?«
»Was ist vorbei, Kader?«
»Das Leben hier.«
Ich hatte es kommen sehen: Er hatte nicht wirklich verstanden, worum es ging.
»Wir sind lediglich beurlaubt«, erklärte ich ihm.
Er runzelte die Stirn.
Ich sagte ihm, er solle sich zu mir auf die Bettkante setzen, und legte ihm beide Hände auf die Schultern. So machte ich das immer, wenn ich »ernste« Dinge mit ihm zu besprechen hatte. Ich spürte, wie er vor meiner Berührung zurückwich. Er hatte mit einem Mal Angst vor dem, was ich ihm offenbaren würde und bedauerte fast schon, dass er mich überhaupt gefragt hatte.
»Du willst mir doch nicht sagen, dass wir hinterher wieder hierher zurückkommen werden«, stöhnte er.
»Doch, genau so ist es.«
Seine Nackenknochen traten spitz hervor, während sein Kinn sich schutzsuchend in die Halskuhle grub. Er seufzte tief auf, murmelte »Verdammich!« und schlurfte zu seinem Bett am anderen Ende vom Schlafsaal. Ich sah hilflos zu, wie er sich in Kleidern auf seinem Lager ausstreckte und die Decke über den Kopf zog. Ich habe es nicht gewagt, ihn zu stören.
Am Tag der Abreise in die Ferien war das Gros der Urlaubskandidaten schon so gegen elf Uhr weg. Kader und ich wurden langsam nervös. Wir würden doch wohl nicht dieselbe qualvolle Warterei vor uns haben wie bei den sonntäglichen Elternbesuchen! Wie versteinert lehnten wir am Stamm einer Platane und zerbröselten innerlich, sobald der Lautsprecher wieder zu knacken begann. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben nichts so sehr gehasst wie diesen verdammten Lautsprecher. Es war dermaßen unerträglich, dass Kader sich lieber die Ohren zuhielt, um dann an meinem Gesicht abzulesen, ob der jeweilige Aufruf uns galt oder nicht. Punkt zwölf Uhr mittags hallte unser Name durch die Stille. Wir brauchten eine Ewigkeit, uns zu fragen, ob es sich vielleicht nur um den Widerhall eines Echos handelte, den unsere Einbildungskraft uns vorgaukelte.
»Seid ihr taub oder was?«, brüllte Sergent Kerzaz uns an.
Er hatte keine Zeit, sich zu wiederholen.
Wir rasten los wie der Blitz. Schneller als der Blitz.
Mein Vater wartete im Besucherzimmer auf uns. Er war nicht allein. Ein Kadett stand neben ihm, ein gewisser Jelloul, den ich manchmal dabei antraf, wie er Selbstgespräche führte: ein schwieriger Junge, der bald wie ein Tollwütiger herumtobte, bald mit verstörtem Gesichtsausdruck allein in einem Winkel saß. Mein Vater beachtete unseren Gruß nicht weiter, aber wenigstens umarmte er uns. Meinen Cousin umarmte er um einiges herzlicher als mich. Das war mir durchaus nicht entgangen, aber größeres Kopfzerbrechen bereitete mir die Anwesenheit Jellouls.
»Er kommt mit uns mit«, erklärte mein Vater. »Er ist einer von den Kriegswaisen. Die Direktion hat mich darum gebeten, und ich habe zugestimmt, ihn bei uns aufzunehmen. Ich hoffe, ihr werdet ihm helfen, fabelhafte Ferien bei uns zu Hause zu verbringen.«
Die Heimkehr in den Schoß der Familie war ein Ereignis. Der Peugeot meines Vaters wurde im Sturm genommen, sobald er im Innenhof unserer Villa hielt. Meine Mutter kugelte wie ein Schneeball die Freitreppe hinunter, riss den Wagenschlag auf und umschlang mich mit ihren Armen, während Tante Milouda ihre gellenden Jubeltriller auf Wanderschaft durch die Nachbarschaft schickte. Die Familie hatte sich vollständig versammelt, meine Cousins aus Béchar waren da und meine Cousinen aus dem Viertel Victor-Hugo. Mein Onkel Ahmed hielt alle auf Abstand, die sich Kader, seinem Jungen, nähern wollten. Er wollte ihn zunächst einfach nur betrachten. Bebend vor Stolz, die Hände in die Hüften gestemmt, wie ein Hahn, der vor seinem Küken posiert, so stand er vor seinem Filius.
»Was habe ich euch gesagt!«, rief er aus, nachdem er tief eingeatmet hatte. »Sind sie nicht zum Anbeißen?«
Dann tätschelte er seinen Sohn und behielt ihn noch eine ganze Weile für sich. Ich hielt im allgemeinen Gewühl nach meinen Brüdern und meiner Schwester Ausschau, sah aber nur Abdeslem, der im Hausflur stand, die Augen kreisrund vor Glück. Jelloul wurde dieselbe Beachtung wie Kader und mir zuteil. Er wanderte von Brust zu Brust, ohne auch nur Zeit zum Atemholen zu finden. Man schubste uns ins Wohnzimmer, wo eine gewaltige Mahlzeit auf uns wartete. Wir waren viel zu glücklich, um sie zu würdigen. Mein kleiner Bruder Houari schaffte es endlich, sich einen Weg zu mir zu bahnen. Mit zusammengezogenen Augenbrauen und Schmollmund musterte er meine prächtige feldgraue Uniform, auf der zwölf vergoldete Knöpfe prangten, mein maßgefertigtes Barett und meine glänzenden Halbstiefel, drehte sich zu meinem Vater um und verlangte auf der Stelle dieselbe Ausstaffierung. Man versuchte, es ihm zu erklären; er wollte nichts hören und stieß den für ihn so typischen Schrei des verwöhnten Fratzes aus, der mich normalerweise zur Weißglut brachte, an jenem Tag aber rührte und für allgemeine Heiterkeit sorgte.
Nachdem das erste Wiedersehensfieber sich gelegt hatte, nahm meine Mutter mich mit in ihr Schlafzimmer, um mir das neueste Baby zu präsentieren: ein Mädchen mit Namen Saliha. Sie strampelte in ihrer Wiege, und ihre kleinen Fäuste spielten mit einem Stück Vorhang. Zögernd streichelte ich ihr Gesichtchen. Sie zuckte kurz zusammen, hörte auf zu zappeln und drehte sich zu mir um. Ihre dunklen Äugchen musterten mich voller Neugier, dann schenkte sie mir ihr schönstes Lächeln. Ich war entzückt. Jetzt war ich wirklich zu Hause angekommen.
Zwei Missklänge allerdings gab es an diesem ersten Ferientag. Da war zum einen die Nachricht vom Tod meines Hundes Rex. Zum anderen diese eigentlich ganz banale, etwas ungeschickte Bemerkung meiner Mutter – die letztlich doch nicht ganz so belanglos gewesen sein kann, sonst hätte sie sich kaum meinem Gedächtnis eingegraben. Wir saßen alle beim Abendessen. Houari, der begehrlich auf eine prächtige Birne ganz oben im Fruchtkorb schielte, lief schon das Wasser im Munde zusammen. Meine Mutter, die ahnte, was gleich kommen würde, ermahnte ihn, die Birne mir zu überlassen:
»Ehre deinen älteren Bruder!«, herrschte sie ihn an, »vergiss nicht, dass er unser Gast ist!«
Unser Gast?
Diese Art von Respektsbekundung hatte mir ganz und gar nicht gefallen.
Am nächsten Tag wurde ich von meinem Vater vorgeladen. Er saß im Wohnzimmer im Sessel und war damit beschäftigt, sich die Brille mit Durchschlagpapier zu putzen. Ich klopfte an die offene Tür und nahm Haltung an.
»Dazu bist du nicht verpflichtet, weißt du«, bemerkte er.
Ich ging automatisch in die Ruhestellung über, mit gespreizten Beinen und den Händen hinter dem Rücken.
Er lächelte.
»Komm näher.«
Als ich mich nicht rührte, erhob er sich und kam, um mich an sich zu drücken.
»Nimm’s mir nicht übel, Sohnemann. Es ist alles nur zu deinem Besten.«
»Ich nehme dir nichts übel.«
Er trat ein paar Schritte zurück und musterte mich von oben bis unten.
»Du solltest dich besser ernähren.«
»Findest du, dass ich abgenommen habe?«
»Könnte schon sein.«
Er schob mir einen Geldschein in die Tasche.
»Danke«, erwiderte ich.
»Nichts zu danken, Sohnemann.« Dann fing er sich wieder, klatschte munter in die Hände und rief mir zu: »Was stellen wir denn nun mit unserem Tag an, Herr Korporal? Entscheide du. Ich stehe zu Diensten.«
»Ganz wie du willst.«
»Hast du denn gar keine Vorstellung?«
»Nein.«
»Vertraust du mir?«
»Ja, natürlich.«
»Na, dann wollen wir mal. Mir nach!«
Er pferchte uns alle miteinander, Jelloul, Houari, Abdeslem, Kader, Homaïna, meinen kleinen Bruder Saïd und mich, in seinen Wagen und brach mit uns zu einer Stadtrundfahrt auf. Das Radio belferte in voller Lautstärke. Mein Vater war prächtiger Laune. Houari, der darauf bestanden hatte, vorne sitzen zu dürfen, drehte sich um und fing an, uns mit seinen Grimassen zu nerven. In meiner Abwesenheit war er zum Liebling der Familie avanciert und wollte das auch bleiben. Es war ein schöner Tag zum Jahresende, mit einem makellosen Himmel und einer für die Jahreszeit sehr gnädigen Sonne. Jelloul war überwältigt von den gewaltigen Gebäuden und den blinkenden Neonschildern, die die Ladeneingänge mit bunten Lichttupfern verzierten, den Vitrinen und Schaufensterauslagen, in denen es funkelte wie in Ali Babas Höhle. Er war in einem abgelegenen Nest zur Welt gekommen, dem zu Kriegszeiten übel mitgespielt worden war, und entdeckte nun Oran, die schönste Stadt des Landes. Dauernd stieß er mir den Ellenbogen in die Rippen, so beeindruckt war er von den Menschenmassen, die die Avenuen entlang flanierten, und vom schwindelerregenden Slalom der Autofahrer. Mein Vater spendierte uns Krapfen auf einem kleinen Platz und lud uns dann in den Zoo ein, um die wilden Tiere zu sehen. Erst bei Einbruch der Dunkelheit kehrten wir nach Hause zurück, glücklich und völlig erschöpft.
Die erste Woche verging wie im Rausch. Die Verwandtenbesuche rissen nicht ab, jeder wollte wissen, wie die kleinen Soldaten vom Mechouar denn nun aussahen. Die einen waren gerührt, die anderen eher skeptisch. Letztere deuteten an, dass es wohl doch keine gute Idee sei, so kleinen Jungs das Schönste überhaupt wegzunehmen, ihre Kindheit, und ihnen ohne ihr Wissen ein Schicksal aufzubürden, für das sie nicht zwangsläufig geschaffen waren. Meine Mutter zuckte die Achseln. Aus ihrer Sicht waren das alles nur Neidhammel. Driss, mein Onkel, war jedenfalls hingerissen. Er war ein flotter junger Mann, Anfang Zwanzig, ein begeisterter Krimileser; jeden Abend spendierte er uns Kinokarten. Manchmal bat er uns auch, in unsere Uniformen zu schlüpfen, und nahm uns mit in die Stadt, um bei den Mädels Eindruck zu schinden. Die jungen Damen konnten unserem Charme nicht widerstehen. In Sachen Verführung erwiesen wir uns als wirkungsvolle Köder. Dann ließ die Sache langsam nach. Jeder kehrte zu seinen Alltagsaufgaben zurück, und wir konnten endlich selbst über unsere Zeit verfügen. Kader beschloss, bei seiner Familie zu bleiben. Ich kümmerte mich um Jelloul. Mit meinem Taschengeld schleppte ich ihn überall hin, zeigte ihm die Küstenpromenade, die Hochhäuser, den Hafen, das Fußballstadion, die historischen Viertel, das Mausoleum von Sidi el Houari und die alten maurischen Bäder. Je zufriedener er war, umso mehr fühlte ich mich angespornt. Wir standen morgens beim ersten Hahnenschrei auf, schlangen unser Frühstück hinunter und los ging’s, der Eroberung El Bahias entgegen. Ich kannte jeden Winkel der Stadt, Jelloul konnte es gar nicht fassen. Er war überglücklich, fand alles interessant, wollte mehr über dieses und jenes wissen, war unermüdlich und entdeckungslustig. Ich glaube, er fand mich damals echt klasse, weil ich ihm so viele tolle Erlebnisse verschaffte. Er umarmte mich laufend und dankte mir dafür, dass ich mir so viel Zeit für ihn nahm, denn ich schlug ihm wirklich nichts ab. Selbst wenn ich eigentlich schon nicht mehr konnte, hatte ich doch jedes Mal noch jene Extraportion Elan, um ihn an jeden Ort, an den er wollte, zu bringen, ganz egal, wie früh oder spät es war. Sein Glück ließ mich ein Gefühl der Ganzheit und Fülle erfahren. Es machte mich glücklich, ihn glücklich zu machen. Und ich war auch stolz auf mich. Und eines Tages, da traf ich auf einem Stück Ödland ein paar ehemalige Klassenkameraden an, die dort auf Stieglitzjagd gingen. Mit einem Topf Leim gerüstet, den sie aus den geschmolzenen Nuckeln von Säuglingsfläschchen hergestellt hatten, versteckten sie ihre Fallen geschickt im Gebüsch und warteten, dass die Vögel ihnen dort auf den Leim gehen würden. Da sie in großer Armut lebten und ganz auf sich selbst gestellt waren, machten sie aus diesem fragwürdigen Zeitvertreib ihren Gelderwerb. Da gab es Redouane, den Sohn des Schuhmachers; Abbas, dessen Vater behindert war; einen Jungen, der den kuriosen Spitznamen Zit-Zit trug, und Berretcha, den unbelehrbaren Adepten des Schuleschwänzens, der ebenso wenig an den Nutzen des Lernens glaubte wie an die Verheißungen glücklicher Vorzeichen. Berretcha wohnte in einem Elendsquartier in unserer Nähe inmitten einer kunterbunten Geschwisterschar. Sein Vater war notorischer Alkoholiker und Dauergast in den Ausnüchterungszellen der städtischen Polizeireviere. Seine Mutter, eine robuste Amazone mit grünen Tätowierungen im Gesicht, handelte mit Second-Hand-Textilien auf dem Souk von Mdina Jdida und hatte häufig Scherereien mit der Polizei. Es gelang Berretcha nicht, mit der eigenen Familie warm zu werden, und im Unterricht pennte er ständig ein. Als er genug vom geballten Unmut der Lehrer hatte, schmiss er die Schule mit Schmackes hin und wählte das Vagantenleben. Mit schwungvoller Haarpracht und schuppiger Schnupfennase lernte er, unter freiem Himmel zu schlafen und sich ohne Familie durchzuschlagen – und wen kümmerte das schon? Er lebte von kleinen Aufträgen und Botengängen, die man ihm dann und wann übertrug, und manchmal auch vom Betteln. Ich traf ihn regelmäßig vor unserer Haustür an, wie er krümelige Kippen rauchte oder sich Flüssigkeiten mit kuriosen Ausdünstungen einflößte. Da er recht unterhaltsam und nicht die Spur raffgierig war, bot ich ihm hin und wieder an, die Nacht in unserer Waschküche zu verbringen. Zum Dank überließ er mir für ein Stück Brot breitwillig den Nippes, den er in den Tiefen der Mülltonnen auftat.
Berretcha freute sich aufrichtig, mich wiederzusehen. Er ließ seine Leimruten Leimruten sein, um mir zu zeigen, wie sehr ich ihm gefehlt hatte und lud uns ein, seinen armseligen Imbiss mit ihm zu teilen.
»Stimmt das, dass du in der Armee bist? Als ich das gehört habe, wollte ich es kaum glauben. Ich habe mir gesagt, jetzt hat’s bei Mohammed aber ausgesetzt. Sich als Freiwilliger zu melden, in seinem Alter, wie kann man nur? Das will mir bis heute nicht in den Kopf. Manchmal denke ich an dich, wenn ich an deinem Haus vorüber komme. Glaub mir, ich mach mir richtig Sorgen um dich. Ich sag mir immer, Mohammed ist viel zu jung, der kann seine Ration doch gar nicht vor den langen Kerls aus der Kompanie in Sicherheit bringen. Ein ehemaliger Soldat hat mir mal davon erzählt. Ist kein Zuckerschlecken, das Kasernenleben. Er selber, ein ganz kräftiger, cleverer Typ, konnte irgendwann nicht mehr und ist über die Mauer getürmt. Und als er mir so erzählt hat, was für einen Mist er da alles erlebt hat, da habe ich mir gesagt, verdammt, was ist bloß in meinen Kumpel gefahren, diesen netten, harmlosen Kerl, dass er sich da so in die Nesseln setzt? Sag mal, bist du ehrlich bei der Armee?«
»Ja, das stimmt.«
Bestürzt schlug er sich mit der flachen Hand gegen die Stirn, zog dann an seinem Hemdkragen, um sich Luft zu verschaffen. Er war sichtlich mitgenommen.
»Und gefällt es dir da?«
»So wie zu Hause ist es nicht.«
»Na, ich fühl mich bei mir zu Hause ja gar nicht wohl. Aber ich fühl mich sowieso nirgendwo wohl. Aber mich deshalb freiwillig bei der Armee zu melden, das wäre ja wohl das Letzte. Ich bin doch nicht verrückt. Ich habe ja schon Bammel, wenn ich mir nur vorstelle, ich würde in einer Kaserne leben, umgeben von lauter Typen, die wie die Berserker drauflos prügeln und aus deinem Blechnapf fressen, als wäre ihnen alles erlaubt … Haben sie dir eine Waffe und das ganze Zeug gegeben?«
»Noch nicht.«
»Was für ein Gedanke! Man muss schon echt was los haben, um zu tun, was du getan hast. Ehrlich, es will mir noch immer nicht in den Kopf … Und wer ist das da, dein Kumpel? Ist er auch Soldat?«
»Das hier ist Jelloul. Er ist Kriegswaise. Er verbringt seine Ferien bei uns.«
Jelloul zuckte zusammen. Sein Gesicht, das kurz aufgeleuchtet hatte, verdüsterte sich. Natürlich bemerkte ich die Veränderung, aber ich verstand nicht, und dachte auch nicht weiter darüber nach. Er war eben ein seltsamer Junge, und supersensibel. An seine plötzlichen Stimmungsschwankungen, die normalerweise keine dramatischen Auswirkungen hatten, hatte ich mich gewöhnt. Doch als wir wieder allein waren, knallte mir seine Faust ins Gesicht, und ich flog auf die Nase. Ich war so überrascht, dass mir keine Zeit blieb, seinen Fußtritten auszuweichen. Wie besessen schlug er auf mich ein, wütend knurrend, und ließ erst von mir ab, nachdem er mich halb ohnmächtig geprügelt hatte.
»Hast du je von mir gehört, dass mein Vater tot ist?«
»Ich dachte …«
»Hast du das jemals von mir gehört?«
»Nnnein, nie.«
»Und was hast du dir dabei gedacht, an meiner Stelle zu reden? Glaubst du, du kannst dir alles erlauben, bloß weil deine Eltern mich für die Ferien bei sich aufgenommen haben?«
»Ich schwör dir, ich hab dir nichts Böses gewollt.«
»So ein Hänfling wie du kann mir auch nichts Böses wollen. Nicht ein Mal hast du aus meinem Mund gehört, dass mein Vater tot wäre. Es war pechschwarze Nacht. Das Dorf wurde belagert. Kein Mensch begriff, was da los war. Und jeder stürmte blindlings davon, verstehst du? Jeder hat versucht, sich einfach nur in Sicherheit zu bringen … Ich habe dann nicht mehr den Weg zurück ins Dorf gefunden. Und ich bin mir ganz sicher, dass mein Vater mich noch immer sucht. Und er wird mich finden … Ich bin sein Junge, und was das heißt, das weiß er. Er würde das nie dulden, dass sein Sohn von anderen großgezogen wird, er, der …«
Verächtlich ließ er mich stehen und marschierte los, in Richtung auf Kaders Elternhaus.
Er sollte mir meinen Fauxpas nie verzeihen und jeden meiner Aussöhnungsversuche ins Leere laufen lassen.
Nachdem Jelloul nichts mehr mit mir zu tun haben wollte, war ich plötzlich allein. Alles ödete mich an. Der unternehmungslustige Teil der Ferien war vorbei. Ich zog mich zurück, igelte mich ein. Und allmählich dämmerte mir, was um mich herum eigentlich los war. Ich merkte, dass es zwischen meinen Eltern noch immer nicht so richtig klappte. Die Ehekräche von früher hatten sich zwar gelegt, aber die grundlegende Verstimmung war geblieben, sprachlos, bedrückend, und immer lastender. Meine Mutter warf ihrem Gatten seine Passion für fremde Frauen vor, mit denen er sich ungeniert in aller Öffentlichkeit zeigte. Mein Vater wiederum beklagte, dass seiner Gattin nichts über ihre bäuerliche Lebensweise ging, dass sie eine sture, unverbesserliche Landpomeranze blieb, der der Purpurglanz eines Wandteppichs mehr am Herzen lag als der ihrer Lippen. Er hatte versucht, eine moderne Frau aus ihr zu machen, ihren Sinn für Chic und Charme zu schärfen, für weibliche Eleganz und feminine Raffinesse, umsonst. Die geborene Beduinin hielt an ihren Ritualen fest, scherte sich nicht um ihr Aussehen, wollte lediglich eine fürsorgliche Mutter und gute Hausfrau sein. Und in der Tat war sie eine konkurrenzlose Köchin, die uns die köstlichsten Gerichte auftischte und ihr Reich so reinlich wie einen OP-Saal hielt. Dabei rackerte sie sich dermaßen ab, dass sie vor der Zeit zu welken begann. Mein Vater hatte immer von einer emanzipierten Frau geträumt, die sich europäisch zu kleiden versteht und sich elegant die Nase pudert. Als er vor dem Krieg als Hilfskrankenpfleger auf der Ambulanzstation von Kenadsa tätig war, hatte er ein Auge auf Denise Ernest geworfen, eine Französin, deren melodisches Lachen ihn bezaubert hatte. Beide waren heftig ineinander verliebt und schmiedeten Pläne für eine gemeinsame Zukunft. Aber Großvater hatte es anders beschlossen. Als man meinem Vater oben auf der Sicheldüne die Kunde überbrachte, dass er bald heiraten würde, riss er die Augen himmelweit auf. »Los, lauf und wasch dir das Gesicht, du Glückspilz. Wir haben eine Frau für dich aufgetrieben.« So einfach war das. Mein Vater sollte die Gefährtin seines Lebens erst während der Hochzeitsnacht kennenlernen. Sie hatten sich nie zuvor gesehen. Im spartanischen Licht der Öllampe hatte sie ihn für blind gehalten, und er dachte, sie litte unter Krätze. Mit der Zeit aber lernten sie sich kennen, dann inniglich lieben, so innig, dass sie sich schworen, sich nie mehr zu trennen; selbst wenn sie einst im Jenseits wären, wollten sie nacheinander Ausschau halten. Mit meiner Geburt wurde ihr Hochzeitsschwur dann besiegelt. Es war der schönste Tag ihres Lebens, eines einfachen, kleinen, aber menschenwürdigen Lebens. Sie waren arm, er der gefallene Prinz, sie die erschöpfte Nomadin, und hatten nur den einen Wunsch: ihre Kinder so anständig zu erziehen, wie es eben geht, wenn man noch nicht auf alles hat verzichten müssen. Während des Krieges stützten sie einander mit ihrer Tapferkeit und Opferbereitschaft. Die häufige Abwesenheit meines Vaters tat ihrer Liebe keinen Abbruch, sondern festigte sie im Gegenteil, Stein für Stein, wie eine Zitadelle. Zwar hatte mein Vater keine großartige Schulbildung genossen, doch aus den Zeilen, die er meiner Mutter, der Analphabetin, schickte, strömte kindliche, reine Zuneigung; es waren stets Postkarten, auf denen ein junges Paar oder zwei händchenhaltende Liebende verklärt in einem regenbogenfarbenen Herz posierten. Eine dieser kostbaren Karten hütete meine Mutter wie ihren Schatz in einer mit purpurroter Seide ausgeschlagenen Schatulle, inmitten von winzigen Parfümflakons, Muscheln und Modeschmuck, noch lange Zeit nach der Scheidung – eine Karte, die ich später, sehr viel später törichterweise verbummeln sollte, als ich den Schrein ihrer Seufzer entweihte.
Ich hatte so eine Vorahnung, dass die Dinge sich noch zuspitzen würden und die Sache mit der Kadettenanstalt nur eine Etappe des Planes war, den mein Vater heimlich schmiedete. Wäre ich zu Hause wohnen geblieben, hätte er wohl kaum gewagt, weiterzugehen. Er liebte mich ja. Er musste mich unbedingt aus dem Weg räumen, sich daran gewöhnen, dass ich nicht mehr da war. Schon 1963 hatte er sich eine zweite Ehefrau zugelegt; eine charmante Dame aus Tlemcen, die anmutig und elegant war und der die Leute auf der Straße mit offenem Mund nachblickten. Die beiden waren in den dritten Stock eines ganz gewöhnlichen Mietshauses in der Nähe von Mdina Jdida gezogen. Aber ich war da, stand zwischen ihnen. Nach drei Monaten schickte mein Vater seine Grazie wieder nach Hause und kehrte mit mir in unsere Villa zurück. Meine Mutter nahm es ihm nicht weiter übel, aber sie unternahm auch nichts, um ihn zurückzuerobern. Die Streitereien gingen von vorne los. So kam es, dass es mich im Verlauf einer abscheulichen Szene, wo die Beleidigungen lauter als Scherben durch die Luft flogen, mitten in der Nacht auf die Straße hinaustrieb, um besagte Zigarette zu erstehen, die meine Mutter dann später in meinem Schulranzen fand. Ich wollte mich damals zu Tode rauchen.
»Woran denkst du?«
Meine Mutter stand hinter mir auf der Dachterrasse, einen Korb mit ausgewrungener Wäsche in die Hüfte gestemmt.
»An nichts.«
»Mag sein, dass du an nichts gedacht hast, aber du hast bestimmt irgendetwas gemacht.«
»Ich habe auch nichts gemacht. Ich bin gerne allein.«
»Um heimlich zu rauchen.«
»Ich rauche nicht, Mama.«
Sie sah sich gründlich um, fand nichts, musterte mich argwöhnisch: »Lass mich mal an deinem Atem schnuppern.«
»Mama …«
Beschwichtigend hob sie die freie Hand und wandte sich dann ihrer Wäsche zu. Auf Zehenspitzen hängte sie diese auf, denn sie war recht klein, meine Mutter. Ich wartete, bis drei oder vier Bettlaken an der Leine flatterten, dann fragte ich sie:
»Wie ist Rex überhaupt gestorben?«
»Ach, weißt du, man stirbt halt irgendwann.«
»Hat er sehr gelitten?«
»Aber nein. Man hat ihm überhaupt nichts angemerkt. Er ist einfach eines Abends eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht.«
»Glaubst du, es war wegen mir?«
Verblüfft hielt sie in der Bewegung inne, warf unter schallendem Lachen kurz den Kopf in den Nacken, dann wandte sie sich wieder ihrer Wäsche zu.
»Wie kommst du denn auf so einen Unsinn? Kummer ist etwas für die Menschen. Tiere haben doch anderes zu tun.«
Sie näherte sich mir erneut, umfing mit ihren kleinen, abgearbeiteten Hausfrauenhänden behutsam meine Hände:
»Um dich mache ich mir gar keine Sorgen, mein Großer. Da bin ich ganz seelenruhig. Ich weiß zwar nicht, wie es da ist, wo du bist, aber es ist ja alles nur zu deinem Besten. Ich habe dich damals nicht leichten Herzens ziehen lassen. Aber wir kamen nicht umhin, eine Entscheidung zu treffen. Hier wärst du früher oder später unter die Räder gekommen. Du warst so haltlos. Du hast dich ja sogar im Kamin versteckt, nur um nicht zur Schule gehen zu müssen. Du warst ein unverbesserlicher Träumer, mit den Gedanken immer im Wolkenkuckucksheim. Dein Vater hat dich maßlos verwöhnt, und ich hatte so viel anderes zu tun und keine Minute Zeit für dich. Nein, hier wäre aus dir nichts Brauchbares geworden. Du wärst in der Gosse gelandet wie deine Kameraden, die sich auf den Souks als Lastenträger verdingen.«
Sie ging in die Hocke, ohne meine Hände loszulassen, und zog mich zu sich herunter. Ihre Augen leuchteten hoffnungsvoll und voller Zärtlichkeit. Wir hatten keine sonderlich enge Beziehung, meine Mutter und ich. In Kenadsa wurde ich mehr von Tante Bahria umhätschelt, die mich liebte, wie man nur selten einen Menschen liebt. Kurz bevor sie nach langer Krankheit starb, hatte sie noch gesagt, dass sie mich sogar im Paradies vermissen würde. Und in Oran war es dann Tante Milouda, die mich verwöhnte. Ich war ihr Ein und Alles, und sie erlaubte niemandem, mich zu ärgern. Zwischen meiner Mutter und mir aber, da ging alles ganz normal zu. Wir liebten uns, das war’s. Unsere Verbindung benötigte keine Extravaganzen als Stütze. Sie war meine Mutter, ich ihr Junge, Punkt. Ich brauchte mir nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, welchen Platz sie mir in ihrem Herzen einräumte; und wie das so ist bei Errungenschaften, die einem niemand wegnehmen kann, vernachlässigte ich sie ein wenig zugunsten meiner Tante, die sich nicht scheute, mich offen allen anderen vorzuziehen, was mir die Befriedigung verschaffte, auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, ohne mir ein Bein zu verrenken.
»Hab ich dir das eigentlich schon mal erzählt?«
»Was denn?«
»Es war in Meknès, an einem Markttag, da folgte mir eine Frau beharrlich von Stand zu Stand. Sie verschlang dich geradezu mit ihren Blicken. Am Anfang hatte ich sie kurz für eine Kinderdiebin gehalten. Aber das war sie nicht, und sie war auch keine Wahrsagerin, und keine Bettlerin, denn meine Münzen hat sie abgelehnt. Sie hat mich nur darum gebeten, dich aus der Nähe ansehen zu dürfen. Dann hat sie mit einem Finger dein Kinn angehoben. Mit unendlicher Behutsamkeit. ›Aus diesem Jungen wird einmal etwas ganz Besonderes.‹ Das hat sie mir gesagt. Vielleicht war es nur eine Verrückte, aber ich habe ihr geglaubt. Und ich glaube ihr noch immer. Deshalb bin ich auch ganz ohne Sorge. Du bist ein Gesegneter, mein Großer. Dort, wo du den Schritt hinsetzt, wird alles grünen und gedeihen.«