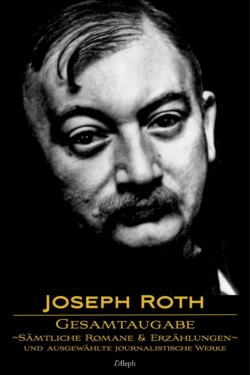Читать книгу Joseph Roth: Gesamtausgabe - Sämtliche Romane und Erzählungen und Ausgewählte Journalistische Werke - Йозеф Рот - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Von dem Orte, von dem ich jetzt sprechen will
Оглавлениеundatiert
Von dem Orte, von dem ich jetzt sprechen will, mochte es wohl einst geheißen haben, daß er außerhalb der Stadt liege. Heute kann davon längst nicht mehr die Rede sein. Zwar grenzt er noch an freiliegende Felder und sumpfige Wiesen, aber an seiner rissigen Mauer, die ihn rings umgibt, kleben, wie Schwalbennester an Dachrinnen, armselige Häuschen, in die sich die Armut geflüchtet hat, vor deren schmutzigen gelben Türen keifende Weiber schwatzen und schmierige Kinder sich balgen. Im Frühling ruft der Kuckuck dort und stört die eifrigen Frauen in ihrem Geschwätz, die Amsel pfeift wohl auch dazwischen, und abends kann der Lauscher das reinste Nachtigallengold aus den kleinen Sängerkehlen rinnen hören.
Der Ort, von dessen Lage ich erzähle, ist der alte Friedhof meiner Vaterstadt. Die verwitterte Inschrift auf dem längst geschlossenen Eingangstore zeigt die Zahl 1470. Seit ungefähr fünfzehn Jahren ist der Friedhof vom löblichen Magistrat meines Heimatstädtchens gesperrt. »Aus sanitären Gründen« – hieß es in der Kundmachung. Die Leute in meiner Heimat erfreuten sich meistens eines langen Lebens – sie lebten oft hundert Jahre und wohl noch mehr darüber. – Der kleine, alte Friedhof bekam also selten neue Einwohner. Das änderte sich nun eines schönen Tages – oder besser: Jahres. Meinen hochachtbaren Mitbürgern schien es nicht sonderlich auf Erden zu gefallen, und sie traten frühzeitig die Reise in jenes unbekannte Land an, von dessen Gefilden kein Wanderer je wiederkehrt. Aber ihre sterblichen Überreste wurden nicht mehr auf dem alten Friedhof bestattet, sondern mußten sich einen etwas längeren Weg gefallen lassen. In der Nähe des sogenannten Grenzwaldes befand sich die neue Ruhestätte der Toten. Der alte Friedhof aber wurde gesperrt.
Natürlich mußte man einen Wächter haben, der Enkeln und Urenkeln die Gräber ihrer in Gott ruhenden Vorfahren zu zeigen hätte, wenn es jenen etwa einmal einfallen würde, ihre Großväter und -mütter aufzusuchen, sei es, um sich bloß einmal so recht auszuweinen und getröstet wieder fortzugehen, sei es, um die Toten, die sich doch gewiß eines großen Ansehens beim lieben Herrgott erfreuten, um eine kleine oder größere Protektion anzugehen. Aber merkwürdigerweise wollte keiner das Wächteramt übernehmen. Endlich entschloß sich dazu ein alter Magistratsdiener, ein bekannter Freigeist, der aus einer nahegelegenen deutschen Kolonie stammte, äußerst wortkarg war, mit keinem Menschen verkehrte, riesige Mengen Tabak schnupfte und in seinem ganzen Wesen wohl recht in jenen düstern Ort passen mochte. Er hatte übrigens viele der dort Ruhenden bei ihren Lebzeiten wohl gekannt und konnte etwaigen forschenden Urenkeln zuverlässige Auskunft geben. Ein Stück freier Erde war noch übriggeblieben, und auf diesem baute sich der Martin Schwab Kartoffeln und rote Rüben an. Er bezog ein kleines Stübchen in dem Wächterhause, das zugleich ein Seiteneingang in den Friedhof war, schnupfte Tabak, briet Kartoffeln und kam selten zum Vorschein.
Auf jenem Friedhof pflegte ich nun als Gymnasiast viele Stunden zu verbringen. Pochte ich an die Türe des alten Martin, so erschien in einer viereckigen Öffnung die scharfe Hakennase meines Freundes, und eine hohle Stimme fragte: »Hast du Tabak?« Wenn ich hierauf das kleine mitgebrachte Päckchen an die Nasenlöcher des Martin hob, so roch er lange, lange daran, so etwa an die fünf Minuten, daß es mir vorkam, als wollte er, wie ein Elefant, den Tabak mit der Nase durch das viereckige Loch ziehen. Aber bald darauf schob er den schweren Holzriegel zurück, langte nach dem Päckchen, ließ mich ein und schob den Riegel wieder vor. Durch Martins enge Kammer stolperte ich über zerbrochene Stuhl beine und riesengroße, knorrige Kartoffeln zur zweiten Türe hinaus, durch die ich in den Friedhof trat. Ich zündete mir eine Zigarette an, um die Heuschrecken und Wespen zu vertreiben, und wandelte stundenlang zwischen den Gräbern, las die verschiedenen Inschriften, setzte mich wohl auch auf einen halb in den Boden gesunkenen Stein und lebte so einige Stunden in längst verrauschten Zeiten mit längst vergangenen Geschlechtern.
Unter den neuen Grabsteinen trug einer die Inschrift:
Markus Möllner, ums Leben gekommen am 15. Juni 1901.
Den alten Markus hatte ich wohl gekannt. Er war oft Gast im Hause meines Großvaters gewesen, und der wunderlichen Geschichten, die er mir zu erzählen pflegte, erinnerte ich mich noch sehr wohl. Allein, ich wollte noch Näheres aus seinem Leben wissen, und ich beschloß, mich bei den Stadtältesten zu erkundigen. Der erste, den ich fragte, war natürlich Martin. Er gab aber an, von einem Markus Möllner keine Ahnung ZU haben. Ich versprach ihm Tabak – das half. Martin erzählte mir die Geschichte.
In den letzten Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts teilte sich die Bevölkerung meiner Vaterstadt in zwei Gruppen: Es gab nur sehr Reiche und sehr Arme. Man könnte ebensogut sagen: Herren und Diener. Denn die Armen schien der liebe Herrgott, der es allezeit mit den Reichen hält, nur zu dem Zwecke geschaffen haben, um den Reichen das Leben zu erleichtern. Kurz, es gab Patrizier und Plebejer. Die letzteren dienten den Vornehmen entweder direkt als Kutscher, Köche, Dienstboten, Lakaien oder indirekt: D. h., sie waren Vermittler von Dienstpersonal, Zuträger, Makler, brachten Eier, Butter und Geflügel in die Häuser der Reichen, übernahmen Botengänge um ein warmes Mittagessen, buken, wuschen und lebten überhaupt von und für die Reichen. Diese hatten natürlich sämtliche Ehrenämter der Stadt inne. Sie waren Gemeinderäte, Verwalter öffentlicher Anstalten, Waisenhausväter und Schulinspektoren. Sie trugen stets feierliche schwarze Kleider, blitzblanke Zylinder, glänzende Stiefel, hatten runde Bäuchlein unter buntgeblümten Westen und goldene Uhrkettlein darüber, und ihre Brust zierten bei feierlichen Anlässen verschiedene hohe Auszeichnungen. Ihre Söhne schickten sie in der Regel ins Gymnasium. Wenn diese sich mit knapper Not durch den mit Gleichungen vierten Grades und unregelmäßigen Verben vollbesäten Weg zum Ausgangstor der Maturitätsprüfung durchgeschlagen hatten, so bekamen sie entweder irgendeine staatliche oder private Beamtenstelle oder reisten in die Hauptstadt, um nach vollendeten Universitätsstudien als Ärzte, Advokaten, Gymnasiallehrer usw. in ihre Heimat zurückzukehren. Freilich kam es auch hie und da vor, daß einer oder der zweite von ihnen so ganz aus der Art geschlagen war, daß er in die Heimat zurückzukehren vergaß und in des lieben Herrgotts wunderschöner Welt irgendwo spurlos verschwand. Doch das war recht selten der Fall, und in ewig-gleichem Geleise schlich das Leben in meiner Vaterstadt seinen Schneckengang weiter.
Da war aber einer und just der Sohn des Herrn Bürgermeisters, der sich das Ungeheuerliche vermaß, sein Heimatstädtchen aus der behaglichen Dahinduselei zu rütteln und die braven Gemüter seiner ehrenhaften Mitbürger in eine nervöse Spannung zu bringen.
Der junge Markus war schon auf dem Gymnasium ein Exemplar gewesen. Er konnte den Mädeln den Kopf verdrehen, hatte bunte Abenteuer, stritt sich mit seinen Lehrern herum, und - was das allerschlimmste war und den Herrn Bürgermeister und dessen vollbusige Gemahlin in Angst und Schrecken versetzte: Markus machte Verse. Nichts konnte ihn davon abbringen: weder Strafen noch Prügel, noch Drohungen, daß man ihn aus dem Hause schicken würde, konnten fruchten. Markus machte Verse.
Er haßte das Gymnasium, er haßte die Gesetze, er haßte die ganze kleinstädtische, enge Welt, in der er verurteilt war zu leben. Er atmete daher auf, als er mit Weh und Ach die Matura bestanden hatte und nun frei seine Schwingen entfalten konnte. Er rollte schließlich, mit allerlei notwendigen und unnützen Dingen vollbepackt, von väterlichen Mahnungen begleitet und mütterlichen Tränen benetzt, dem Ziel seiner Sehnsucht, der Hauptstadt, zu. Dort inskribierte er Jus – er war Student.
Aber Gesetze und Pandekten – das war es gerade nicht, was dem jungen Markus behagen konnte. Er schwänzte die Vorlesungen, kümmerte sich nicht im geringsten um die Studien, lebte in Saus und Braus, trank und spielte und verlor Unsummen. Wenn ihn der Herr Papa, »der Alte«, wie ihn Markus nannte, in seinen nicht allzu häufigen und langen, aber sehr inhaltsreichen Briefen ermahnte, doch einmal zur Prüfung zu steigen, so antwortete Markus, er sei schon längst vorbereitet, die Prüfung wäre ein Kinderspiel, aber daran, daß er sie noch immer nicht hinter sich habe, sei niemand anderer Schuld als eben der Herr Papa. Es gehe nämlich, schrieb Markus, auf der Universität alles nach dem Alphabet, und da er Zwerdling heiße und also als der letzte im Kataloge stehe, vor ihm aber nicht weniger als neuntausend, sage neuntausend Hörer seien, so müsse er eben warten. Der gute Bürgermeister war sein Leben lang Kaufmann gewesen und hatte von Universität und Studieren nur einen sehr blauen Dunst. Fragte er aber einen Gymnasiallehrer, ob sich es wirklich so auf den Hochschulen verhalte, so zwinkerte dieser mit den Augen, dachte sich, dem jungen, reichen Manne wären wohl ein paar lustige Jährchen zu gönnen, und behauptete, es könne wohl möglich sein, daß eine neue Studienordnung den Zutritt der Hörer zu den Prüfungen nach dem Alphabet geordnet verlange. Der Herr Bürgermeister beruhigte sich und schickte seinem Sohn mit biedermännischer Pünktlichkeit jeden Ersten die verlangte Summe. Als aber aus der Hauptstadt etliche Male Mahnungen auf größere Summen gekommen waren, da schnürte der Herr Bürgermeister seinen Ranzen, vergaß auch den großen Regenschirm nicht mit dem Griff aus echtem Elfenbein und fuhr nach Wien.
Er traf seinen Sohn zu Hause in der Gesellschaft von Freunden und Freundinnen, bei einem überaus geräuschvollen Gelage. Seinen Herrn Papa hatte nun der Markus am wenigsten erwartet. Es mußte rasch eine Ausrede gefunden werden. Ein bemoostes Studentenhaupt wurde als ein Herr Professor vorgestellt, der just heute seinen Geburtstag feire, und zwar im Hause seines geliebtesten Schülers. Das wäre nun so ziemlich gegangen, allein der Herr Bürgermeister fragte sich mit Recht, was denn wohl die Frauenzimmer beim Geburtstage des Herrn Professor zu machen hätten, überlegte bloß einen Augenblick, bat den Herrn Sohn ins Vorzimmer und versetzte ihm dort zwei schallende Ohrfeigen, darob sich die Tafelrunde entsetzte und, ein ähnliches Schicksal befürchtend, mitsamt dem Herrn Professor eilig das Feld räumte. Aber mit den Ohrfeigen war die Geschichte noch lange nicht zu Ende. Es gab noch einen großen Krach, Herr Zwerdling senior gab sein bürgermeisterliches Ehrenwort, von seinem Einzigen nichts mehr wissen zu wollen, setzte sich auf die Eisenbahn und fuhr nach Hause. Weder das Zureden seiner Freunde noch die Tränen der Frau Bürgermeisterin wollten helfen. Markus aber war verschollen.
Jahre waren vergangen. Längst ruhte der Bürgermeister mit seiner Ehegattin in der kühlen Erde. Ihr Haus hatte ein biederer Fleischer erworben, vor dessen Ladentüre rote Lampen brannten und die saftigen Fleischstücke in der Auslage grell beleuchteten. Ein neuer Geist war ins Städtchen gekommen. Es war der Geist der Demokratie und der Elektrizität, Fabriken schossen wie über Nacht aus dem Boden, Fremde kamen und gingen, ein prachtvolles Hotel wurde gebaut, ein Bürgermeister von ganz anderem Schlage, als es der gottselige Herr Zwerdling gewesen, thronte auf dem Kurulensessel im Rathause. Da kam eines Tages der Markus heim. Er trug einen wilden grauen Bart und einen Schlapphut, eine Künstlerkrawatte und einen langen Rock und zerrissene Schuhe. Er begab sich zum Besitzer des Hauses, das einstmals seinen Eltern gehört hatte. Was zwischen den heiden gesprochen worden, hat keiner je erfahren. Aber noch am selben Tage bezog Markus ein kleines Erkerstübchen im Hause des Fleischers, kaufte sich einen blitzblanken, wenn auch ganz unmodernen Zylinder, einen schwarzen Schlußrock und ebensolche Stiefel. Hierauf machte er Visiten bei den Reichen der Stadt. Überall mußte er erzählen. Markus erzählte. Aber schlau wußte er seine interessante Erzählung immer mit einer Bitte abzuschließen, die man ihm gewähren mußte. Immer aber bat er um Kleinigkeiten: ein Rasiermesser, eine Krawatte, eine Busennadel. Das bekam er und noch obendrein mehr. Er aß nämlich täglich irgendwo zu Mittag. Die Leute, die den alten Bürgermeister noch wohl gekannt hatten, mochten sich wohl eine Ehre daraus machen, den jungen Zwerdling zu Gaste zu haben. Die Vermögenden nahmen sich gerne seiner an. Aber mit der Zeit wurde aus dem Gaste ein Hausgerät. Markus war ein besserer Dienstbote, der alle Aufträge zur größten Zufriedenheit der Auftraggeber ausführte.
Marcellus besaß eine große Geschicklichkeit in häuslichen Verrichtungen. Er konnte das Unmöglichste möglich machen. Er konnte zerbrochene Öllampen tadellos reparieren, Strickleitern drehen, kunstvolle Mäusefallen herrichten, Rattengift zubereiten, konnte Messer haarscharf schleifen und Mauerlöcher zukleben. Aber er wußte noch viel, viel mehr. Kinder liebte er besonders, und für sie hatte er die schönsten Geschichten bereit. Kleine Erlebnisse wußte er phantastisch aufzuputzen, bengalisches Feuerwerk stellte er selber her, er schnitzte Puppenspiele und führte kleine Dramen auf. Aber schon seine Persönlichkeit allein bot den Kindern einen prächtigen Unterhaltungsstoff. Er ging gebückt, hatte scharf geschnittene Züge, wässerige, blaue, kleine Äuglein, eine stark gebogene Hakennase, einen kahlen Schädel, auf dem der unvermeidliche Zylinder feierlich glänzte, um seine wankenden Knie schlotterten die langen Schöße des Schlußrocks, die gelben Hosen steckten in spiegelblank geputzten Stiefeln, die linke Hand saß stets im kanariengelben Lederhandschuh, den Marcellus nur zur Arbeit mit einer vornehmen Geste abstreifte. Wie gesagt: Marcellus konnte alles. Brauchte man irgend etwas im Haushalte – Marcellus brachte es. Allerdings, oft kam es vor, daß ein notwendiges Werkzeug, ein Beil oder eine Säge, in einem Hause abhanden gekommen waren. Das hatte nun der alte Marcellus irgendwohin, wo es benötigt wurde, gebracht. So tauschte er die Güter der verschiedenen Häuser, und gar oft bemerkte ein Bürger zu seinem größten Erstaunen einen ihm gehörigen Gegenstand bei seinem ahnungslosen Nachbar. Aber den alten Marcellus ließ man gerne gewähren. Er war ein nützliches Haustier und eine »ehrliche Haut«.
Ja, ehrlich war Marcellus vor allem. Vielleicht auch ein bißchen zu ehrlich. Geradezu wunderbar war die Veränderung, die mit ihm vorgegangen war. Aus dem jugendlichen Stürmer und geschworenen Feind aller menschlichen Gesetze war ein trockener Pedant geworden, ein starrer »Moralist«, steif gepreßt in die Zwangsjacke der Bürgerlichkeit, ein wandelnder Sittenkodex. Unendlich stolz auf seine patrizischen Vorfahren, hielt er es doch gar nicht unter seiner Würde, anderen zu dienen. Er war auch mehr ein Schutzgeist der Häuser, in denen er einging, als ein Diener. Ja, er vollführte die Aufträge mit einer Würde, als erweise er eine herablassende Gefälligkeit, nahm kleine Geschenke entgegen mit dem Gesichtsausdruck einer orientalischen Majestät, der die Untertanen den Ehrensold überreichen. Von Dank war nie die Rede, man mußte belohnt genug sein, wenn er überhaupt geruhte, das Geschenkte anzunehmen.
Mit der Zeit war es so in seinem Kopfe etwas wunderlich geworden. Er glaubte fest daran, alleiniger Besitzer des Hauses zu sein, in dem er nur gelitten war, und oft ließ er durchblicken, daß der biedere Fleischer es nur seiner, des Marcellus, Güte zu verdanken hatte, wenn er überhaupt noch im Hause saß. Das Haus – ja, das war sein Allerheiligstes. Das böse Gewissen, seine Eltern vielleicht zu früh in den Tod getrieben zu haben, die bittere Reue über ein verfehltes Leben hätten ihn in den rasenden Wahnsinn getrieben, wenn ihm seine Phantasie nicht vorgegaukelt hätte, daß er im Grunde doch ein wohlanständiger Bürger geworden sei im Sinne seiner [... ]