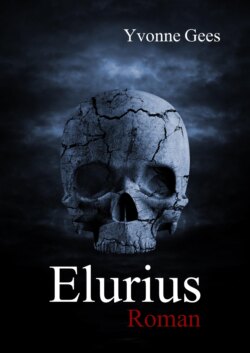Читать книгу Elurius - Yvonne Gees - Страница 3
Оглавление1. Teure Heilung
------- TADEYA SLEYVORN -------
Das Pferd trug sie am vom eisigen Wind aufgewühlten Wasser entlang, durch den feuchten Sand des Strandes. Um die breiten Hufe spülten gurgelnd die Wellen. Tadeya hielt den Blick vom Wasser abgewandt, schaute zur Uferseite hin, die Finger in den wollenen Handschuhen hielten die Zügel. Die Hände waren trotz des Schutzes kalt, die Gelenke steif vom eisigen Wind. Schal und Wintermantel hielten die Kälte nicht von ihrem Körper, der Wind durchdrang sogar die dicke Wolle. Am dämmrig-grauen Himmel trieben zerfetzte Wolkengebilde, die Sonne stand fahl über dem Wasser.
Sie lenkte das schwere Kaltblut, ein Kutschpferd ihrer Großmutter, den sanften Hang zum Ufer hinauf. Dort im Schutz eines herabhängenden Felsens glaubte sie, die Schemen eines darunter kauernden, kleinen Hauses auszumachen. Die Tränen, die der eiskalte Wind in ihre Augen trieb, trübten den Blick. Sie musste blinzeln, um für einen kurzen Moment freie Sicht zu bekommen. Ja, es war keine Sinnestäuschung: Unauffällig, nahe an der Unsichtbarkeit, duckte sich eine graue Hütte unter dem schroffen Gestein. Die Hütte bildete eine Einheit mit dem Felsen und verschmolz fast mit ihm. Einen Moment lang kam es ihr in den Sinn, an die Tür zu klopfen und um Unterschlupf zu bitten. Der Sturm war überraschend hereingebrochen und die Kälte, die er mit sich brachte, war kaum mehr auszuhalten. Doch sie konnte weder Tür noch Fenster entdecken, obwohl sie sich in unmittelbarer Nähe der steinernen Behausung befand. Wohl befand sich der Eingang auf der Rückseite, den Felsen zugewandt.
Doch andererseits: Der größte Teil der Strecke lag bereits hinter ihr. Und wer wusste schon, auf welch merkwürdige Gestalten sie dort drinnen treffen würde? Das Pferd stapfte unverdrossen weiter und die Reiterin ließ das Steinhaus vorüberziehen. Die Hufe des großen, schwerfälligen Falben sackten bei jedem Schritt tief in den nassen Sand, ihm machte diese Erschwernis kaum etwas aus, denn er war stark und ausdauernd. Sein Gemüt glich dem Körper, zäh und unempfindlich.
Tadeya spürte eine plötzliche Unruhe, die von dem Pferd ausging. Durch den massigen Körper fuhr ein leichtes Beben, die Ohren bewegten sich unruhig wie Windspiele. Die stapfenden Schritte verlangsamten sich, der breite Kopf des Tieres neigte sich zur Seite. Die Reiterin richtete den Blick geradeaus, sie sah vor sich nur die graue Weite des Strandes, umspült von Gischt.
Dann ein plötzliches, grelles Leuchten, wie ein Blitzstrahl, direkt über ihr. Das Pferd blieb auf der Stelle stehen und stampfte spritzend mit den Vorderhufen im Schlick. Zu spät schloss sie geblendet die Augen, Lichtpunkte tanzten unter den Lidern. Der nachfolgende Donner blieb aus, um sie herum tobten Wind und Meer wie zuvor. Der Falbe stand wie ein starrer Fels, den Kopf gehoben, die Ohren gespitzt. Erst nach einigen Sekunden öffnete seine Reiterin die Augen und hob den Kopf. Es dauerte noch eine Weile, bis die grellen Lichtflecke auf ihrer Netzhaut zu tanzen aufhörten und die Welt um sie herum so deutlich wie zuvor zu erkennen war. Das Pferd löste sich langsam aus der Starre und zerrte am Zügel, seinen Willen bekundend, diesen Ort schnellstmöglich zu verlassen. Tadeyas Blicke jedoch schweiften umher, sie hielt die Zügel mit festem Griff. Rings um sie hatte sich nichts verändert: Grenzenlos grau war dieser Ort.
Sie wandte den Kopf. Ebenso grau, wie der darüber gebeugte schroffe Fels, lag das kleine Steinhaus hinter ihr. Und viele Meter darüber, oben auf den Felsen, stand eine dunkle Gestalt direkt am Rand der Klippen. Einzelheiten waren nicht zu erkennen, nur eine schwarze Kontur gegen den grauen Himmel. Das Pferd stampfte energisch auf und die Reiterin gab ihm endlich nach.
„Sie ist nicht eben schön“, konnte Tadeya sich nicht verkneifen zu sagen, das fertige Bild betrachtend.
Jesco lachte leise. „Frau Neuberg ist reich, da muss man nicht zusätzlich noch schön sein.“
„Sie sieht aus wie jemand, der sich ständig mit seinem Leben herumärgert“, meinte Tadeya weiter. „Die böse, steile Falte auf der Stirn, die hängenden Mundwinkel...“. „Sie muss sehen, dass das viele Geld zusammenbleibt“ erwiderte Jesco. „Das ist eine schwere Aufgabe.“
Die feinen Pinselstriche betrachtend, die die winzigen, gekräuselten Haarsträhnen an der Schläfe perfekt simulierten, sagte Tadeya: „Aber es ist wirklich schön gemalt. Sie wirkt, als sei sie lebendig.“
In der Tat war das Gemälde von einer bestechenden Detailgenauigkeit, die der Wirklichkeit äußerst nahe kam: Die Dame saß in repräsentativer Haltung, als achtungsgebietende Ehefrau eines großen Unternehmers, auf dem Canapé, das Haar streng gescheitelt und das Kinn selbstbewusst vorgestreckt. Man konnte meinen, dass sie sich jeden Augenblick erheben und mit zielgerichteten Schritten aus dem Bild heraus ins Zimmer treten würde.
Jesco führte den Pinsel mit großer Sorgfalt und Geduld. Seine Beobachtungsgabe war bewundernswert. Und die Art, wie er das Gesehene umsetzte, war kompromisslos ehrlich.
„Dieses Bild“, sagte er jetzt dicht an ihrem Ohr, „wird mich für einige Zeit über Wasser halten. Die Miete für das Atelier ist schon eine Weile fällig. Und jetzt kann ich sie endlich bezahlen.“
Tadeya wandte leicht den Kopf und blickte in sein Gesicht, nur wenige Zentimeter von ihr entfernt. Seine Augen waren so grau wie das Meer dort draußen, das eben noch mit tausend Zungen nach ihr und dem Pferd geleckt hatte. Die Urgewalt des Wassers spiegelte sich in ihnen, auf dem Grund einer starken Seele. Tadeya teilte nicht immer seine Meinung. Sie teilte nicht einmal seinen Glauben, doch sie brachte seiner Lebensauffassung große Achtung entgegen, denn diese war auf ehrlichen Überzeugungen gegründet, die er offen und rückhaltlos vertrat.
„Vielleicht möchte Elisa dir einen Auftrag erteilen“, meinte Tadeya. „Sie ist eine Bewunderin der Kunst und hat bereits einige sehr schöne Gemälde von anderen Künstlern erworben.“
„Deine Großmutter?“ fragte er und hob die Augenbrauen. „Na, dann lerne ich die große Dame vielleicht endlich einmal kennen.“
„Du weißt, dass sie dich vom Scheitel bis zur Sohle prüfen wird“, meinte Tadeya und blinzelte ihm lächelnd zu. „Elisa nimmt ihre Pflichten als meine Ziehmutter sehr ernst.“
„Ich habe keine Angst davor“, erwiderte er ihr. „Auch Elisa ist nur ein Mensch.“
Tadeya streckte den Kopf vor und gab ihm einen warmen Kuss auf die Wange. Dann trat sie einige Schritte zurück und heftete den Blick wieder auf das Gemälde, das auf der Staffelei stand. Die gemalte Dame starrte sie streng von ihrem Canapé aus an. Die nicht eben zierlichen Hände ruhten auf den Armlehnen, auf der Stirn zeichnete sich eine einzige steile Falte ab. Durch das Fenster im Hintergrund des Gemäldes war das Meer zu sehen: stürmische, graue Wellen mit sprühender Gischt.
Unweigerlich lenkte dieser Anblick Tadeyas Gedanken wieder auf ihren Ritt am Strand entlang. Ihr Haar war jetzt noch feucht und zerzaust von dem Unwetter, das um sie herum getobt hatte. Doch durch das Atelierfenster fiel bereits wieder ein freundlicher Sonnenstrahl, der auf den Parkettboden einen länglichen Lichtspalt zeichnete.
Ein Lichtblitz ohne Donner – und eine Gestalt auf den Klippen. Sie sah das Bild wieder deutlich vor sich: Die schwarze Gestalt eines Menschen, die sich vor dem grauen Himmel abzeichnete, dem Sturm entgegengebeugt. Das Gefühl, das diese Erinnerung in ihr wachrief, war Beklemmung.
Draußen wurde die Türglocke geläutet und Tadeya bemühte sich, den Strom ihrer unheilvollen Gedanken zu durchbrechen und in die Gegenwart zurückzukehren. „Frau Neuberg“, sagte Jesco und ging, um zu öffnen. Die Dame befand sich in Begleitung eines Bediensteten, der offensichtlich ihre Neuerwerbung für sie transportieren sollte. Das Atelier war in dem Moment, als sie die Schwelle überschritt, von ihrer harten Präsenz erfüllt. Die dunkle, herbe Stimme passte perfekt zu ihrem grobknochigen, breitschultrigen Körper in dem schwarzen, strengen Kleid.
„Ich bin gespannt auf Ihr Werk, Herr Fey. Ich durfte es zuletzt im frühen Anfangsstadium bewundern.“ Erhobene Augenbrauen, ein langer, durchdringender Blick in Richtung Tadeya. Die Gedanken waren klar: Wer ist diese ungepflegte Person? Frau Neuberg war ohne Frage mit der Kutsche hergekommen, von Haustür zu Haustür geleitet durch ihren diensteifrigen Begleiter. Der Wind hatte nur für wenige Sekunden Zugriff auf ihr sorgfältig hochgestecktes Haar gehabt. Tadeya war im Gegensatz dazu direkt durch den Sturm geritten, und sie bot sicherlich ein dementsprechendes Bild.
Der skeptische Blick der Dame schien Jesco nicht im geringsten peinlich zu sein. Ohne sich irgendetwas anmerken zu lassen, stellte er sie in knappen Worten einander vor. "Frau Neuberg. Tadeya Sleyvorn, Enkelin von Elisa Sleyvorn."
Gleich darauf lenkte er die Aufmerksamkeit direkt auf das bereitstehende Gemälde. „Dort steht das fertige Bild. Der Firnis ist noch etwas frisch, aus dem Grund sollte man es nicht...“
Doch Frau Neuberg ließ ihn nicht zu Ende reden. „Oh“, entfuhr es ihr. Und dieser Ton klang nicht eben erfreut.
„Ist etwas nicht...?“ begann Jesco, wurde aber gleich darauf abermals unterbrochen.
„Was für ein Affront!“ rief Frau Neuberg aus und ihre Stimme rutschte dabei einige Tonlagen höher. Aus dem von Natur aus herben Klang wurde plötzlich gallige Bitterkeit.
„Wie bitte?“ fragte Jesco, den Blick unverwandt auf ihr Gesicht gerichtet. Auf der Stirn der Dame vertiefte sich die bereits im Bilde von Tadeya bewunderte, steile Falte zwischen den Augenbrauen. „Dieses alte Weib dort,“, herrschte sie ihn an, „bin nicht ich!“
Jesco schüttelte beharrlich den Kopf. „Frau Neuberg, ich habe nach der Natur gemalt.“ Natürlich besaß diese Antwort nicht eben eine besänftigende Wirkung, obwohl Tadeya sich sicher war, dass sie auf purer Unschuld gründete. Und er hatte Recht: Dieses Bild glich der Wirklichkeit wie ein Spiegelbild. Frau Neuberg schnappte hörbar nach Luft. Sie wandte sich mit einer Geschwindigkeit, die man ihrem schweren Körper gar nicht zugetraut hätte, zu ihrem Begleiter um.
„Solch eine Unverschämtheit ist mir noch nie vorgekommen! Edward, Sie sind hiermit mein Zeuge! Dieses Bild stellt einen Affront dar!“
Der Angesprochene nahm eine geduckte Haltung ein, den Blick fest auf die Erde gerichtet. Sein eifriges Nicken zeigte eher Unterwürfigkeit als ehrliche Zustimmung. Doch Frau Neuberg schien diesen Umstand nicht zu bemerken, denn hochmütig fixierte sie nun Jesco. „Ich habe einmal viel von Ihnen gehalten, Herr Fey“, erklärte sie ihm voll Bitterkeit. „Aber nun muss ich meine Ansichten über Sie als Mensch und Künstler korrigieren: Sie sind ein Dilettant und Sie besitzen keinerlei Respekt!“
Jesco klang erstaunlich ruhig, als er erwiderte: „Frau Neuberg, niemals lag es in meiner Absicht, Sie zu kränken.“ Nur Tadeya sah den Sturm in Jescos Augen hinter der gefassten Fassade.
Frau Neuberg ließ sich erwartungsgemäß durch seine Worte nicht besänftigen. „Diese böswillige Karikatur werde ich nicht bezahlen! Von Rechts wegen sind Sie mir Geld schuldig, weil ich meine Zeit damit vergeudet habe, Ihnen Modell zu sitzen! Sie Stümper!“
Die letzten beiden Worte stieß die Dame zwischen zusammengepressten Lippen hervor, sodass sie wie ein zorniger Fluch klangen. Dann winkte sie ihrem Begleiter mit harter Geste, ihr zur Tür hinaus zu folgen. Tadeyas Blick blieb kurz auf Jescos Gesicht haften, als der eifrige Diener hastig die Tür hinter der davoneilenden Dame zuschlug. Dann lief Tadeya den beiden hinterher und stürmte die Treppe hinunter auf die Straße. Frau Neuberg war gerade dabei, sich von ihrem Diener in die vor der Tür stehende Kutsche helfen zu lassen, als Tadeya sie erreichte.
„Hören Sie, Frau Neuberg“, sagte Tadeya zu der Dame, die mit einem skeptischen Stirnrunzeln in ihrer Bewegung innehielt. „Der Maler hat seinen Auftrag mit Bravour erfüllt. Sie sind ihm die Bezahlung schuldig. Und wenn Ihnen das Bild nicht gefällt, dann werfen Sie doch bitte einen Blick in den Spiegel. Ihr Auftrag an den Maler war ein realistisches Porträt – und das haben Sie erhalten!“
Mit energischer Geste wischte die Dame Tadeyas Worte fort. Nicht einmal zu einer Antwort fühlte sie sich bemüßigt, sondern nur zu einem herablassenden Blick und der spitzen Bemerkung: „Sie sind doch die Enkelin von dieser Zigeunerhexe. Von solch einem Pack muss ich mir nun wirklich nichts sagen lassen!"
Tadeyas Haltung straffte sich. Ihr Inneres, eben noch voll heißer Erregung, erkaltete schlagartig. Ein kühler Fluss klarer Gedanken blieb übrig, der innerhalb der Zeit eines Lidschlags eine Entscheidung hervorbrachte. Sie hob die Hand nur wenige Zentimeter der empörten Dame entgegen. Und drei leise Worte kamen über ihre Lippen. Mehr bedurfte es nicht.
Tadeya machte auf dem Absatz kehrt und überließ Frau Neuberg ihrem Schicksal.
------- HEINRICH NEUBERG -------
Es kostete einige Überwindung, dieses Haus zu betreten. Bevor er einen ersten Schritt auf die Eingangstreppe setzte, warf er einen Blick über die Schulter. Keine Bekannten, die ihn hierbei beobachteten?
Die Straße war leer. Es handelte sich ohnehin nicht gerade um eine belebte Gegend. Stadtrandgebiet, spärlich bebaut. Hier hatte die alte Hexe schon vor vielen Jahren ihr Domizil errichtet. Eine zugegebenermaßen prächtige, kleine Villa, erbaut von einer völlig indiskutablen Frau in einem Bezirk, der als Wohnort für wirklich feine Leute nicht infrage käme.
Auf Knien zu kriechen vor dieser alten Hexe lag ihm fern, er wollte ihr mit Entschlossenheit entgegentreten. Er zog an der Glocke, die ein ohrenbetäubendes Läuten von sich gab. Man musste dieses Ungetüm bis in den hintersten Winkel des Hauses hinein vernehmen!
Doch es dauerte eine ganze Weile, bis jemand das mit zahlreichen Eisenbeschlägen besetzte, beinah festungsähnliche Eingangstor öffnete. Heinrich Neuberg war bekannt, dass Elisa über keine Dienstboten verfügte, die für sie zur Tür eilen konnten. Deshalb machte er sich auf eine gewisse Wartezeit gefasst. Bevor die Tür sich öffnete, hörte man das Geräusch von schweren Riegeln, die im Inneren zurückgeschoben wurden und das Knarren eines alten Schlosses, in dem sich ein Schlüssel drehte. Dann erschien Elisa auf der Schwelle.
Sie war eine groß gewachsene Frau mit langem, offenen Haar von schneeweißer Farbe. Vor vielen Jahren noch hatte das Haar dieselbe Farbe besessen wie die pechschwarze Iris der Augen. Die Gesichtshaut wies zahlreiche Falten auf, doch die Lippen waren jugendlich voll und die Wangen leicht gerötet. Das schmale, feine Gesicht, strahlte Leben aus und ließ keinesfalls einen nahenden Tod erahnen. Der Blick war ruhig und fest auf Heinrich Neuberg gerichtet. Die Frau schwieg und erwartete wohl, dass ihr Gegenüber das Wort eröffnete.
Heinrich Neuberg entschied sich für eine höfliche Begrüßung, obwohl ihm innerlich nicht wirklich nach Höflichkeit war. Doch die jüngsten Ereignisse hatten ihm wieder einmal gezeigt, wie sehr man sich vor dieser Zigeunersippe in acht nehmen musste. Ein falsches Wort konnte bei diesem Pack zum Verhängnis führen.
„Guten Tag Frau Sleyvorn. Ich freue mich, dass ich Sie daheim antreffe.“
Sie reichte ihm mit einem angedeuteten Kopfnicken die Hand zur Begrüßung. Die Frau besaß außergewöhnlich lange, schmale Finger, die Heinrich nicht gerne berührte. Aber er würde in diesem Fall wohl nicht darum herumkommen.
Der Händedruck war kühl.
Ein Ring mit einem großen, roten Stein funkelte an ihrem Finger. Ein echter Rubin war es sicherlich nicht, den sie trug. Die Farbe erschien Heinrich ein wenig zu dunkel. Mit einer Geste wies Elisa ihn an, hereinzukommen.
Heinrich setzte zum ersten Mal in seinem Leben einen Fuß über die Schwelle dieses Hauses. Gerüchteweise war ihm bereits zu Ohren gekommen, was einen Besucher hier erwartete. Von außen gab allein das Eingangstor einen Hinweis darauf, welche Kapriolen bei der Inneneinrichtung zu erwarten waren.
Die unverkleideten Wände gaben den Blick auf kahlen Sandstein frei. Ein merkwürdiges Sammelsurium von Gegenständen lag auf schmiedeeisernen Regalen, die meisten Dinge schienen recht alt und besaßen ein entsprechendes Aussehen: Rost, Risse und Staub sprangen Heinrich ins Auge. Eine aus grobem Räderwerk bestehende Uhr ohne Gehäuse gab ein lautes, gleichmäßiges Ticken von sich. Rechts von der Uhr lag etwas, das aussah, wie ein mittelalterlicher Dolch. Daneben wiederum erhaschte Heinrich einen Blick auf einen mit verblasstem Garn bestickten Handschuh. Er fühlte sich gedrängt, der vorauseilenden Hauseigentümerin in das angrenzende Zimmer zu folgen, welches keinesfalls gemütlicher war. Die an den Wänden angebrachten, antiquarischen Konsolen trugen hier flackernde Öllampen. Das Fenster war mit schwerem Tuch verhangen, die Sitzgelegenheiten aus blankem Holz gefertigt. Auf rustikalen Regalen stapelten sich Unmengen antiquarischer Bücher.
Heinrich wurde Platz angeboten auf einem Sessel, der hart war wie eine Folterbank. Elisa nahm ihm gegenüber Platz auf einem knarrenden Holzstuhl, der vor Jahrhunderten bessere Zeiten gesehen haben mochte. Sie bot ihm weder etwas zu trinken, noch einen kleinen Imbiss an.
Heinrich hatte sich vorgenommen, sogleich mit der Sprache herauszurücken. Was nützte es schon, die Angelegenheit auf die lange Bank zu schieben? Dadurch würde die Sache auch nicht erfreulicher. „Frau Sleyvorn, meine Frau ist schwer erkrankt. Und wir können uns des Verdachtes nicht erwehren, dass Ihre Enkelin damit etwas zu tun hat.“
Elisa verzog keine Miene. Die dunklen Augen hafteten stumm auf dem Gesicht ihres Besuchers, sodass dieser unruhig hin und her zu rutschen begann. Dies war alles Andere, als die angenehmste Mission seines Lebens. Tapfer führte Heinrich seinen Verdacht weiter aus, obwohl seine Handflächen spürbar feucht wurden. „Ihre Enkelin ist mit meiner Frau in Streit geraten. Das Mädchen hat sich in eine ungerechtfertigte Wut gesteigert.“
Elisa hob stumm die Brauen, die im Gegensatz zum weiß gewordenen Haupthaar noch ganz schwarz waren.
„Sie wissen, worauf ich hinaus will“, setzte Heinrich hinzu und zwang sich, den festen Blick der Frau zu erwidern. „Meine Frau war nie zuvor krank“, erklärte er weiter. „Sie hat eine sehr robuste Natur. Doch nachdem das Mädchen seine Hand erhoben und diese merkwürdigen Worte gesagt hat, ging es ihr von Minute zu Minute schlechter. Es ist nicht das erst mal, dass derartige Dinge im Umkreis Ihrer Familie vorfallen. Darum wissen meine Frau und ich genau, dass die ganze Sache keine Einbildung ist.“
Elisa lehnte sich in ihrem knarrenden Stuhl vor. „Und?“ fragte sie mit ihrer tiefen, ruhigen Stimme.
„Was, und?“ fragte Heinrich irritiert zurück.
„Was erhoffen Sie sich nun hier, bei mir?“
„Frau Sleyvorn, meiner Frau geht es wirklich äußerst schlecht. Der Doktor kann ihr nicht helfen, und wenn es weiter mit ihr bergab geht, dann ist sie in wenigen Tagen tot.“ Er machte eine Pause, währenddessen er die Schultern straffte und sich darauf konzentrierte, den Blick anzuwenden, mit dem er üblicherweise seinen Geschäftspartnern gegenübertrat. „Es liegt nicht im Gutdünken Ihrer Enkelin, Todesurteile auszusprechen. Niemand hat das Recht, so etwas zu tun.“
Elisa lehnte sich wieder in ihren Stuhl zurück und strich sich mit der schmalen Hand durch das weiße Haar. Wieder fiel Heinrichs Blick auf den Ring mit dem roten Stein, der im Licht der Lampen funkelte. Nach einer Weile des Schweigens sagte sie, ohne jegliche Erregung in der Stimme: „Glauben Sie tatsächlich, dass ein Todesurteil durch ein paar gesprochene Worte vollstreckt werden kann? Hängen Sie diesem Aberglauben an?“ Sie schenkte ihm einen langen, düsteren Blick.
Natürlich traf diese Hexe damit Heinrichs wunden Punkt. Keinesfalls wollte er als abergläubischer Spinner abgestempelt werden. „Nein, Frau Sleyvorn“, widersprach er ihr deshalb. „Ich bin nicht abergläubisch. Ich bin ein moderner Mensch, der glaubt, was er sieht. Und von Ihrer Sippe habe ich bereits mehr als genug gesehen.“
Um Elisas Mundwinkel spielte ein kleines, amüsiertes Lächeln.
„Es tut mir leid, Frau Sleyvorn“, betonte Heinrich. „Ich lasse mich davon nicht abbringen: Was meine Frau und ich gesehen haben, das haben wir gesehen. Unsere Schlussfolgerungen sind eindeutig und Sie können mich nicht von meiner Meinung abbringen.“
Obwohl Heinrich innerlich bebte, blieb er nach außen hart wie ein Fels. Man konnte wahrlich nicht behaupten, dass ihm die Liebe zu seiner Frau eine solche Kraft verlieh, dass er über seine Angst, sich vollkommen lächerlich zu machen, hinwegsehen konnte. Er liebte seine Frau nicht. Er war einfach ein Mann mit Prinzipien.
„Warum“, fragte Elisa leise, „wenden Sie sich mit dieser Geschichte an mich?“
„Weil Sie die Sache rückgängig machen sollen, natürlich“, erwiderte ihr Heinrich. „Dieses trotzige Kind würde doch sicher keinen Finger rühren...“
Elisa wiegte leicht den Kopf hin und her. „Wissen Sie, Herr Neuberg,“, sagt sie, „ich würde Ihnen wohl kaum helfen wollen, selbst, wenn Ihre verrückte Geschichte wahr wäre. Tadeya ist längst kein Kind mehr und es widerstrebt mir zutiefst, mich in ihre Angelegenheiten einzumischen.“
Heinrich fuhr daraufhin aus seinem Sessel hoch. Stockgerade stand er dort, vor seiner Gastgeberin, und blickte auf die alte Frau herab.
„Was Sie sagen, ist kalt und gefühllos“, gab er zurück. „Aber es wundert mich nicht, das entspricht ganz dem Handeln Ihrer Enkeltochter. Hätte ich dieselbe Fähigkeit, wie dieses Mädchen, dann würde ich Sie verfluchten, Frau Sleyvorn, glauben Sie mir. Und Sie würden elendiger dahinsiechen, als meine Frau!“
Elisa hob den Kopf. Das Lächeln war von ihren Lippen verschwunden.
Das Blut rauschte in Heinrichs Schläfen und er wusste genau, dass sein Kopf feuerrot geworden war. Doch sein hauptsächliches Gefühl war nicht der Zorn, sondern die Angst. Er sah sein endgültiges Schicksal mit großen Schritten herbeieilen.
Auch Elisa stand nun aus ihrem Stuhl auf, jedoch viel langsamer, als Heinrich es zuvor getan hatte. „Herr Neuberg“, antwortete sie ihm mit ihrer tiefen Stimme. „Sie besitzen mehr Mut, als ich dachte. Und Mut ist eine Eigenschaft, die ich zu schätzen weiß.“
„Werden Sie nun meiner Frau helfen oder nicht?“ war Heinrichs herausfordernde Frage. Zu verlieren hatte er sowieso nichts mehr.
Sie schüttelte als Antwort nur den Kopf.
Heinrich verharrte mit gestrafften Schultern in seiner Position. Er hatte keine Ahnung, was er noch sagen konnte, um diese Hexe zu überzeugen. Sie hatte die Macht über Leben und Tod in der Hand und er konnte nur noch um ihre Hilfe betteln. Doch zu betteln verbot sich ihm von selbst.
„Wenn Sie noch mehr von Ihrem Mut auf Lager haben,“, begann Elisa, „dann mache ich Ihnen einen Vorschlag.“ Sie trat einen Schritt auf ihn zu und zog die Brauen zusammen, um ihn auf diese Weise zu fixieren. „Fahren Sie nicht mit Ihrer Kutsche zurück,“, sagte sie, „sondern schicken Sie den Kutscher allein nachhause und gehen zu Fuß über den Strand. Wenn Sie dort einen Fremden treffen, dann sprechen Sie mit ihm. Es ist gut möglich, dass er Sie abweist. Aber vielleicht ist es einen Versuch wert.“
Heinrich drängte sich der Gedanke auf, dass Elisa ihn nur mit einer billigen Ausrede fortschicken wollte. Dieser Vorschlag klang verdächtig an den Haaren herbeigezogen. Doch was blieb ihm anderes übrig, als zu tun, was sie ihm riet? Er konnte schließlich nicht zur Polizei gehen und Elisa in Erzwingungshaft nehmen lassen. Man würde ihn nicht nur auf der Wache, sondern zusätzlich in der gesamten Region auslachen. Man würde sagen, Heinrich Neuberg sei verrückt geworden über das schwere Schicksal seiner Frau.
Eines nahm er sich fest vor: Wenn er den seltsamen Fremden am Strand nicht träfe, dann käme er hierher zurück, zu Elisa Sleyvorn. Und er würde dieser Frau keine Sekunde mehr von der Seite weichen, bis sie schließlich nachgab. Und wenn er sich dafür in ihrem Haus fest ketten musste!
So schickte er den Kutscher fort und machte sich auf den Weg hinunter zum Strand. Das Wetter bot sich nicht eben für einen Strandspaziergang an. Der Sturm, der über zwei Tage hinweg getobt hatte, hatte sich zwar etwas gelegt, doch von Windstille konnte keine Rede sein. Außerdem war es eiskalt und ein feiner Nieselregen durchnässte nach und nach seinen Mantel. Graue Wellen krochen gurgelnd den Strand hinauf, um sich gleich darauf wieder zurückzuziehen. Heinrichs Stiefel sackten bei jedem Schritt in den nassen Sand ein, sodass er nur sehr mühsam vorwärtskam.
Er hob den Kopf und blickte zu den schwarzen Klippen hinauf. Dieser Strand war nichts weiter als ein schmaler Sandstreifen zwischen Meer und Fels. Nur selten waren hier um diese Jahreszeit Menschen anzutreffen und auch im Sommer führte es nur sehr vereinzelte Spaziergänger her. Ein solch ungastlicher Ort wie dieser, fand Heinrich, wurde zu Recht gemieden.
Er wandte den Blick von den kahlen Felsen ab und zog fröstelnd die Schultern zusammen. Die alte Hexe saß jetzt sicher auf ihrem harten Folterstuhl und lachte sich ins Fäustchen über seine Dummheit. Und er würde bei der ganzen Sache nichts als klamme, feuchte Kleidung ernten - und vielleicht eine daraus resultierende Lungenentzündung. Na, auf diese Weise würde es dieser Zigeunersippe vielleicht sogar gelingen, ihn gemeinsam mit seiner Frau das Zeitliche segnen zu lassen.
Grau, kalt und vor allem leer war dieser Ort.
Trotz seiner Überzeugung, dass man ihn hereingelegt hatte, schaute Heinrich sich aufmerksam um. Wenn es auch nur einen winzigen Hoffnungsfunken gab, dass diese Frau die Wahrheit sagte, dann wollte er sich daran klammern. Was blieb ihm auch sonst übrig?
Plötzlich sah er eine graue Hütte, die wie aus dem Felsen gehauen unter den Klippen kauerte. Dieser Anblick schien ihm ungewöhnlich genug, um die Sache genauer zu untersuchen. Heinrich ging geradewegs auf die Hütte zu, die zur Vorderseite hin weder Fenster noch Tür aufwies. Das Dach war flach und bestand ebenfalls aus Stein. Er bewegte sich um das Haus herum und entdeckte an der Seite eine schmale, graue Tür mit augenscheinlich neuen, metallisch glänzenden Beschlägen. Auch hier war kein Fenster zu sehen, nur eine massive Steinwand. Nirgendwo eine Möglichkeit, in die Hütte hinein zu sehen.
Heinrich wandte sich um, ging zurück zu der Tür und klopfte dort entschlossen an. Die Fäustlinge ließen sein Klopfen dumpf ertönen, doch es war weitaus laut genug, um dort drinnen gehört zu werden. Er lauschte, hörte aber nur das Heulen des Sturms zwischen den Felsspalten. Eine Bö riss kräftig an seiner Mütze und ließ ihn erschauern. Auch nach wiederholtem Klopfen regte sich nichts in der Hütte, die Tür blieb geschlossen.
„He!“ rief Heinrich nun laut. „He! Jemand zuhause?“
Keine Antwort.
Er griff nach der Türklinke, um zu probieren, ob die Tür wirklich verschlossen war. Doch auch das Rütteln an der Klinke blieb erfolglos. Fröstelnd legte er die Arme um seinen Oberkörper und dachte einen Moment lang nach: Hatte es einen Sinn, hier vor der Tür zu warten, bis der Bewohner der Hütte eventuell noch nachhause käme? Hinter der Hütte war es windgeschützt, dort ließ es sich sicher besser eine Weile aushalten. Als er sich umdrehte, musste er feststellen, dass das Warten nicht mehr nötig war. Die schwarzen Augen, die ihn mit beklemmender Intensität musterten, waren wie ein deja vu für ihn. Es schien Heinrich im ersten Moment, als stände die alte Hexe wieder vor ihm.
Jedoch das Gesicht war das eines Mannes, in dem Heinrich die Feinheit von Elisas Zügen wiederzuerkennen glaubte. Der vor ihm stehende Mann war einige Jahre jünger als er selbst, vielleicht nicht einmal dreißig. Und doch besaß er eine derart intensive Ausstrahlung, dass Heinrich im ersten Moment kein Wort herausbrachte. Es war ihm, als sei er ohne Erlaubnis in ein fremdes Haus eingedrungen und dabei ertappt worden. Der finstere Blick, der so unverhohlen auf ihn gerichtet war, beraubte ihn für einige Augenblicke völlig seines rationalen Denkvermögens.
Erst nach einer Weile brachte Heinrich, über seine eigene Reaktion verärgert, mühsam einige Worte über die Lippen. „Ich... bin ... hergeschickt worden von ... Frau Sleyvorn...“
Der düstere Ausdruck seines Gegenübers veränderte sich um keine Nuance. Heinrich wäre am liebsten einen Schritt zurückgetreten, da er sich in der Nähe dieses Mannes äußerst unbehaglich fühlte. Doch hinter ihm befand sich die Tür der Hütte, sodass es keine Ausweichmöglichkeit gab.
„Frau Sleyvorn“, wiederholte der Fremde und hob den Kopf ein wenig an, ohne jedoch den Blick von Heinrich abzuwenden. „Warum schickt sie Sie?“
Heinrich straffte die Schultern und bemühte sich, seine völlig unangebrachte Verwirrung abzuschütteln. Mit noch immer ein wenig belegter Stimme fragte er: „Sie kennen Frau Sleyvorn?“
Die Antwort war ein Kopfnicken.
Also war er hier wohl an der richtigen Adresse, dachte sich Heinrich. Den fremden Mann am Strand hatte Elisa Sleyvorn sich nicht einfach ausgedacht. Fraglich schien nun nur noch, ob dieser tatsächlich eine Hilfe für ihn und seine Frau bedeutete. Offensichtlich gehörte der Fremde ebenfalls dieser Zigeunersippe an, von der er kein entgegenkommendes Verhalten gewohnt war. Heinrich räusperte sich, um sich von dem Knoten in seinem Hals zu befreien. „Frau Sleyvorn war der Ansicht, dass Sie mir vielleicht helfen könnten“, sagte er.
„Interessant“, erwiderte der Fremde, ohne eine Miene zu verziehen. „Wobei?“
Heinrich stellte sich breitbeinig hin, bemüht, den Blick seines Gegenübers trotz der dadurch verursachten Unbehaglichkeit fest zu erwidern. „Meine Frau ist sehr krank“, erklärte er, entschlossen, sogleich alle Fakten auf den Tisch zu legen. „Und ich bin der festen Ansicht, dass Frau Sleyvorns Enkelin diese Krankheit ausgelöst hat. Doch Elisa Sleyvorn ist nicht gewillt, die Sache rückgängig zu machen, sondern sie hat mich an Sie verwiesen.“
Auf den Lippen des Fremden zeichnete sich bei diesen Worten ein leichtes Lächeln ab, das die starre Miene für einige Momente durchbrach. Heinrich war die Belustigung seines Gegenübers alles andere als recht. Doch war er andererseits froh, einen Anflug von Gefühl im Gesicht des Fremden zu erkennen.
„Können Sie ... können Sie mir helfen?“ fragte Heinrich, ärgerlich über die Unsicherheit in seiner Stimme.
„Wohl ja“, erwiderte der fremde Mann, dessen Gesichtsausdruck im selben Augenblick wieder gefror.
„Ja?“ wiederholte Heinrich nicht wenig überrascht. „Sie sagen ja?“
„Ja“, bestätigte sein Gegenüber nochmals. „Aber können Sie sich das leisten?“
„Wie bitte?“
„Sie müssen mir schon einen Grund geben, warum ich Ihrer Frau helfen soll. Mir persönlich liegt nichts an ihr.“
Heinrich beschlich das düstere Gefühl, dass sich hier jemand vielleicht nur bereichern wollte, ohne sein Versprechen auf Hilfe einlösen zu können. Er als Geschäftsmann musste ständig auf der Hut sein vor solchen Betrügern, die ihre ehrlichen Mitbürger nur bestehlen wollten. Er reckte sich, blickte dem fremden Mann nun fest in die Augen. „Ich werde Sie nur dann bezahlen, wenn Sie unter Beweis gestellt haben, dass es Ihnen tatsächlich möglich ist, meine Frau zu heilen. Das heißt also nach getaner Arbeit. Welchen Preis verlangen Sie?“
Statt eine Antwort zu geben, fragte der Fremde: „Wie ist Ihr Name?“
„Heinrich Neuberg“, stellte Heinrich sich vor und hätte dem Mann beinah im Zuge eines Automatismus die Hand gereicht. Doch er konnte sich im letzten Moment zügeln: Es reichte ihm, dass er heute bereits den unangenehmen Händedruck einer Vertreterin dieses Zigeunerpacks zu spüren bekommen hatte. „Und mit wem habe ich das Vergnügen?“
„Adlam“, war die Antwort. „Und mein Preis liegt genau an der Grenze Ihrer Liquidität: alles, was Sie bis heute Abend flüssigmachen können.“
Nun war es an Heinrich, amüsiert den Kopf zu schütteln: „Bescheiden sind Sie gerade nicht, Herr Adlam“, meinte er. „Aber ich werde sehen, was sich machen lässt.“
Dieser Adlam war ein erstaunlicher Dummkopf. Mit dieser Forderung überließ er es Heinrich, jede beliebige Summe zu bezahlen. Und Heinrich seinerseits würde sich sicherlich nicht darin verausgaben, so viel Bargeld wie irgend möglich herbeizuschaffen.
„Sie werden doch nicht versuchen, mich zu betrügen?“ fragte Herr Adlam und zog dabei die Augenbrauen leicht hoch.
Heinrich fühlte sich in seinen Gedanken ertappt, obwohl die Frage reichlich naiv klang. Doch der Ausdruck im Gesicht seines Gegenübers schien ihm alles andere als naiv. Vielleicht eher eine Spur hinterhältig? Es war sicherlich nötig, auf der Hut vor diesem Mann zu sein, ebenso, wie man vor den Sleyvorns auf der Hut sein musste. Heinrich gab ein angewidertes Schnaufen von sich: Er hasste nichts mehr als undurchsichtige Geschäftspartner. Ob es sich hier um einen Dummkopf oder einen dreisten Betrüger handelte, würde sich, wie in der Vielzahl der Fälle, wohl doch erst am Ende herausstellen.
Herr Adlam zog einen Schlüssel aus seiner Manteltasche und gab Heinrich mit einer Geste zu verstehen, ihm den Weg zur Tür frei zu geben. Heinrich jedoch blieb stehen und erkundigte sich: „Wann darf ich mit Ihnen rechnen?“
"Um sieben", war die Antwort.
"Sie finden mein Haus an der Dorfhauptstraße von Hellhus. Es ist nicht zu übersehen: ein großes Anwesen mit einem Eisentor."
Nun machte Heinrich einen Schritt zur Seite. "Bis heute Abend, dann", meinte er, wandte sich um und ging fort.
Der neue Weg
Seit jeher war ich darauf bedacht, die außerordentlich wenigen Menschen aus der großen Masse herauszulesen, in denen noch heute die Kräfte wohnen, die unserer Spezies im Laufe der Jahrtausende immer mehr verloren gingen. An allen Enden der Erde habe ich sie gesucht und ihnen Gelegenheit gegeben, ihre Begabung unter meiner Obhut zu entfalten, fern vom äußeren Druck des gesellschaftlichen Umfeldes. Ihre durch meine Förderung entfalteten Kräfte machte ich mir zunutze, um meine eigenen Ziele voranzutreiben.
Meine Schützlinge banden sich stets für ihr gesamtes Leben an mich -ihre Leben jedoch währten zumeist nicht lange. Am Anfang geschah es häufig, dass sie im Laufe eines für sie zu kräftezehrenden Rituals den Tod fanden. Später legte ich manches Mal selbst Hand an und opferte sie einem höheren Zweck. Außer ihnen scharte ich zusätzlich einen Kreis Helfer um mich, die für die Erfüllung profaner Aufgaben nützlich waren, sonst aber kaum einen Wert besaßen.
Zunutze machte ich mir auch die kostbaren Bücher und Schriften, die ich im Laufe vieler Jahre zusammentrug. Ich sammelte das Wissen von unzählbaren Generationen und setzte es unumwunden in die Tat um. Mein Ziel ist es, mir alle nur erdenklichen Kräfte nutzbar zu machen, die die Natur in sich birgt. Ich setze mir selbst keinerlei Grenzen und habe dadurch die Freiheit erlangt, zu tun, was auch immer ich gerade für nötig halte.
Einstmals, vor sehr vielen Jahren,, habe ich in einer bürgerlichen Welt nach den Gesetzen der sogenannten zivilisierten Gesellschaft über Gut und Böse gerichtet. Doch schon seit langer Zeit bin ich nun mein eigenes Gesetz.
Gut und Böse existieren dort nicht mehr.
Ich habe mich befreit von den beengenden Grenzen der Moral, des Mitleids, des schlechten Gewissens. Die Menschen haben sich selbst ihr Gefängnis geschaffen, ihre eigene Freiheit beschnitten. Ich aber habe den Käfig der einengenden Moral gesprengt und bin, ohne das geringste Bedauern, meinen eigenen Weg gegangen.
Und heute stehe ich an einem wichtigen Scheidepunkt, vielleicht der wichtigste überhaupt in meinem bereits sehr langen Leben: Diejenigen Gaben der Natur, welche meine mir zur Seite stehenden Schüler auszeichnen, sind allzu spärlich gesät. In all den Jahren habe ich niemals jemanden gefunden, der meinen höchsten Ansprüchen auch nur annähernd gerecht wird. Zum Auffinden jedes einzelnen meiner kurzzeitigen Begleiter ist eine zeitraubende Suche vonnöten gewesen. Und jedes mal von Neuem folgte eine ermüdende Zeit der Ausbildung, die am Ende doch nie das Ergebnis brachte, das ich mir gewünscht hätte.
Ich brauche einen stärkeren, fähigeren Menschen an meiner Seite. Jemanden, dem von Geburt an diejenigen Anlagen mitgegeben sind, die es ihm ermöglichen, mir irgendwann einmal zumindest ebenbürtig zu werden. Gemeinsam mit einem solchen Menschen wäre es nach Jahren des Beinah-Stillstandes endlich wieder möglich, einen großen Schritt nach vorne zu unternehmen. Ich habe Pläne für die Zukunft, die zu erfüllen es weit mehr braucht, als das, was ich in meinen bisherigen Getreuen gefunden habe.
Doch meine intensive Suche nach jemanden, der den Platz an meiner Seite wahrhaft ehrenvoll ausfüllen wird, ist bisher erfolglos geblieben. Sollte ich der einzige Mensch in diesem Erdenkreis sein, dem es gegeben ist, alles bisher da Gewesene hinter sich zu lassen und eine wirkliche Revolution hervorzurufen?
Wenn ich also in dieser Welt niemanden finden kann, der meinen Vorstellungen entspricht und der in der Lage ist, meinen Weg mit mir gemeinsam zu beschreiten: Was hält mich davon ab, mir selbst einen Schüler zu schaffen, der der Mühe wahrhaft wert ist? Ich besitze das Wissen und die Macht dazu. Und was am wichtigsten ist: Ich habe die Freiheit.
Ich kann schaffen, was die Natur nicht mehr zu schaffen in der Lage ist:
Das alte Erbe aus längst vergangenen Zeiten lebt noch immer weiter, tief verborgen in jedem Menschen. Man muss es nur erwecken und in die richtige Bahn lenken. Was degeneriert ist, kann zu alter Stärke zurückgeführt werden. Was fehlt, das wird vervollständigt.
Ich habe beschlossen, den Kreis eigenhändig zu schließen: In einem Menschen der Gegenwart wird die Stärke unserer altvordersten Ahnen wieder erweckt werden. Ich selbst war einst ein Produkt des Zufalls, ein zufälliges Erzeugnis der chaotischen Natur. Doch was, wenn man den Zufall lenken könnte, mit dem Ziel, die Menschheit nach Jahrtausenden der Devolution wieder zu ihren Wurzeln zurückzuführen? Ein Geschlecht aus wahren Herrschern der Schöpfung könnte entstehen! Die Schicksalsgebundenheit gesprengt durch meine Hand!
------- ELISA SLEYVORN -------
Das flackernde Licht der Fackel zeichnete bewegte Schatten auf die zerklüfteten Felswände. Wasser tropfte von den feuchten Steinen, hinterließ überall Pfützen auf dem Boden. Jeder Tropfen entfachte eine Kette hallender Echos, wenn er die Oberfläche eines der kleinen Seen durchbrach und mit ihm verschmolz. Es war das Wasser, dessen beständige Kraft diese Höhle im Laufe Tausender von Jahren geformt hatte. Das Wasser war auch heute noch Herrscher über das dunkle, schroffe Loch im Felsen, direkt am Meer. So manches Mal ergriff es tosend Besitz von der Höhle, durchspülte sie in peitschenden Wellen und füllte sie schließlich restlos aus.
Der Hall von Elisas Schritten mischte sich wie ein harter Rhythmus unter das Heulen des Windes und den Klang der tausendfachen Tropfen. Das Haar und die Schultern hatte sie mit einem weißen Tuch verhüllt. Das unstete Licht der Fackel, das aus der Tiefe der Höhle zu ihr herüber schien, erhellte ihr den zerklüfteten, steinigen Weg. Ehe sie den Mann, der dort auf sie wartete, ganz erreichte, streifte sie ihren rechten Handschuh ab und hielt ihm die entblößten Finger entgegen. Ein Ring prangte an der Hand, mit einem blutroten Stein versehen.
„Endlich lernen wir uns kennen“, sagte der Fremde, der sehr viel jünger war, als sie selbst. Er berührte den roten Stein kurz mit seinem Finger und neigte dabei leicht den Kopf.
Elisa unterzog sein Äußeres unterdessen einer intensiven Prüfung. Besonders auffallend war das rote, lockige Haar ihres Gegenübers, das als dichte, ungebändigte Mähne bis über seine Schultern fiel. Dunkelgrüne Augen blickten aus dem hellhäutigen Gesicht eines nur knapp über Zwanzigjährigen. Die Züge befanden sich noch in der Phase der Ausprägung, die Wangen leicht rundlich. Das kantige Kinn jedoch schien einen Hinweis darauf zu geben, in welche Richtung die Entwicklung der jugendlichen Physiognomie sich wenden würde. Der junge Mann hob den Kopf und sah sie an. Sein Blick war ruhig.
"Frau Sleyvorn, mein Name ist Robin Dungslear."
Der Akzent, den sie bei seinen ersten Worten kaum wahrgenommen hatte, war nun unüberhörbar. Schottisch wahrscheinlich, oder irisch. Doch die deutsche Sprache beherrschte er schon seit vielen Jahren.
"Was hast du mir mitzuteilen?" fragte Elisa ihn ohne große Umschweife.
"Wir sind bereits seit einer Weile hier", erwiderte Robin. "Und uns scheint, dass zwischen Ihnen und dem Mann, der seit etwa zwei Wochen unter den Klippen wohnt, keine Kontaktaufnahme erfolgt ist. Doch Sie wissen, wer er ist, nicht wahr?"
"Wie sollte ich es nicht wissen?" gab Elisa zurück. "Ich habe stets ein Auge auf ihn."
Robin lächelte leicht. Er besaß eine durchaus liebenswürdige Ausstrahlung. Elisa wunderte sich, keine Kälte bei ihm zu spüren. Konnte es tatsächlich sein, dass sie einen noch unverdorbenen Jungen vor sich hatte?
"Die Familie, in der er aufwuchs, hieß Adlam", erklärte der junge Mann. "Es waren Briten, reiche Pferdezüchter. Sie gaben ihm den Namen Robert. Er verwendet diesen Namen auch heute noch, obwohl er offenkundig weiß, wohin er wirklich gehört."
Elisa hob die Brauen. "So? Wohin gehört er denn?" fragte sie unterkühlt. "Die Tatsache, dass ich ihn erkannt habe, bedeutet nicht, dass ich ihn als mein Fleisch und Blut ansehe."
Robin ließ sich durch ihre frostigen Worte nicht aus dem Konzept bringen. "Mein Herr möchte Sie bitten, mit Robert Adlam ein Gespräch zu führen", sagte er in höflichem Ton.
"Ich habe deinen Herrn seit wirklich vielen Jahren nicht mehr gesehen", gab Elisa sogleich zurück. "Warum unterbreitet er mir seine Bitte nicht persönlich?"
"Verzeiht", sagte Robin sanft und senkte leicht den Kopf.
Rührend, dieser Knabe, dachte Elisa bei sich. Er konnte nicht viel über den Mann wissen, den er auf so altmodische Weise bewundernd seinen Herrn nannte. Und ihm war offensichtlich auch nur wenig über seine derzeitige Gesprächspartnerin bekannt. Vielleicht fühlte Robin Dungslear sich eingebunden in ein geheimnisvolles Märchenspiel, mit ihm selbst in der Rolle des getreuen Schülers eines machtvollen, alten Zauberers. Dieser letzte Gedanke amüsierte Elisa ein wenig, erinnerte er sie doch an die träumerischen Jahre einer längst vergangenen Jugend.
"Was ist nun der Grund, warum er nicht selbst hier erscheint?" fragte sie im nächsten Moment unbeirrt weiter. "Versteckt er sich vor mir - oder vor seiner Brut?"
"Robert Adlam weiß nicht, dass er hier ist", antwortete Robin. "Um genau zu sein, weiß er nicht einmal, dass mein Herr noch lebt. Und er soll es auch nicht erfahren."
Elisa bewegte leicht den Kopf hin und her. Sie wusste nicht, was in all den langen Jahren vor sich gegangen war, sie hatte niemals Nachricht erhalten - und auch keine erwartet oder gewünscht. Und was auch immer dies nun für ein Katz-und-Maus-Spiel sein sollte, sie hätte es zu schätzen gewusst, würde es nicht unbedingt vor ihrer Nase stattfinden.
"Also hält er sich vor ihm versteckt", stellte Elisa nüchtern fest. "Gehe ich recht in der Annahme, dass das Verhältnis zwischen den beiden getrübt ist?"
"Wohl ja", war Robins Antwort, während er den Blick von ihr wandte und in das Licht der Fackel sah, die er in einen Felsspalt am Boden gesteckt hatte. "Mein Herr bat mich zumindest, Ihnen Folgendes zu sagen...", er zögerte kurz, dann fanden seine Augen zurück zu Elisas Gesicht. "Laden Sie Robert Adlam zu einem Gespräch ein. Und überzeugen Sie ihn davon, fortzugehen. Teilen Sie ihm mit, dass er nicht mehr länger in der Nähe Ihrer Familie erwünscht ist."
Elisa war erstaunt über diese merkwürdige Bitte, doch wollte sie nicht wirklich wissen, was dahinter steckte. Eines schien ihr jedoch so gut wie sicher: dass dies nicht das einzige Gesuch an sie bleiben würde. Es war gut möglich, dass die Einlösung eines alten Versprechens recht bald auf sie wartete.
"Ich werde sehen, was sich in der Sache machen lässt", sagte Elisa. "Ich lege keinen gesteigerten Wert auf die Anwesenheit von ähm...", sie räusperte sich, "Herrn Adlam. Doch ist der Mann frei in seinen Entscheidungen. Und seine Anwesenheit hier hat für ihn sicher einen guten Grund."
"Ich danke Ihnen, Frau Sleyvorn", sagte Robin mit einem zurückhaltenden Lächeln.
"Hat dein Herr noch weitere Anliegen?" fragte Elisa geradeheraus. "Oder ist dies vorerst alles?"
Der junge Mann reckte sich. "Er erkundigt sich", erwiderte er, "nach dem Befinden Ihrer Enkelin."
Nun hatte Elisa die Bestätigung ihrer Vermutung: Er war zurückgekehrt aufgrund der Zusicherung, die sie ihm vor vielen Jahren gemacht hatte. Ganz offensichtlich war sein erstes Experiment fehlgeschlagen. Dass er es trotz seines fortgeschrittenen Alters auf einen neuen Versuch ankommen lassen wollte, sah ihm ähnlich. Er war ein Mann mit einer Lebensvision. Und für diese Vision war er bis zu seinem letzten Atemzug kampfbereit.
"Er wird bereits wissen, dass es Tadeya gut geht", erwiderte Elisa absichtlich spröde. "Und ich hoffe sehr, dass es ihm selbst zumindest ebenso gut geht. Denn das ist nötig, wenn er noch weitere zwei bis drei Dekaden unter den Lebenden zu weilen wünscht." Sie machte eine kleine Pause und sprach die nächsten Sätze mit besonderer Betonung. "Gleichzeitig benötigt er wohl ein stets wachsames Auge für diejenigen, die er sich zu Feinden gemacht hat. In so manch einer Situation kann man offensichtlich nicht vorsichtig genug sein."
Ihr Gegenüber schien sich an der Härte ihres Tonfalles nicht zu stören. "Ich danke Ihnen für Ihre guten Wünsche", erwiderte er geradezu stoisch freundlich. "Mein Herr hat nicht übertrieben, als er von Ihnen erzählte."
Elisa legte den Kopf leicht schief. Für einen kurzen Moment verspürte sie den Impuls zu fragen, was er von ihr erzählt hatte. Doch sie hielt sich zurück. Sie erahnte das Geflecht von Halbwahrheiten, mit dem dieser junge Mann gefüttert worden war. Es lohnte sich wirklich nicht, nachzufragen.
"Robin", sagte sie nach einer Weile mit gesenkter Stimme. "Nimmst du eine Empfehlung von mir an?"
Sein Blick war offen, fragend.
Elisa nahm diese Miene als Zustimmung. "Halte deinen Verstand wach und dein Herz geschlossen", begann sie und trat einen kleinen Schritt näher an ihn heran, um ihm tief in die Augen zu sehen. "Lass dir nicht deine Schätze rauben, Freund. Deine Seele kostet hier weit weniger als dreißig Silberlinge."
Er schluckte merklich. "Frau Sleyvorn...", begann er etwas verwirrt.
Doch sie winkte ab, trat von ihm zurück. "Ich werde die Bitte deines Herrn erfüllen", meinte sie in gewohnt festem Tonfall, "und stehe für weitere Gespräche offen."
Robin schaute sie noch einen Moment lang wortlos an, dann bückte er sich recht abrupt und nahm die Fackel vom Boden auf. Sie hob zum Abschied die Hand. Er grüßte zurück mit einer stummen Verbeugung. Elisa sah ihm an, dass Fragen in ihm drängten, die er sich nicht zu stellen wagte. Doch sie hatte keine Antworten für ihn. Die musste er schon selbst finden.
------- CLARA NEUBERG -------
Der Schlaf, der über sie kam, war unruhig. Albtraumhafte Kreaturen huschten durch die Winkel ihres Bewusstseins, während kalte Schauer den kranken Körper schüttelten. Das Erwachen kam plötzlich, ein heftiges Zucken riss sie aus der finsteren Traumwelt. Zitternd und schwer atmend lag sie auf ihrem Kissen, die Augen geschlossen. Der Mund war wie ausgedörrt, die Zunge klebte trocken am Gaumen.
Nein, sie wollte nicht aufwachen, nicht zurück in die quälende Wirklichkeit. Doch auch vor den Träumen, die sie hetzten und trieben und schüttelten, grauste es ihr. Es gab kein Entkommen. Sie musste die Augen öffnen und sehen, ob die feuerrote Haut sich schon zu schälen begann. Sie musste den Schmerz fühlen, der in ihrem Fleisch tobte. Er drang schon jetzt mit spitzen Messern in ihr Bewusstsein: Öffne die Augen Clara, und sieh, was übrig bleibt von dir!
Da war eine Berührung an ihrem Arm, der kräftige Druck von Fingern.
Sie blinzelte, die Augen brannten. Sie waren trocken vom Fieber. Zuerst konnte sie nur Helligkeit wahrnehmen, das Licht der Lampen an ihrem Bett. Dann verschleierte Farben, wie ausgebleicht von heißer Sonne. Der kalte Rand eines Bechers presste sich gegen ihre Lippen. Ganz automatisch öffnete sie den Mund, denn der Durst brannte. Das Getränk, das durch ihre Kehle rann, war warm und merkwürdig dickflüssig. Sie dachte an Haferbrei, doch ihr Geschmacksinn meldete etwas anderes: Metallisch war der Eindruck, unangenehm. Schon wehrte sich ihr gestresster Magen. Sie spürte, wie es ihr hochkam. Sie schloss abrupt den Mund und schluckte kräftig. Der Becher wurde entfernt, doch Tropfen der Flüssigkeit rannen über ihr Kinn.
Clara schloss fest die Augen, kämpfte mit ihrem Mageninhalt. Sie hasste es, sich übergeben zu müssen. Es war widerlich und demütigend. Die Geräusche aus ihrem Magen und der Kehle schienen ihr Ekel erregend. Sie kämpfte mit all ihrer noch verbliebenen Kraft und blieb am Ende Sieger über den Brechreiz.
Etwas berührte ihre Stirn, doch es wurde kein Wort gesprochen. War es Lore, die Dienstmagd, die an Claras Bett stand? Oder hatte Heinrich nochmals nach dem Arzt gerufen, der bereits zuvor mit unübersehbar ratlosem Gesicht seine Medizin verordnet hatte? War Heinrich im Raum?
Zum zweiten Mal hob sie die schweren Lider. Die Augen brauchten so lange, um den Dienst aufzunehmen, dass sie schon befürchtete, sie sei dabei, zu erblinden. Doch irgendwann verfestigten sich die verschwommenen Farben zu Formen. Im gelblich flackernden Licht erkannte sie das Stuckfries an der Decke. Im nächsten Moment durchfuhr sie ein kalter Fieberschauer, ihr Körper zitterte so heftig, dass die Zähne klappernd aufeinander schlugen.
Danach dauerte es eine Weile, sich wieder zu sammeln, um den Kopf ein wenig zur Seite zu drehen. Sie sah Rot auf dem Ärmel ihres Nachthemdes. Dunkles Rot, feucht und fleckig. Blutete sie? Sie hob die Augen, um zu sehen, wer dort am Rand ihres Bettes stand. Verschwommen kam ihr in den Sinn, dass sie Heinrich von der alten Zigeunerin reden gehört hatte. Das war vor vielen Stunden gewesen. Vielleicht war auch schon ein ganzer Tag vergangen. Sie hasste bereits jetzt den Gedanken, die weißhaarige Hexe an ihrem Krankenbett vorzufinden. Ihr elender Zustand würde der alten Sleyvorn mit Sicherheit großes Vergnügen bereiten.
Doch ihre Befürchtung bewahrheitete sich nicht.
Es war ein ihr fremder Mann und sein dunkler Blick fuhr ihr ins Mark. Plötzlich wurde sie von purer Angst ergriffen, als seien ihre Albträume mit der Wirklichkeit verschmolzen. Sie sah, dass sich seine Lippen bewegten. Leise Worte kamen hervor, fremde Worte mit hartem Klang. Es schien Clara, als könne sie jede Silbe körperlich spüren, feine Nadelstiche, überall auf ihrem Körper. Ihr Mund öffnete sich zu einem Schrei, doch nur ein trockenes Krächzen entrang sich ihrer Kehle. Wie erstarrt war ihr Körper, mit unsichtbaren Seilen an das Bett gefesselt. Den Blick von seinen dunklen Augen zu lösen war ihr unmöglich, so sehr sie auch innerlich darum kämpfte.
Dies war ihr Tod! Dieser Dämon würde sie direkt in die Hölle reißen!
Schweißperlen rannen über ihre Stirn, sie war ein zitterndes Tier in der Falle. Der Rhythmus seiner Worte wurde schneller, sie prasselten wie ein Trommelfeuer von kaltem Hagel auf ihre Haut. Und seine Miene war regungslos, als nehme er ihren Schmerz und die namenlose Angst nicht wahr. Clara fühlte, wie ihr die Tränen kamen. Nein, sie wollte nicht weinen! Seit Jahrzehnten hatte sie keine einzige Träne mehr vergossen, Heulerei war ihr verhasst. Noch mehr verhasst, als sich zu übergeben.
Doch dann hörte sie sich selbst schluchzen und spürte die Feuchtigkeit auf den Wangen. Die Sicht verschwamm und für Sekunden schützte sie ein Schleier von Tränen vor seinem Blick. Der Mann verstummte abrupt, die feinen Stiche auf ihrem Körper hörten im selben Moment auf. Der zuvor erstickte Schrei brach mit Urgewalt aus Claras Kehle, ein ohrenbetäubendes Kreischen erfüllt von Horror. Noch während sie schrie, setzte sie sich auf, warf die Bettdecke von sich und schwang die Beine aus dem Bett: Fliehen wollte sie, ihrem Peiniger entkommen.
Die schwachen Muskeln trugen den Körper nicht. Sie sackte neben dem Bett zusammen, blieb auf der Seite liegen und wand sich dort vor blindem Entsetzen. Die Tür zum Zimmer wurde aufgerissen und Heinrich stolperte herein. Clara sah, wie seine Schuhe über den Teppich zu ihr sausten.
"Clara", rief er mit einer Stimme, aus der Entsetzen zu hören war. Seine Arme griffen unter ihre Achseln und er hievte ihren schweren Körper vor Anstrengung keuchend auf den Bettrand. "Clara", rief er abermals, mit beiden Händen nun ihre Arme haltend, damit sie nicht nach hinten wegsackte.
"Ist er... ist er... weg?" brachte sie unter großer Anstrengung hervor. "Hol... hol sofort die Polizei!“
"Clara", sagte Heinrich und schaute in ihr Gesicht. "Du blutest. Da ist überall Blut."
Sie konnte nicht mehr antworten, die wieder aufkommenden Tränen erstickten ihre Stimme. Auf dem Gesicht ihres Mannes erschien eine tiefe Zornesfalte. Er ließ Claras Arme los und stand aus seiner Hockstellung auf. Sie hatte etwas Mühe, sich weiter aufrecht zu halten, doch es gelang ihr, nicht hintenüber zu kippen. Mit den Händen wischte sie sich durch die Augen, dann blickte sie sich suchend um.
Der fremde Mann befand sich noch immer im Zimmer, musste sie erschreckt feststellen. Heinrich hatte sich vor ihm aufgebaut mit zornig erhobenen Fäusten, die er vor dem Gesicht seines Gegenübers tanzen ließ. "Was verdammt nochmal treiben Sie?" donnerte er los. "Ich habe Sie nicht hergeholt, damit Sie sie umbringen!"
Clara stützte sich mit den Armen auf, ihre Finger krallten sich in die Bettdecke. Sie spürte eine merkwürdige Wärme ihren Körper durchströmen. Angenehm kribbelnd verteilte sie sich vom Herzen ausgehend bis in die Zehenspitzen. Das Zittern ebbte langsam ab.
Der Fremde wich keinen Schritt zurück. Clara erkannte jetzt erst mit Erstaunen, wie jung dieser Mann war, wohl nicht einmal halb so alt wie sie selbst. Und mit Sicherheit war er keine irreale Kreatur, die ihren Albträumen entronnen war, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut. Aber sein Anblick verursachte ihr nichts als Unbehagen, als krampfe sich in ihr etwas schmerzhaft zusammen.
Der Mann erwiderte mit unbewegter Stimme: "Lassen Sie das. Das bringt nur Schwierigkeiten."
"Ja", grollte Heinrich aufgebracht, "für Sie!"
Clara hatte ihren Mann in dreißig Jahren Ehe selten in solch einer Wut gesehen. Heinrich war kein Mensch, der sich prügelte. Ganz offensichtlich hatten ihn die letzten Tage arg mitgenommen. Aber das Gebrüll ihres Gatten berührte sie weniger, als die Präsenz dieser fremden Person. Sie wollte diesen Mann aus ihrem Zimmer haben - und aus dem Haus. Schließlich war es noch immer sie gewesen, der entschieden hatte, wer über ihre Schwelle treten durfte und wer nicht. Sie war die Herrin dieses Hauses und daran konnte auch ihre Erkrankung nichts ändern.
So stemmte sie sich mit beiden Händen vom Bett hoch und kam leicht schwankend zum Stehen. Das warme Kribbeln unter ihrer Haut verstärkte sich und einen Moment lang verharrte sie misstrauisch, auf den Schmerz horchend, der nun eigentlich durch ihre Knochen fahren müsste.
Sie hörte Heinrich schimpfen: "Ich werde Sie zur Rechenschaft ziehen für diese Hinterhältigkeit.“
Clara richtete den Blick auf die beiden Männer und stapfte zwei schwere Schritte in ihre Richtung. Heinrich bemerkte seine sich nähernde Frau nicht, obwohl sie sich nicht gerade geräuschlos bewegte. Zu sehr hatte er sich in seinen Zorn gesteigert. Sein Gesicht war rot verfärbt und er schien kurz davor, seinem Gegenüber einen Fausthieb zu verpassen. Der Fremde hob den rechten Arm und drehte die Handfläche zu Claras aufgebrachtem Ehemann. Clara bemerkte, dass er Handschuhe trug. Auf dem braunen Leder waren vereinzelte Blutflecken zu erkennen. Er sagte in ruhigem Tonfall nur ein Wort: "Still."
Heinrich gab ein dumpfes Grollen von sich und verharrte in seiner Angriffstellung. Clara machte einen weiteren Schritt nach vorn und erhob ihre kräftige Stimme: "Ich will, dass Sie auf der Stelle hier verschwinden", gebot sie dem fremden Mann. Ihr Gatte wandte mit einem Ausdruck des Erstaunens sein rotes Gesicht in ihre Richtung. Der Mund klappte auf und die Fäuste sanken herab.
"Clara", flüsterte er voll Unglauben.
"Heinrich,", erwiderte sie fest, "ich möchte, dass du diesen Mann hier rauswirfst."
"Aber", Heinrich schluckte, er schien verwirrt. "Clara, Herr Adlam ist.... er hat dich wohl... wieder gesund gemacht..."
Einen Moment lang war Clara unsicher. Doch der Schreck, den dieser Fremde in ihr ausgelöst hatte, saß tief. Sie konnte nicht akzeptieren, dass der Mann irgendetwas Gutes an ihr getan hatte. Sie straffte die Schultern und proklamierte mit energischer Stimme: „Ich war bereits auf dem Wege der Besserung. Ich werde mich doch nicht von einer kleinen Grippe unterkriegen lassen."
Heinrichs Blick sagte ihr deutlich, dass er ihren Worten keinen Glauben schenkte. Doch in ihren eigenen Ohren klang ihre Aussage keinesfalls wie eine Lüge. Ihr zäher Körper war bis jetzt noch mit jeder Krankheit selbst fertiggeworden. Sie wandte leicht den Kopf und schaute dem fremden Mann in die Augen, der sich Adlam nannte. Er sah sie direkt und unverwandt an, aber seine Miene war verschlossen. Das Unbehagen, das sein intensiver Blick ihr verursachte, ärgerte sie. Es ärgerte sie gewaltig, ein noch immer beharrliches Pochen von Angst an ihrer selbst errichteten Mauer des Stolzes wahrzunehmen. Darum erhob sie die Stimme umso gebieterischer. "Verlassen Sie augenblicklich dieses Haus, Herr Adlam!"
Sie war es gewohnt, dass man sich unter ihrer harschen Stimme duckte. Die Leute, die ihr im Weg standen, suchten im Normalfall so schnell es ging das Weite. Jedoch hatte sie fast damit gerechnet, dass dieser Mann sich widersetzen würde. Er blieb stehen, wo er war, ohne die Augen von ihr abzuwenden. Clara widerstand der Versuchung, der dunklen Intensität seines Blickes auszuweichen und starrte mit möglichst böser Miene zurück.
Heinrich ergriff das Wort. "Clara,", sagte er in eindringlichem Ton. "Ich habe Herrn Adlam hierher geholt, damit er dir hilft. Ich hätte zwar nicht gedacht, dass...". Er brach ab, runzelte die Stirn. Diese Geste der Unentschlossenheit von ihrem sonst sehr zielstrebigen Gatten reizte Claras Wut nur noch mehr.
"Ich brauche niemanden, der mir hilft", fauchte sie ihn an. "Wie du siehst, geht es mir ausgezeichnet!"
Heinrich schüttelte daraufhin nur wortlos den Kopf.
Erst jetzt meldete sich Herr Adlam zu Wort: "Fräulein Sleyvorn schien zu wissen, was sie tat", sagte er trocken.
Clara hielt inne, schluckte hart und zog böse die Stirn kraus. Doch ehe sie etwas erwidern konnte, fiel ihr Heinrich ins Wort.
"Darüber haben weder Sie noch sonst jemand zu befinden", gab er seinem Besucher energisch zurück. Den Angesprochenen schien diese Zurechtweisung nicht zu berühren. "Sie wissen, dass ich nicht aus moralischen Gründen hier bin", erwiderte er mit weiterhin ruhiger Stimme.
Das gab Clara Anlass, ihren Mann mit einem strengen Blick zu bedenken. "Du wirst ihm doch wohl kein Geld versprochen haben?"
Heinrich stemmte die Hände in die Hüften. "Natürlich habe ich das, Clara", antwortete er mit Nachdruck. "Und schließlich stehst du genau deshalb wieder auf deinen Beinen!"
Clara wollte nicht glauben, dass gerade dieser bösartige Fremde sie gesundgemacht haben sollte. Doch vor ihrem geistigen Auge erschien das Bild der jungen Sleyvorn, die ihre Hand vor Clara hob und wie eine giftige Schlange unverständliche Worte zischte. War es nicht ein Gesetz der Logik, dass Hexerei nur mit Hexerei aufzuheben war? Und dieser fremde Mann, wie und wo Heinrich ihn auch immer aufgetrieben haben mochte, war mit Sicherheit kein Doktor. Zu sehr erinnerte er Clara an die unheilvolle Zigeunersippe. Doch erschien er ihr sehr viel finsterer. Sie war sich sicher, nie zuvor einem ähnlichen Menschen begegnet zu sein. Und in ihrem Haus haben wollte sie ihn ganz bestimmt noch immer nicht.
"Wenn du ein Geschäft mit ihm hast, Heinrich,", erwiderte Clara deshalb nach einigen Sekunden des Überlegens, "dann verlasst beide dieses Zimmer, um es abzuschließen. Und danach möchte ich diesen Mann nie wieder hier sehen."
Heinrich nickte. Sein Blick schien ihr anzudeuten, dass auch er diese Sache möglichst schnell hinter sich bringen wollte. Doch hatte er zuvor noch etwas anderes zu erledigen.
"Herr Adlam", wandte er sich an den Fremden, "warten Sie bitte draußen auf dem Flur auf mich. Ich möchte mit meiner Frau kurz allein sein."
Der Angesprochene nickte. "Prüfen Sie", sagte er, "ob sie erhielten, was Sie bestellt haben." Er warf Clara noch einen kurzen Blick zu und verließ dann den Raum. Sie sah ihm nach, bis die Tür hinter ihm zufiel.
Im nächsten Moment spürte sie Heinrichs Hand auf ihrem Arm. "Clara, komm mit mir zum Spiegel", wies er sie an. Sie folgte seinem Drängen zum großen Wandspiegel neben dem Bett, während ihre Gedanken noch immer um den fremden Mann kreisten, der ihre starke Felsenfestung allein durch seine Anwesenheit auf äußerst unangenehme Weise erschüttert hatte. Doch erschütternd war auch der Anblick, den ihr Spiegelbild bot. Sie fuhr vor Schreck zusammen, als es vor ihren Augen erschien. Getrocknete Rinnsale von Blut klebten auf dem Kinn und am Hals, einige Tropfen prangten auch auf den Wangen. Und ihr ehemals schneeweißes Nachthemd war im Hals- und Armbereich von dunkelroten Flecken besprenkelt. Es sah tatsächlich so aus, als habe sie, wie eines dieser sagenhaften Vampirwesen, sich gierig an Blut gelabt.
Heinrich griff nach dem feuchten Lappen, der auf dem Nachttisch neben der Wasserschüssel lag und mit dem Claras Stirn gekühlt worden war. Er half seiner Frau, die roten Flecken und Spritzer von ihrer Haut zu waschen. Verletzungen wurden darunter nicht sichtbar. Auch sonst hatte Clara keine Schmerzen mehr, ihre Temperatur hatte sich normalisiert und die Haut wies wieder ihre normale Farbe auf. Die feuerrote Färbung und das furchtbare Brennen waren völlig verschwunden.
"Woher das Blut kommt", sagte Heinrich, "will ich gar nicht wissen. Die Hauptsache ist, dass Du wieder auf den Beinen stehst, Clara. Ich werde Lore sagen, dass sie dir ein Bad bereitet. Dann kleidest du dich wieder an und wir können unter die ganze Sache einen Haken setzen."
"Eins möchte ich zuvor noch wissen, Heinrich." Clara griff fest nach dem Arm ihres Mannes, der sich bereits anschickte, die Schlafkammer zu verlassen. "Wie bist du an diesen Herrn Adlam geraten?"
Heinrich schluckt hart, bevor er erwiderte: "Elisa Sleyvorn schickte mich zu ihm. Ich fand ihn in einem Steinhaus unter den Klippen."
Clara runzelte die Stirn, sie fühlte einen gewaltigen Unwillen in sich aufsteigen. "Du hast die Zigeunerhexe um Rat gefragt?" hakte sie nach. "Weißt du nicht, dass ich lieber elendig krepiert wäre, als diese..."
"Sie ist nicht zu dir gekommen, sondern er", unterbrach Heinrich sie. "Du hast somit die Hilfe der Sleyvorn nicht in Anspruch genommen. Und die Dienste dieses Mannes sind käuflich, wie die eines Fabrikarbeiters. Wenn ich ihm seinen Lohn gegeben habe, sind wir ihm nichts mehr schuldig."
"Dann geh", drängte Clara und wies mit dem Finger zur Tür. "Schick ihn fort und hole ihn nie wieder her."
------- HEINRICH NEUBERG -------
Herrn Adlam wieder aus dem Haus zu bekommen, war ihm recht leicht gefallen, jedenfalls für den Moment. Heinrich starrte mit gerunzelter Stirn auf die Haustür, die soeben hinter seinem Besucher ins Schloss gefallen war. Nur vielleicht zwei Minuten hatte das Gespräch auf dem geräumigen Flur gedauert. Und das Ergebnis bereitete Heinrich nun ungeahntes Kopfzerbrechen.
Den Geldkoffer war er losgeworden. Er hatte eine relativ hohe Summe zusammengebracht, die ihn schon ein wenig schmerzte. Da er allerdings weit und breit als nicht gerade armer Mann bekannt war, war er nicht umhin gekommen, diesen ansehnlichen Betrag von seiner Bank abzuheben, um nicht den Eindruck zu erwecken, er wolle seinen Geschäftspartner betrügen. Doch dieser war trotzdem nicht zufrieden gewesen.
"Sie haben sich nicht bemüht, meiner Forderung gerecht zu werden", hatte dieser in eher sachlichem Ton festgestellt. "Ich sagte: alles, was Sie bis heute Abend flüssigmachen können. Das habe ich durchaus ernst gemeint."
"Und ich habe es ernst genommen", versicherte Heinrich und schaute dem Mann mit bewusst festem Blick in die dunklen Augen. Doch Herr Adlam war durch dieses zur Schau gestellte Selbstbewusstsein nicht von seiner Überzeugung abzubringen. "Herr Neuberg", sagte er mit ernster Miene, "ich mache Ihnen ein Vorschlag: Sie haben einen Interessenten für die Werft. Verkaufen Sie sie ihm noch heute. Wenn ich morgen Abend wiederkomme, dann legen Sie mir den Kaufvertrag vor - und mindestens noch eine weitere von diesen Taschen."
Für Heinrich hatten sich diese Worte angefühlt wie ein derber Schlag in die Magengrube. "Die Werft?" hatte er atemlos gefragt. "Ich habe sie mit eigenen Händen aufgebaut, sie ist mein Lebenswerk und unsere Sicherheit! Ich werde den Teufel tun und...".
"Sie beide haben noch Ihr Haus", unterbrach ihn Herr Adlam. Und bevor er sich umdrehte und geradewegs zur Tür hinausmarschierte, fügte er hinzu: "Und Ihre Gesundheit."