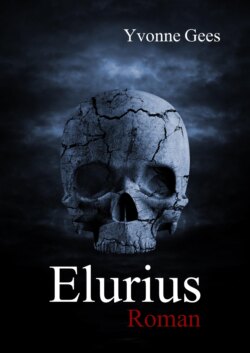Читать книгу Elurius - Yvonne Gees - Страница 4
Оглавление2. Entführung
Der neue Weg
Afrika: Hier bin ich nun, stehe an der Wiege jenes lebendigen Wesens, das sich die Menschheit nennt.
Die Elefanten bahnen uns einen Weg durch den dichten, von Leben wimmelnden Dschungel. Hitze und Feuchtigkeit bringen die Luft zum Flirren. Es sind nur wenige Menschen bei mir: Die beiden Schwarzen, denen die Elefanten aufs Wort gehorchen, zwei meiner Helfer, die ich aus der Heimat mitgebracht habe, und mein derzeitiger getreuer Schüler Kenneth aus Südengland.
Ich weiß sehr genau, wohin mein Weg mich führt. Die alten Karten trage ich immer bei mir, sorgfältig eingehüllt in Wachspapier, das sie vor der Feuchtigkeit schützt. Doch ebenso wichtig wie die Karten ist mein mir eigenes Gespür; ein tiefes, innerliches Wissen um den Weg, der mich zu dem ersehnten Ziel führt. Die Karten wären ohne dieses Gespür völlig ohne Nutzen. Der Dschungel lässt sich nicht kartieren und in ein Schema pressen. Meine Karten sind allein für jene äußerst seltenen Menschen verfasst worden, die die sogenannte "Schwarze Gabe" in starker Ausprägung besitzen. Jemand anderem wären sie nichts als uraltes, unnützes Gekritzel.
Ich weiß, dass wir kurz vor dem Ziel sind. Meine innere Anspannung wächst und es ist mir, als höre ich die Stimmen der Altvorderen in meinem Kopf, in meiner Seele. Sie wissen, dass ich nahe bin und bald schon einen von ihnen hervorholen werde.
Das Gekreisch von Affen dringt an mein Ohr. Regen prasselt scheinbar unaufhörlich auf das dichte Laub urwüchsiger Bäume. Die grauen Riesen scheinen eher einem Traumbild zu entstammen, so ruhig und beinah lautlos bahnen sie sich ihre Weg durch die dichte Pflanzenwelt.
Meine Begleiter tragen ihre Gewehre mit sich, doch vor dem Geruch der Elefanten ziehen sich die Raubtiere zurück. Das ist ihr Glück, denn so manche Waffe wird aufgrund des durchfeuchteten Schwarzpulvers sicherlich nicht mehr feuern.
Die grauen Riesen rammen ihre Stoßzähne in den Boden und schieben wucherndes Unterholz, Erdreich und Gestein beiseite. Die Stimmen ihrer beiden Herren sind laut und voll Autorität, doch werden sie von dem Dickicht des Urwalds wie von einem Schwamm verschluckt. Ich sehe Kenneth wie einen Schatten die Szene umkreisen, ganz wie es seine Art ist. Er kommt nicht einmal an das blasseste Abbild meiner Vision heran. Schattenhaft war sein Dasein von Anfang an und wird es auch bleiben, bis ich mich seiner entledige.
Einer der Elefanten hebt seinen Rüssel und gibt einen Laut von sich, der die Luft erzittern lässt. Sie sind auf festen Stein gestoßen.
Es hat den Rest des Tages in Anspruch genommen, die massiven Steinplatten soweit freizulegen, dass zu erkennen war, an welcher Stelle genau wir auf die Grabkammer getroffen waren. Man blickt auf grob behauene, verwitterte Flächen, ohne jeglichen Zierrat.
Am Tag darauf assistierte mir Kenneth beim Legen der Sprengladung. Die Elefanten wurden ein gutes Stück weit weg geführt. Sie haben starke Körper und zarte Nerven. Der Sprengstoff hat den langen, feuchten Weg ohne Schaden überstanden. Die Transportkiste war sorgfältig abgedichtet.
Es gelang, ein Loch in die Außenhaut der Kammer zu sprengen, das groß genug war, dass ein Mann problemlos hindurchkriechen konnte. Ich ging allein hinein und erlaubte Kenneth nicht, mir zu folgen. Es ist nicht zu übersehen, dass er innerlich rebelliert. Meine Pläne sind ihm schleierhaft und es gelingt ihm nicht, mehr darüber in Erfahrung zu bringen, als die kläglichen Informationen, die er besitzt. Ich brauche keine Mitwisser. Kenneth sollte sich besser zurückhalten und schweigen, wie es ihm gebührt.
Das Grab war von innen beinah ebenso schmucklos gehalten, wie von außen. Die Wände waren mit dicken Schichten Pech im Gemisch mit anderen nicht identifizierbaren Materialien isoliert. So war es tatsächlich gelungen, tief unter dem feuchten Waldboden einen trockenen Raum zu schaffen, der Jahrtausende hatte überdauern können.
In der Mitte der Kammer stand der Sarkophag.
Seine Oberfläche war schwärzlich, das unstete Fackellicht tanzte über Rillen und Risse. Ich ließ mich neben dem Sarg auf die Knie nieder, legte die freie Hand auf das undenkbar alte, steinerne Behältnis. In der alten Sprache begrüßte ich ihn, nach dem ich geforscht hatte in allen geheimen Bibliotheken dieser Welt. Ihn, der sich von mir nun hatte finden lassen, nach Jahrtausenden des Todesschlafs und der Vergessenheit. Dieser Tag war der Anfang einer neuen Zeitrechnung.
------- JESCO FEY-------
Dass ihn sein altes Leben so plötzlich einholen würde, darauf war er beinah schon nicht mehr gefasst gewesen. Und nun stand Jon vor ihm.
Jesco hatte keine Ahnung, wie es der alten Spürnase gelungen war, ihn nach all der Zeit, hier zu finden. Mit jedem einzelnen Monat war Jescos Glaube daran gewachsen, dass Jon die Suche nach ihm aufgegeben hatte. Oder dass der Knabe vielleicht endgültig hinter Gittern gelandet war. Doch offensichtlich handelte es sich hierbei um eine verfrühte Hoffnung.
Jons Gesicht schien trotz seiner relativ jungen Jahre noch zerfurchter als bei ihrem letzten Aufeinandertreffen. Tief eingegrabene, steile Falten ließen seine Mimik in einer ständigen Maske des Zorns erstarren. Unter seinem schmutzigen, viel zu weiten Hemd lag ein kräftiger, muskulöser Körper verborgen, das wusste Jesco. Wenn Jon zuschlug, und das tat er nicht gerade selten, dann brachen Knochen.
"Tach Mistratte", presste Jon finster zwischen den Zähnen hervor.
Jesco befand sich zu Fuß auf dem Weg zum Haus der Sleyvorns. Er hatte den oberen Weg entlang der Klippen gewählt. Aus dieser Höhe genoss man, wenn man den gepflasterten Weg verließ und sich ein Stück weit rechts hielt, einen prächtigen Blick auf das Meer und den schmalen Streifen Strand. Jon musste ihn schon eine Weile beschattet haben, um ihn hier auflauern zu können. Dichte, dornige Büsche, die sich auf den steinigen Boden kauerten, gab es zu Genüge, hinter denen man sich verstecken konnte. Jesco ging diesen Weg in den letzten Wochen regelmäßig. Er traf Tadeya an einem fest vereinbarten Ort, nur ein kleines Stück von Elisas Haus entfernt. Es war Tadeyas Wunsch, dass Jesco in dieser ersten Zeit ihrer Freundschaft noch nicht direkt bei der alten Dame vorsprach, denn auf ein Treffen mit Elisa Sleyvorn sollte man scheinbar gut vorbereitet sein. Besonders dann, wenn man Interesse an ihrer Enkelin hegte.
Als Jesco wie angewurzelt auf dem Weg stehen blieb, breitete sich in Jons Gesicht ein äußerst unangenehmes Grinsen aus, das freien Blick auf etliche faulige, zum Teil zerbrochene Zähne gewährte.
"Kennst mich noch, was, Partner?"
Keine Frage. Ein solches Gesicht konnte man einfach nicht vergessen.
Jesco atmete tief durch. Nachdem er den ersten Schreck überwunden hatte, blieb nicht besonders viel Angst übrig. In seinem alten Leben hatte er sich ständig geprügelt und immerhin gab es für ihn eine gewisse Chance, Jon eine Abreibung zu verpassen. Zwei Aspekte jedoch standen der Sache im Weg: Erstens trug sein alter Freund mit Sicherheit ein Messer bei sich. Und zweitens war die Zeit der Schlägereien für Jesco ein für alle Mal vorbei. Und der heutige Tag sollte hierzu keine Ausnahme bilden.
Du weißt genau, dass ich mich weder vermöbeln noch abstechen lassen möchte, betete er in Gedanken. Aber ich weiß echt nicht, wie ich hier wieder rauskomme.
Laut sagte er: "Wie könnte ich dich vergessen haben?"
"Hast schon auf mich gewartet, wie?" war die prompte Gegenfrage. Jon machte einen Schritt auf ihn zu. Eine Brise schweiß- und alkoholgeschwängerter Luft wehte Jesco entgegen. "Heute ist Stichtag, Junge."
"Was willst du?" wollte Jesco wissen. "Möchtest du nur deine Rache? Oder willst du das Geld, das dir durch mich verloren gegangen ist?"
Jon stieß pfeifend Luft durch etliche Zahnlücken.
"Beides, Partner. Und beides mit Zinsen."
Das Geschäft, das Jesco damals vor mehr als drei Jahren zum Platzen gebracht hatte, war Jons liebstes Kind gewesen. Mühevoll hatten sie über Wochen und Monate die von Mayenbergs ausspioniert, um die Zwillinge in ihre Hand zu bekommen. Herr von Mayenberg hätte für seine beiden kleinen Söhne, den Stolz der Familie, zur Not beide Hände geopfert. Das kleine Vermögen, das er zur Auslösung seines Nachwuchses hätte aufbringen sollen, wäre ihm das Leben seiner Kinder mit Sicherheit wert gewesen.
„Ausgesorgt haben wir bald", das waren zu jener Zeit Jons liebste Worte. Und voll Vorfreude hatte er sich dabei die Hände gerieben. Auch Jesco hatte alles auf diese eine Karte gesetzt. Sein Plan war es, das Geld zu nehmen und fortzugehen, in ein anderes Land, und sich ein wirklich schönes Leben zu machen. Die Art von Leben, die jemand wie er in dieser Welt niemals mit seiner Hände Arbeit erreichte.
Und dann war plötzlich alles ganz anders geworden. Eine wahrhaft mächtige Hand hatte Jesco aus seiner vorausgeplanten Bahn gerissen und der Coup war geplatzt. Zurück blieb ein vor Wut und Hass schäumender Jon, der das Geld in seinen Träumen bereits in den Händen gehalten hatte.
"Ich denke aber, so viel Knete, wie du mir schuldest, hast du kleiner Heiliger wohl nicht", knurrte Jon und im nächsten Moment hielt er, wie Jesco bereits geahnt hatte, sein Messer in der Hand. Die Klinge blitzte im Sonnenlicht. Jon verbrachte ganze Tage damit, liebevoll das Metall zu schärfen, das wusste Jesco. Seine Messer waren nicht dazu gedacht, Gemüse zu schneiden. "Wenn ich mit dir fertig bin, werde ich mir als Ersatz für das Geld deine Kleine holen."
Herr, es wird Zeit, bat Jesco innerlich inständig. Ein Wunder wäre jetzt nicht schlecht.
Jesco wusste, wie man einem Bewaffneten am besten das Messer abnahm. Das Problem war nur, Jon wusste es auch und war mit Sicherheit gewappnet. Die Wahrscheinlichkeit fehlzuschlagen schien nach natürlichen Gesichtspunkten gewaltig. Alle Muskeln seines Körpers spannten sich an, als er Jons Attacke erwartete. Und plötzlich kam da, ganz schwach nur, dieses aus früheren Zeiten vertraute Gefühl tief in seinem Inneren auf. In seinem alten Leben hatte die Erwartung eines harten Kampfes ihn geradezu berauscht. Und eine Spur des alten Nervenkitzels stieg nun unerwartet in ihm wieder hoch. Im selben Moment erschienen vor seinem geistigen Auge Bilder aus den finsteren Gassen der Stadt, von verschwitzten, blutenden Körpern und in Hass erstarrten Gesichtern: Erinnerungen des Schreckens, die er am liebsten bereits vergessen hätte.
Jon machte einen kräftigen Satz auf ihn zu, das Messer erhoben. Jesco duckte sich zur Seite weg und wollte seinen Gegner mit einem Tritt gegen das Schienbein aus dem Gleichgewicht bringen, doch Jon reagierte rasch. Er wich Jescos Attacke aus und im nächsten Moment sauste die scharfe Klinge mit einem Zischen bedrohlich am linken Ohr des Malers vorbei. Jesco wollte Jons rechten Arm zu fassen bekommen und ihm das Messer entwinden, doch er war nicht schnell genug. Jon sprang im letzten Moment zur Seite, um gleich darauf wieder laut brüllend auf ihn zuzustürzen.
Doch mitten im Spurt knallte es, Jons Kopf ruckte plötzlich nach vorn und das Kinn fiel auf seine Brust. Doch die Wucht seines in schneller Bewegung befindlichen Körpers trieb ihn noch einen weiteren Schritt nach vorn, bis er mit einem Mal völlig erschlaffte und vornüber sackte. Jesco konnte sich mit einem Satz zur Seite gerade noch in Sicherheit bringen, bevor das Gesicht seines Angreifers ungebremst auf den harten Boden knallte. Direkt neben Jon polterte etwas zu Boden, das Jesco im ersten Moment für ein braunes Päckchen hielt. Doch im nächsten Augenblick erkannte er, dass es sich um einen nicht sehr großen, dafür aber sehr harten Koffer handelte, der Jons Hinterkopf getroffen hatte. Der Verschluss des Koffers hatte sich bei dem kräftigen Aufprall geöffnet und gab den Blick auf eine Menge gebündelter Geldscheine frei. Einige der Bündel waren herausgefallen und verteilten sich auf der Erde rund um Jons leblosen Körper.
Jesco blinzelte, weil er das Gefühl hatte, nicht richtig zu sehen. Doch das Bild veränderte sich dadurch nicht.
Jemand sagte nicht ohne Schmunzeln in der Stimme: "Er hat doch nach Geld verlangt, oder?"
Jesco hob die Augen von seinem so unerwartet gestürzten Gegner, dem das Messer beim Aufschlag auf den Felsengrund geradezu aus der Hand geflogen war. Es lag nun zwei Schritte entfernt zwischen einigen Dornenbüschen. Wenige Meter ihm gegenüber stand ein Mann, relativ jung und der kalten Witterung entsprechend gekleidet. Doch irgendetwas in Jesco zuckte bei der Begegnung ihrer Blicke zurück. Dunkelheit, das war der erste Gedanke, der scheinbar zusammenhangslos durch seinen Kopf ging. Und dieses Wort bezog sich keinesfalls auf die dunklen Haare und Augen seines Gegenübers. Niemals zuvor war er bei der Begegnung mit einem anderen Menschen auf diese schauerliche Weise berührt worden. Trotzdem kostete es ihm nur wenig Mühe, sich bei seinem unerwarteten Retter zu bedanken.
"Sie haben mir ganz schön aus der Patsche geholfen. Danke."
Und zuallererst danke dir, Herr, fügte er still hinzu. Obwohl ich nicht weiß, ob der hier wirklich von dir kommt.
Der Mann wies auf die Klinge am Boden und meinte: "Wenn Sie noch mehr Leute von der Sorte kennen, dann stecken Sie sich besser das Messer ein. Es steht nämlich nicht hinter jeder Ecke jemand, der auf Sie acht gibt."
Jesco hob die Hand. "Ich brauche es nicht", erwiderte er. Und mit einem kleinen Lächeln fügte er hinzu: "Ich würde nicht beschwören, dass nicht doch hinter jeder Ecke jemand steht."
Jons Kopf bewegte sich leicht und es war ein dumpfes Stöhnen zu hören. Jesco sah, dass sein früherer Freund am Hinterkopf blutete. Er spürte sogleich den Impuls, sich neben den Verletzten zu knien und sich um ihn zu kümmern. Bevor er sich jedoch zur Ausführung dieses ihm nicht völlig angenehmen Gedankens entschließen konnte, war der fremde Mann mit wenigen Schritten bei dem am Boden liegenden Messer angelangt, hatte es aufgehoben und eingesteckt. Dann packte er den nun etwas lauter stöhnenden Jon bei den Schultern und drehte ihn herum. Und als er, über Jons Körper gebückt, dann noch das eben aufgehobene Messer wieder aus seiner Manteltasche zog, war Jesco vollends klar, was der Fremde vorhatte.
"Lassen Sie das", forderte er mit lauter Stimme, während er einen festen Schritt nach vorn tat, um schnell eingreifen zu können. Der Angesprochene ignorierte Jescos Appell. Er sah nicht einmal auf, sondern führte das Messer an Jons Kehle. "Halt!" rief Jesco und im nächsten Moment hatte er den anderen Mann erreicht. Er brachte zur Anwendung, was er in seinem früheren Leben gelernt hatte, packte dem Fremden blitzschnell beim Handgelenk, drehte es herum und hatte ihm nur einen Lidschlag später das Messer entwunden. In Sekundenbruchteilen führte Jesco den altbekannten Automatismus aus und gleich darauf sah sein Gegenüber die Klinge gegen sich selbst gerichtet. Das scharfe Messer befand sich nur Zentimeter vor der Halsschlagader des Fremden.
Ihre Blicke trafen sich.
Jesco konnte weder Angst noch Erschrecken in der Miene des anderen erkennen. Nach einigen Sekunden des stillen Verharrens legte der Mann seine behandschuhte Linke auf Jescos Unterarm und schob mit leichtem Druck die das Messer führende Hand von sich fort. Jesco ließ dies ohne Widerstand zu, denn an Gewaltanwendung war ihm von vorneherein nicht gelegen gewesen.
"Sie machen mir Spaß", sagte der Fremde in einem kalten Ton.
Jesco ließ die Hand mit dem Messer sinken. Doch keiner von ihnen trat einen Schritt zurück.
Jesco forderte mit ruhiger Stimme, doch nicht ohne Nachdruck: "Lassen Sie einfach den Mann in Frieden. Ich werde mich um ihn kümmern."
Aus dem Augenwinkel nahm er wahr, dass Jons Kopf sich leicht bewegte. Doch noch rührte Jesco sich nicht von der Stelle. Er wollte sichergehen, dass seine Worte angekommen waren.
"Mir ist er egal", war die Antwort. "Er wird Sie umbringen, wenn Sie ihn laufen lassen."
"Daran glaube ich nicht", erwiderte Jesco fest.
Sein Gegenüber verharrte noch einen kurzen Moment wortlos, während allein seine Miene für sich sprach. Sie war finster mit einer deutlichen Spur von Geringschätzung. Dann gab er Jesco den Weg frei.
Jesco blickte herab auf das Messer, das ungewollt nun doch in seine eigene Hand gefunden hatte. Kurz entschlossen drehte er sich um in Richtung der Klippen und schleuderte es mit aller Kraft weit über den schmalen Sandstrand hinaus in die Brandung des Meeres. Als er sich wieder umdrehte, sah er, dass der fremde Mann sich ohne ein weiteres Wort abgewandt hatte und im Begriff war, fortzugehen.
"Sie haben etwas vergessen", rief er ihm nach. Der Wind blätterte eifrig in den Geldbündeln am Boden und drohte, das ein oder andere über den Klippenrand zu wehen.
Der Angesprochene warf einen Blick über die Schulter zurück. "Behalten Sie es", sagte er. Und nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: "Für die reife Vorstellung, die Sie geliefert haben."
"Wer sind Sie?" fragte Jesco daraufhin. "Und woher stammt dieses Geld?"
"Robert Adlam. Ich bin ein Freund der Familie Sleyvorn", erwiderte der Mann. "Und über das Geld machen Sie sich keine Sorgen. Es stammt aus einem legalen Geschäft." Damit setzte er seinen eingeschlagenen Weg fort und war gleich darauf verschwunden.
Obwohl dies zweifellos eine der bizarrsten Situationen in Jescos Leben war, hatte er bereits genug erlebt, dass sich seine Verblüffung in Grenzen hielt. Er beschloss, dass es Zeit war, sich dem Verletzten zuzuwenden. Er hatte keine medizinischen Kenntnisse, sodass er einfach tat, was ihm als Nächstes einfiel. Er legte die Arme um Jons Oberkörper und setzte ihn vorsichtig auf. Die Wunde am Hinterkopf konnte er unter den blutverklebten Haaren nicht erkennen, so war die Schwere der Verletzung nicht einschätzbar. Jesco kniete sich neben Jon auf den harten Boden, mit dem einen Arm noch immer den schlaffen Körper stützend. Jons Kinn war auf die Brust herabgesunken. Die Augenlider flatterten, während aus dem Mundwinkel Speichel tropfte.
"Jon?" sprach Jesco seinen ehemaligen Kameraden an. Mit der rechten Hand hob er das Kinn des aus der Bewusstlosigkeit Erwachenden leicht an. Ein neuerliches Stöhnen kam über Jons Lippen.
"Jon?"
Jesco bewegte Jons Kopf vorsichtig hin und her. Ein Zittern fuhr durch den Körper des Verletzten. Die Lider hoben sich ein wenig, doch der Blick ging ins Leere. Jesco musste Jon eine ganze Weile halten und sprach ihn dabei wieder und wieder an. Ihm kam der Gedanke, dass er den Fremden, der sich als "Freund der Familie Sleyvorn" bezeichnet hatte, den Auftrag hätte geben sollen, einen Arzt herbeizu holen. Allerdings war er sich ziemlich sicher, dass er mit dieser Aufforderung wohl auf Granit gebissen hätte.
Plötzlich kam ein Würgen aus Jons Kehle. Jesco konnte den Kopf des Verwundeten gerade noch rechtzeitig zur Seite drehen, sodass er sich nicht über seine eigene Kleidung erbrach. Am ganzen Körper zitternd gab Jon in mehreren Schüben seinen Mageninhalt von sich, von Würgen und ersticktem Husten begleitet. Jesco bekam einige Spritzer ab und der Geruch ließ in ihm Übelkeit aufwallen. Jetzt kam der Zeitpunkt, wo er sich zumindest eine Sekunde lang fragte, warum er sich dies alles überhaupt antat. Doch im nächsten Moment war Jesco wieder bewusst, dass niemand sonst da war, der sich kümmern konnte. Und wenn Gott sich nicht um ihn gekümmert hätte, als kein Mensch mehr da war, der auch nur einen Finger für ihn rührte, dann wäre er heute noch genauso verletzt und getrieben wie damals. Heilung konnte nur geschehen, wenn jemand da war, der sich über den anderen erbarmte.
So hielt er es aus, dass derjenige, der ihn eben noch hatte umbringen wollen, nun Teile seiner letzten Mahlzeit über ihn erbrach und dass sich ihm selbst der Magen dabei umdrehte. Als das Zittern und Würgen abebbte, wurde Jons Blick etwas klarer. Er schien Jesco zu erkennen, obwohl der alte Hass noch nicht in seinen Augen aufflackern wollte.
Jesco wischte Jon mit dem Mantelärmel über den besudelten Mund.
"Jon?" fragte er wiederum. "Hörst du mich?"
Die Antwort war ein kaum hörbares, zwischen den Zähnen herausgepresstes "Ja ... Mistkäfer".
"Meinst du, dass du aufstehen kannst?" erkundigte sich Jesco, das Schimpfwort ignorierend.
"Ich... esse... deiner Eier zum ... Frühstück", knirschte Jon hörbar mühsam.
"Na, herrlich", meinte Jesco. "Dir geht es also wieder gut."
Hinter seinem Rücken wurde in dem Moment Hufschlag hörbar, der eindeutig von einem sehr schweren Pferd stammte. Es war leicht zu erraten, wer dort in kräftigem Trab an den Klippen entlang ritt. Jesco wandte sich von Jon ab und warf einen Blick hinter sich. Einer der beiden derben, stattlichen Kaltblüter Elisa Sleyvorns näherte sich in einem Tempo, das man diesen gewaltigen Tieren kaum zutraute. Bei diesem Anblick konnte man sich ausmalen, wie mittelalterliche Ritter auf ähnlichen Pferden breite Gassen in die Reihen der Feinde schlugen. Auf dem Rücken des breiten Falben saß, zierlich und mit losem Haar, Tadeya. Ihre braunen Locken flogen bei jedem Schritt des Pferdes auf und nieder.
Einige Meter vor den beiden am Boden hockenden Männern zügelte sie das Pferd und warf einen Blick von weit oben auf sie herab.
"Da steckst du ja", stellte sie in nüchternem Ton fest. "Lass mich raten: Hat dein Gott heute einen ausgegeben und Geld statt Manna regnen lassen?"
Jesco konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. "So ähnlich", sagte er.
"Und dieser Kerl?" fragte sie. "Ist der auch vom Himmel gefallen? Kopfüber?"
"Deya, du kennst das doch", meinte er. "Ich kann dir die ganze Geschichte erzählen, aber ich kann sie dir wie immer nicht erklären. Wir könnten diesen Mann auf dem Pferd zum Arzt bringen, was hältst du davon?"
"Gut", stimmte sie zu. "Aber vergiss nicht, vorher das Manna einzusammeln."
------- ELISA SLEYVORN -------
Das kleine Gehöft lag ein gutes Stück außerhalb des Ortes und etwa eine halbe Stunde strammen Fußmarsches von Elisas Haus entfernt. Wie so oft verzichtete sie darauf, eines ihrer beiden Pferde für diesen Weg zu nehmen. Sie hielt sich die kräftigen Kaltblüter vor allem aus Freude an ihrer Robustheit und Stärke. Die Tiere täglich auf der großflächigen Weide bei ihren ruppigen Spielen oder beim ruhigen Grasen zu beobachten, bereitete ihr ein tiefes Behagen. Auch der Mann, der sich nach Auskunft des rothaarigen Robin, Robert Adlam nannte, schien einen Gefallen an starken Pferden zu haben. Er hatte seinen schwarzen Hengst auf dem Hof untergebracht, den Elisa hinter der nächsten Kurve bereits von Weitem erblicken konnte. Es handelte sich um ein über ein besonders schönes Tier; eine Mischung zwischen einem Kaltblut und einem temperamentvollen Kraftpaket, vielleicht einem Andalusier oder gar einem Araber.
Elisa hatte gleich gewusst, wer dieser fremde Mann war, als er vor wenigen Wochen plötzlich hier auftauchte. Sie hatte ihn genau beobachtet. Auch er hegte ein sichtliches Interesse daran, sie kaum aus den Augen zu lassen. Sie wäre lieber nicht mit ihm konfrontiert worden, hatte aber über all die Jahre ständig damit gerechnet.
Er suchte das Pferd täglich auf, um damit für etwa ein bis zwei Stunden vorzugsweise durch unbewohntes Gebiet zu reiten. Es waren ungestüme Ritte mit wenigen oder gar keinen Pausen. Die Bauersfrau sagte, dass das Pferd nach jedem Ausritt schweißnass war. Doch sein Besitzer versorgte es gut und fachkundig. Das Tier stand auf einer eigenen Weide, die von der Straße nicht einsehbar war. Baumreihen und eine lang gezogene Scheune versperrten die Sicht. Elisa ging zielstrebig um die Scheune herum. Sie erblickte das schwarze Pferd grasend am anderen Ende des eingezäunten Areals.
Robert Adlam zu sich nachhause einzuladen, war für sie nicht in Betracht gekommen. Sie wollte keinen näheren Kontakt zu ihm. Sie hatte in all den Tagen, die er sich bereits hier aufhielt, nicht einmal ein Wort mit ihm gewechselt. Allerdings konkurrierte der Wunsch, Abstand zu ihm zu halten, mit einer nagenden Neugier in ihrem Inneren, die sie nicht zurückzudrängen vermochte. Ihr Schicksal war mit seinem verbunden, das war nicht abzustreiten. Und genau das war ohne Frage auch der Grund, warum es ihn hierher gezogen hatte.
Sie legte die Hände auf das hölzerne Gatter, den Blick auf den schwarzen Hengst gerichtet. Mähne und Schweif des Tieres waren dicht und lang und verliehen dem Äußeren etwas Wildes. Deutlich konnte sie sogar auf die Entfernung unter dem glänzenden Fell starke Muskeln erkennen. Elisa würde es nicht langweilen, dieses Tier einfach nur zu betrachten, selbst wenn es Stunden dauerte, bis sein Besitzer eintraf. Er kam nie zur selben Uhrzeit her, das hatte sie von der Bäuerin erfahren. Doch war es zumeist vormittags zu relativ früher Stunde.
Es verging tatsächlich nur wenig mehr als eine halbe Stunde, bis Elisa hinter ihrem Rücken Schritte nahen hörte. Es waren kräftige, selbstsichere Schritte von einer Person, die sie zwar mit Gewissheit bereits wahrgenommen hatte, die jedoch ohne Zögern stetig direkt auf sie zuhielt. Die wenigsten Menschen, auf die sie in ihrem bisherigen Leben gestoßen war, ließen sich von ihrem Anblick nicht einschüchtern. Sie drehte sich um und sah ihm entgegen.
Er blickte ihr sofort geradewegs in die Augen und blieb kurze Zeit später vor ihr stehen. Sie reichte ihm die Hand. Es handelte sich um keine bloße Höflichkeit zur Begrüßung. Sie konnte oft mehr über einen Menschen erfahren, wenn sie ihn direkt berührte. Und in diesem Fall wäre es ihr nur recht zu spüren, welche Stärke wirklich in ihm lag. Sie war enttäuscht zu sehen, dass er Handschuhe trug, obwohl es heute bereits um einige Grad wärmer war, als in den letzten Tagen. Der Druck seiner Finger war nicht so fest, wie sie es erwartet hatte. Elisa spürte dabei einen merkwürdig schmerzhaften Stich in ihrem Inneren, den sie sich nicht erklären konnte. Sonst empfing sie nichts von ihm. Wahrscheinlich lag dies an dem dicken Leder der Handschuhe. Oder er blockte sie ab. Seine Augen blieben für die Zeit eines Lidschlags an dem Ring an ihrem Finger hängen.
„Meinen Namen brauche ich Ihnen nicht mehr zu nennen“, sagte sie. „Obwohl wir uns bisher noch nie gesprochen haben.“
„Was verschafft mir die Ehre, Frau Sleyvorn?“ fragte er ohne Umschweife.
Sie wusste, dass er erst sechsundzwanzig Jahre alt war, doch die starke Präsenz, die sie fühlte, war die einer sehr viel reiferen, mental gefestigten Person. Allerdings lag in seinem Blick mehr Kälte, als der nun langsam vergehende Winter jemals erzeugen konnte. Diese Tatsache machte sie umso neugieriger. Sie beschloss, das Gespräch nicht unnötig kurz zu halten.
„Sie scheinen sich ganz gut eingelebt zu haben, an unserer etwas unwirtlichen Küste“, meinte sie und zeigte ihm dabei ein kleines, ironisches Lächeln.
„Ich kann mich nicht beklagen“, war seine knappe Antwort.
„Außerdem habe ich gehört,“, fuhr Elisa fort, „dass Clara Neuberg ihre schwere Krankheit überwunden hat und bereits gestern Abend wieder mit ihrem devoten Lakaien in der Stadt gesehen wurde.“ Sie hob den Kopf ein wenig an. „Mein Eindruck, dass Sie ein weiches Herz für leidende Mitbürger haben, hat mich also nicht getäuscht.“
„Möchten Sie eine gut laufende Werft für einen Spottpreis kaufen?“ fragte er zurück. „Sie müssen schnell sein und nur einen Konkurrenten ausstechen.“
Elisa hob die Brauen. „Das haben Sie von ihm verlangt?“
Er erwiderte darauf nichts, sondern wandte seinen Blick von ihr ab und sah auf die Koppel hinaus. Elisa drehte sich kurz um und sah den Hengst mit aufgerichteten Ohren und schlagendem Schweif herantraben. Es hatte seinen Herrn erkannt.
„Hat dieses stolze Tier einen Namen?“ erkundigte sie sich.
„Nein“, gab er zurück.
Schnaubend und mit dem Vorderhuf scharrend blieb das Tier dicht am Gatter stehen. Ein unbändiger, muskulöser Riese.
Sie sahen sich wieder an und Elisa merkte deutlich, dass er trotz seiner Einsilbigkeit dieses kurze Treffen noch nicht beenden wollte. Er hielt das Halfter locker in der linken Hand und machte keine Anstalten, sich abzuwenden und zum Koppeltor zu gehen.
Doch sie fand, dass es an der Zeit für ihn wurde, seinen Stolz zu überwinden und selbst das Wort aufs Neue zu eröffnen. Ihr lag nichts daran, ihm jede Antwort buchstäblich aus der Nase zu ziehen. So blieb sie diesmal stumm und musterte ihn unverhohlen von Kopf bis Fuß. Seine Kleidung war wetterfest und sicher nicht gerade billig, doch äußerst schlicht. Die braunen Handschuhe wiesen einige dunkle Flecken auf. Er trug keine Kopfbedeckung und seine dunklen Haare waren kurzgeschnitten. Allein dieses Gesicht war es, das sicher nicht nur Elisas Blick magisch anzog. Er war hellhäutig und die schwarzen Augen standen dazu in einem herben Kontrast. Elisa würde es niemals eingestehen, dass der erste Anblick dieser Augen, die den ihren so ähnlich waren, einen tiefen Schmerz in ihrem Herzen ausgelöst hatte, der in diesem Moment schlagartig wieder in ihr Bewusstsein drang.
Ob sie es wollte oder nicht, die Erinnerung an jene fernen Tage, als Elmor ihr Kind zu sich genommen hatte, blieb unauslöschlich in ihr. Und das war der Grund, warum sie dem Mann, der sich Robert Adlam nannte, eigentlich niemals hatte begegnen wollen. Er brach das Schweigen zwischen ihnen.
„Elisa“, sagte er. „Du bist nicht gekommen, um mit mir über Clara Neuberg oder mein Pferd zu reden.“
Er ließ das „Sie“ beiseite. In Wahrheit waren sie einander nicht fremd.
„Du hast Recht“, antwortete sie. Dann verstummte sie wieder. Sie hatte das Gefühl, sich innerlich zu sehr in diese Sache verstrickt zu haben, um ihr eigentliches Anliegen glaubhaft an den Mann zu bringen.
Er wartete einige Sekunden. Als nichts mehr von ihr kam, wandte er sich ab und hatte mit einigen schnellen Schritten das Tor zur Weide erreicht. Er öffnete es und trat zu dem ungeduldig wartenden Hengst, der die dichte, schwarze Mähne schüttelte, bevor sein Herr ihm mit einigen geübten Handgriffen das Halfter überstreifte. Ihre Blicke waren ihm gefolgt.
„Robert“, sagte sie plötzlich und ihre Stimme klang laut und hart.
Er wandte den Kopf zu ihr.
„Hat er dir die Geschichte erzählt?“ fragte sie.
„Nein“, antwortete er. „Kein Wort.“
„Wieso bist du dann hier?“ wollte sie weiter wissen.
„Er hat alles aufgeschrieben“, sagte er.
„Und wo ist er nun?“ fragte sie weiter, obwohl sie die Antwort auf diese Frage offensichtlich besser kannte, als er.
„Vielleicht tot“, erwiderte Robert. „Wenn nicht, dann könnte er sich überall aufhalten.“
Er machte eine Pause, strich dabei dem Pferd über den glänzenden Hals und prüfte den Sitz des Halfters. Mit gesenkter Stimme fügte er erst nach einer geraumen Weile hinzu: „Zum Beispiel hier.“
Elisa beobachtete, wie er das Pferd, das den Kopf nun stolz erhoben hielt, von der Koppel führte. Er kam direkt zu ihr und blieb abermals vor ihr stehen.
„Du schweigst?“ fragte er und bedachte sie mit einem derart finsteren Blick, dass es Elisas Seele wie ein Schwert durchfuhr und ihr Inneres erschauerte. Nur ihrer ausgeprägten Selbstbeherrschung war es zu verdanken, dass sie dem unerwartet starken Angriff standhielt. Nun bekam sie eine kleine Probe dieser Kraft zu spüren, die zu fühlen ihr beim Händedruck verwehrt geblieben war. Nach allem, was Elisa in ihrem Leben begegnet war, hatte sie es kaum für möglich gehalten, dass sie irgendetwas noch auf diese Weise innerlich erschüttern konnte.
Sie straffte sich, hob das Kinn und verengte die Augen. Und sie antwortete noch immer nichts.
„Dann“, sagte er, „schweig von mir aus für immer.“
Damit drehte er sich um legte die Hände auf den Rücken des Pferdes und stemmte sich mit einem kräftigen Ruck hinauf. Sie hob den Blick zu ihm, über den Kopf des unruhig stampfenden Hengstes hinweg.
„Ich denke,“, stellte sie mit mühsam beherrschter Stimme fest, „du wünscht dir sehr, er sei tot.“
Er zog die Zügel straff an, sodass das Pferd mit seinen breiten Hufen auf der Stelle trat. Elisa hielt kurz inne, kostete den Moment der Spannung vor ihren folgenden Worten weidlich aus. Der Hengst stieß ein weiteres dumpfes Schnauben aus. Sie hatte sich das Katz-und-Maus-Spiel vor ihrer Nase absolut nicht gewünscht. Doch hatte es auch ohne ihr Einverständnis nicht ohnehin bereits begonnen? Warum zum Teufel sollte sie darin also nur eine unfreiwillige Nebenrolle spielen?
„Dein Wunsch“, erklärte sie nun in festem Ton, „ist dir nicht erfüllt."
Elisa war deutlich bewusst, dass das Spiel von diesem Augenblick an in Krieg umschlagen würde. Sie ließ sich von dem wilden Gebaren des Pferdes nicht beeindrucken, ihren letzten Worten fügte sie hinzu: "Er lebt. Und er ist hier.“
Diese kleine Offenbarung hatte sich allein für den Ausdruck in Roberts Gesicht gelohnt. Die steinerne Maske fiel schlagartig und gab für einen kurzen Moment den Blick frei auf einen wahren Sturm von Gefühlen. Obwohl Elisa Elmor kannte, konnte sie sich trotzdem kaum ausmalen, welche Art von Vorgeschichte diese heiße Mischung aus Hass, Zorn und Schmerz ausgelöst haben konnte.
Er riss den Kopf des Pferdes hart nach links und trat dem Tier in die Seiten, dass es einen gewaltigen Satz machte und im nächsten Moment im fliegenden Galopp davon stob. Elisa schaute ihm nach. Statt in Richtung des freien Feldes lenkte er den Hengst zur Straße und war gleich darauf hinter dem Gehöft verschwunden.
Sie konnte zwei und zwei zusammenzählen und sich ausmalen, was er vorhatte.
Aufgrund ihres Bundes mit dem Priester hatte sie Tadeya ohnehin verloren. Vielleicht war es das einzig Richtige, wenn jemand verhinderte, dass das offensichtlich grauenvoll fehlgeschlagene Experiment sich ein zweites Mal wiederholte.
------- ROBIN DUNGSLEAR -------
Obwohl das Haus eine kleine Festung darstellte, war es für ihn kein Problem, dort einzudringen. Er war geschickt mit den Händen und das wenige Werkzeug, das er benötigte, passte bequem in die Taschen seiner Kleidung. Es war außerdem nicht das erste Mal, dass sein Herr ihm die Anweisung gab, aus einem geschlossenen Haus etwas herauszuholen. Bislang war er dabei stets erfolgreich gewesen.
Robin stellte seinem Herrn keine Fragen. Er erfuhr immer genau so viel, wie es ihm bei seiner Arbeit von Nutzen war. Es bereitete ihm Freude, einem derart weisen Mann dienen zu dürfen. Sein Meister behandelte ihn wie seinen eigenen Sohn, mit großer Güte und Geduld. Sein wirklicher Vater hatte sich einen Dreck um Robin geschert.
Er wusste, dass Elisa Sleyvorn sich nicht im Haus befand. Sie führte den ihr gegebenen Auftrag aus. Man musste nicht heimlich hinter Frau Sleyvorns Rücken handeln, denn sie würde ihren Teil des Bundes freiwillig erfüllen, dessen war sich sein Meister sicher. Doch legte sein Herr großen Wert darauf, dass Herr Adlam zu diesem speziellen Zeitpunkt abgelenkt war, vertieft in ein Gespräch mit der wahrlich beeindruckenden alten Dame. Elisa Sleyvorn würde nicht sehr erfreut sein, dass der Priester sich selbst geholt hatte, was er brauchte, ohne eine offizielle Übergabe. Doch war es wohl ein schlauer Schachzug, die Aktion schnell und heimlich auszuführen und danach augenblicklich die Zelte an diesem Ort abzubrechen.
Das Innere des Hauses war düster, die Fenster mit schwerem Stoff verhangen. Die Dame war augenscheinlich eine Sammlerin von Antiquitäten aller Art. In rustikalen Regalen stapelten sich diverses altes Gerümpel und zahlreiche, verstaubte, abgegriffene Bücher. Für Robin bedeutete es keine Kunst, sich lautlos durch die dunklen Räume zu bewegen. Der alte Holzfußboden gab kein Knarren von sich, wenn er seinen Fuß darauf setzte. Ihm war die Anordnung der Räume genau beschrieben worden, sodass er sich gut orientieren konnte. Geräuschlos schlich er über den Flur und näherte sich der Kammer des Mädchens. Die Tür stand einen Spalt breit offen, sodass er in den Raum hinein lugen konnte. Dieser Umstand würde ihm sehr die Arbeit erleichtern. Und zu seinem weiteren Glück stellte er fest, dass Tadeya Sleyvorn sich tatsächlich in der Kammer aufhielt.
Dass sie nicht vollständig bekleidet war, veranlasste ihn, kurz schamhaft den Blick zu senken. Sie besaß einen zierlichen, hübschen Körper, der kaum verhüllt wurde durch die weiße, spitzenbesetzte Unterwäsche. Sie saß mit angewinkelten Beinen auf dem Fußboden, das Gesicht war von der Tür aus nur im Halbprofil zu sehen. Als Robin Sekunden später wieder aufsah, stellte er fest, dass Tadeya die Augen geschlossen hielt und ihre Lippen sich leicht bewegten. Ihr Haar fiel in dichten Wellen über den halb nackten Rücken. Das Licht der Morgensonne, das durch einen schmalen Spalt zwischen den Vorhängen in das Zimmer drang, zauberte einen hellen Streifen auf den Boden, der dicht an ihr vorüberführte.
Robin musste einmal tief durchatmen, um die Lähmung abzuschütteln, die ihm bei Tadeyas Anblick befallen hatte. Sein Herr würde ihm mit einem väterlichen Lächeln raten, den kleinen Jungen hinter sich zu lassen und doch recht bald ein Mann zu werden, wäre ihm Robins Verlegenheit in dieser Situation zu Gesicht gekommen. Doch Robin hatte mit Ausnahme seiner damals dreizehnjährigen Schwester niemals zuvor eine junge Dame in Unterwäsche gesehen.
Als sein Gehirn wieder einigermaßen klar funktionierte, und das dauerte eine kleine Weile, konnte er sich an der wirklich günstigen Gelegenheit freuen, die sich ihm hier bot. Es würde ihm ein Leichtes sein, die Tür vorsichtig ein Stück weiter aufzuschieben und durch das Blasrohr den winzigen Pfeil mit dem Betäubungsmittel auf Tadeya zu schießen. Danach wäre er in nur wenigen Minuten mitsamt dem Mädchen wieder draußen.
Robin griff mit der rechten Hand in seine Tasche, die Linke legte er auf die Türpfalz. Was im nächsten Augenblick geschah, erschien ihm so unwirklich wie ein Traum. Allerdings wie einer von außerordentlich lauter und erschreckender Sorte. Ein Traum, aus dem man im Normalfall augenblicklich in einer einzigen Schrecksekunde erwacht. Wie in einer gewaltigen Explosion zersprang mit unvorstellbarem Getöse das Fenster in dem eben noch so friedlich daliegenden Raum. Glasscherben regneten klirrend über Fußboden und Möbel. Die Vorhänge wurden mit einer solchen Wucht in das Zimmer gedrückt, dass sie zuerst wie zwei im Sturm wehende Fahnen wirkten, in der nächsten Sekunde aber mit einem lauten Knirschen die Gardinenstange von der Wand rissen und krachend zu Boden fielen.
Tadeya warf die Arme über den Kopf und duckte sich dicht auf die Erde, um sich vor dem Glashagel zu schützen. Robin stieß einem Automatismus folgend die Tür auf und lief in den Raum, um das Mädchen zu ergreifen und herauszuziehen. Er wusste nicht, womit er es hier zu tun hatte. Es ging ihm einzig darum, trotz aller Widrigkeiten seinen Auftrag zu erfüllen.
Doch er war nicht schnell genug.
Durch das zerstörte Fenster war, noch während die letzten Scherben herab prasselten, der Urheber dieses Chaos in den Raum getreten. Robin erkannte ihn auf der Stelle. Und er wusste genau, dass Robert Adlam der einzige Mensch war, den sein wirklich mächtiger Herr tatsächlich zu fürchten schien. Darum hielt er augenblicklich in seiner Bewegung inne und blieb auf halbem Weg zum Ziel stehen.
Robin sah, dass Tadeya die Arme sinken ließ, den Kopf hob und dem Mann entgegen blickte, der sich auf derart gewaltsame Weise Zugang zum Haus verschafft hatte. Sie stand vom Boden auf, als er sich mit schnellen Schritten näherte, die dunklen Augen fest auf sie geheftet. Da Robin direkt hinter Tadeya stand, war es völlig klar, dass er selbst nicht unentdeckt bleiben konnte.
Tadeya hob die Hände, als Robert nach ihr griff. Ihre Finger führten eine fließende Bewegung aus, während sie die Stimme erhob. Doch es kam nur eine einzige Silbe über ihre Lippen. Der Eindringling, den sie hatte abwehren wollen, erfasste im nächsten Moment ihr Handgelenk und ohne sichtbare Ursache sackte sie wie von einer unsichtbaren Faust getroffen zu Boden. Er ließ sie augenblicklich wieder los, während sie noch fiel.
Dann richtete er den Blick auf Robin.
Dies war eine der unangenehmsten Situationen in Robins Leben. Die Angst tobte in seinem Inneren und er war sich deutlich bewusst, dass nun vielleicht seine letzte Minute angebrach. Zum Weglaufen war es zu spät. Erstaunt musste er feststellen, dass seine Stimme, wenn auch etwas belegt, durchaus noch funktionstüchtig war. „Ich strecke die Waffen“, sagte er und in seiner ihm eigenen, ehrerbietigen Art neigte er dabei den Kopf. „Aber vielleicht darf ich Sie bitten, mir freies Geleit zu geben.“
Herr Adlam musterte ihn, bewegte leicht den Kopf hin und her.
Robins Mut sank. Doch dann plötzlich glaubte er, eine sehr dezente Spur von Erheiterung im Gesicht seines Gegenübers zu entdecken. Vielleicht gab es doch einen Funken Hoffnung auf ein Überleben?
Robert Adlam hob die Hand und machte eine kurze Geste in Richtung Tür. Robin zögerte keine Sekunde und wandte sich augenblicklich zum Gehen.
"Lass dich besser nicht mehr blicken, kleiner Prinz", hörte er die Stimme hinter seinem Rücken sagen. "Richte deinem Herrn aus, über diese Sache verhandele ich nur mit dem Regenten persönlich."
Der neue Weg
Sie haben ihr Lager in einem tiefen Tal aufgeschlagen, zwischen dem Fluss und einem ausgedehnten Waldstück. Naht man sich ihnen von Süden, wie ich es gestern tat, so hat man vom Berg aus einen prächtigen Blick weit über Zelte und Wagen, Menschen und Vieh. Dieses Völkchen sucht selten die Nähe von festen Ortschaften. Sie sind keine Gaukler und Taschenspieler. Sie bieten sich nicht dem modernen Stadtmenschen als Wahrsager oder Schuhputzer feil.
Auch das Äußere dieser Menschen ist unterschiedlich zu dem der allseits bekannten Zigeuner. Sie sind sehr hellhäutig, dennoch zumeist mit dunklen Haaren und Augen. Gemeinsam mit den Zigeunern ist ihnen, dass sie einen eher schmalen Körperbau besitzen. Die Größe der Erwachsenen liegt im mittleren Durchschnitt.
Ich war gelinde gesagt fasziniert, als ich in den alten Schriften zum ersten Mal auf dieses Volk gestoßen bin. Ihre Wurzeln sind weiter zurück zu verfolgen, als die irgendwelcher anderen Menschen, mit Ausnahme der Juden. Sie haben seit Jahrtausenden keine feste Heimat, sind fahrendes Volk. In der heutigen Zeit sind sie auf sehr wenige, vergleichsweise kleine Sippen geschrumpft. Wer sich mit einem Angehörigen eines anderen Volkes vermischt, verlässt die jeweilige Sippe. So sind sie bis heute relativ reinen Blutes. Und eine wahre Fundgrube an uralten Erbanlagen eines vergangenen Herrschergeschlechts.
Vielleicht ist es ihnen zuzuschreiben, dass man den Zigeunern das Beherrschen schwarzer Magie nachsagt. Doch die meisten Zigeuner sind nichts als geschickte Trickser. Ich habe trotz einiger Bemühungen nie einen halbwegs würdigen Schüler unter ihnen gefunden.
Aber dieses Volk ist einzigartig.
Sie nennen sich selbst Bacidas. Das Wort ist einer längst untergegangenen Sprache entnommen und bedeutet wahrscheinlich so viel wie "Ent-eignete". Sie selbst sagen, sie seien in ferner Vergangenheit ihrer Heimat beraubt worden. Seitdem befinden sie sich auf der Suche nach dem verlorenen, sagenhaften Land und nicht willens, an einem anderen Ort Wurzeln zu schlagen.
Ich habe die Bacidas bereits häufiger besucht. Ihre Gastfreundschaft hält sich sehr in Grenzen. Sie begegnen Fremden zumeist mit ungeschminkter Ablehnung. Aber mir ist es gelungen, die eine Beziehung zu knüpfen, die mir wichtig war. Ich muss nicht Freund der ganzen Familie sein, wenn mein Verlangen einzig einer ihrer Töchter gilt.
Es sind einige Jahre vergangen, seit ich Elisa zuletzt meine Aufwartung machte. Doch musste ich feststellen, dass meine Erinnerung an sie mich nicht trog. Ich bin weit in der Welt herumgekommen und habe dennoch nie eine Frau getroffen, die ihr annähernd gleichkommt. Die Anziehungskraft ihres Äußeren ist dabei von zweitrangiger Bedeutung. Vielmehr ist es derjenige Schatz, der im Inneren dieser Frau ruht, der mich ein weiteres Mal in den Bann geschlagen hat. Ein solches Juwel kann es nicht noch einmal auf dieser Erde geben, da bin ich mir sicher. Dass sie existiert und ich sie unter den Milliarden anderen gefunden haben, sind zwei äußerst glückliche Umstände, die ich nicht als Produkte reinen Zufalls zu bezeichnen vermag.
Durch Elisa wird meine Vision greifbares Fleisch und Blut.
Ich strebe aus tiefer Überzeugung stets danach, Männer als meine Helfer und Schüler um mich zu sammeln. Mit Frauen pflege ich keine Art von Zusammenarbeit.
Elisa ist die einzige ihres Geschlechts, die meinen Respekt verdient - sie zu meiner Feindin zu machen wäre eine große Dummheit, immerhin hat sie relativ mächtige Freunde. Elisa auf meiner Seite zu haben verspricht mir einen weitaus größeren Profit, ohne einen kräftezehrenden Kampf zu riskieren. Mein Bund mit ihr wird sich als lohnenswerte Investition erweisen.
Ich habe mich bei meinem Eintreffen im Tal auf kürzestem Weg zu ihr begeben. Sie war am Flussufer mit der Wäsche beschäftigt und hielt sich dabei, wie zumeist, etwas abseits der anderen Frauen. Die Menschen, an denen ich vorüberkam, warfen eher missmutige als neugierige Blicke auf mich. Die meisten von ihnen haben mich bereits diverse Male zuvor gesehen, doch war und blieb ich für sie ein Fremder.
Elisa ließ ihre Arbeit stehen und gesellte sich zu mir, um am Fluss entlang das Umfeld des Lagers zu verlassen. Ihr glattes, rabenschwarzes Haar trägt sie, wie damals, noch immer ständig offen. Doch sind schon viele graue Strähnen darin zu sehen. Auch ihr bei meinem letzten Besuch - trotz ihres nicht mehr jugendlichen Alters - noch beinah makelloses Gesicht hat heute einige feine Fältchen bekommen, die ihre Schönheit dennoch nicht trüben. Sie legte den Arm um meinen, und ich ließ es geschehen. Ich muss gestehen, dass ihre Berührung, wie schon vordem, ein Gefühl in mir auslöste, das mir nur aus meiner frühesten Jugend bekannt ist. Es ist mehr als bloße körperliche Erregung. In solchen Momenten wäre mir das Wissen lieb, sie töten zu können, wenn ich wollte. Doch ihre unsichtbaren Begleiter besitzen eine kaum abschätzbare Macht, sich mit ihnen anzulegen, würde große Mühen kosten. Und vielleicht noch mehr als nur Mühe.
Unser Gespräch bestand aus jenem reizvollen Balanceakt zwischen Distanz und Nähe, der mir aus damaligen Treffen noch in guter Erinnerung ist. Ihr war deutlich bewusst, was der Hauptgrund meiner Anwesenheit ist. Und sie versuchte keine Ausflüchte, sondern stellte sich dem Notwendigen mit bemerkenswerter Tapferkeit. Sie teilte mir mit, dass nicht nur für ihre Tochter, sondern auch für sie selbst der Tag des Abschieds von ihrem Volk gekommen sei. Sie habe entschieden, dass ein vollständiger Schluss-Strich am besten sei. Man habe sie aufgrund der Verbindung zu "dem Hünen" einmal zu oft zur Rede gestellt. Die Vermutung, das Mädchen, Jolin, sei in Wahrheit das Kind des Fremden, stehe ständig unausgesprochen im Raum. Und wenn Jolin mit dem heutigen Tag verschwände, würde es die Situation Elisas, ihrer Mutter, noch verschlechtern.
Deutlich spürbar war, dass die bevorstehende Trennung von ihrer Sippe sie schmerzte. Niemand, außer wir beide, weiß, dass Elisa vor vielen Jahren eine Entscheidung getroffen hat, die Rettung in tiefster Not für ihr Volk bedeutete. Ohne ihre Tapferkeit wären innerhalb weniger Jahrzehnte die Bacidas von diesem Erdball getilgt.
Der Bund zwischen mir und ihr hat das Überleben aller Nachkommen ihres Volkes gesichert. Der Preis dafür war, in Anbetracht des möglichen Verlustes, gering: ein Kind für das Leben vieler. Jolin gehört mir. Und mit ihr jegliche Frucht, die ihr Leib mir bringen wird.
Obwohl ich sie als kleines Kind zuletzt gesehen habe, hätte ich Jolin aus Tausenden halbwüchsiger Mädchen wiedererkannt. Sie besitzt die Züge ihrer Mutter, dazu dieselben nachtschwarzen Augen und eine für ihr Alter und ihre Sippe überdurchschnittliche Körpergröße. Ihr Haar ist, abweichend von Elisas, dunkelbraun und leicht lockig. Man sieht deutlich, dass sie den Weg zum Frausein bereits beschritten hat. Die richtige Zeit also, um meine Pläne mit ihr durchzuführen.
Aus dem Jungen, Asno, ist ein naseweiser Halbwüchsiger geworden. Er hat ständig acht auf seine kleine Schwester und ist lästiger als eine hungrige Ratte. Ich habe Anlass zu vermuten, dass Elisa ihm ein Wort zu viel erzählt hat. Sie ist dem Bengel auffällig stark zugetan. Asno ist mehr als nur ihr Sohn. Er wird einmal ihr Erbe sein.
Wenn ich mir den Jungen betrachte, wünschte ich mir, ich hätte den schleichenden Tod damals nicht von ihm abgewendet. Doch auf diese Weise hätte ich mir die Treue seiner Mutter nicht erkaufen können. Asno ist ein Ärgernis, stellt aber, nüchtern betrachtet, keine reale Gefahr dar. Ich sollte ihn und seine Frechheiten vorerst ignorieren. Bereits morgen Früh wird seine kleine Schwester, die zu schützen er als seine Aufgabe auserkoren hat, weit fort sein und auch er wird gemeinsam mit Elisa sein Volk verlassen müssen. Vielleicht ahnt oder weiß er das bereits, doch wird er es nicht verhindern können.
Elisas und meine Wege werden sich in dieser Nacht wieder trennen. Doch wird sie reichlich versorgt sein, das ist Teil unserer Abmachung. Ich werde beobachten, wohin sie geht. Dies ist nicht unser letzter Kontakt. Und wenn alles nach Plan verläuft, dann werde ich Jolin irgendwann zurück in die Obhut ihrer Mutter geben.
Elisa glaubt, ihre Tochter niemals wiederzusehen.
Sie wird überrascht sein.