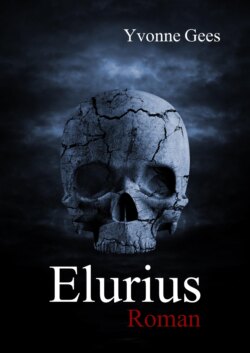Читать книгу Elurius - Yvonne Gees - Страница 5
Оглавление3. Spuren
------- JESCO FEY -------
Tadeya war nicht immer pünktlich. Dass sie jetzt noch nicht hier war, lag durchaus im Bereich des Normalen. Und doch verspürte Jesco eine merkwürdige Unruhe in seinem Inneren, als wenn irgendetwas ganz und gar nicht in Ordnung sei.
Am vorigen Abend hatten sich beide recht spät und etwas erschöpft voneinander verabschiedet. Den zwar angeschlagenen, aber äußerst aggressiven Jon zu einem Arzt zu bringen, hatte sich als wahrer Kraftakt erwiesen. Erst, als Jesco ihm den Koffer mit dem Großteil des Geldes gezeigt und gleich darauf in die Hand gedrückt hatte, schien so etwas wie Frieden über Jon gekommen zu sein. Die herablassende Bemerkung, wie denn so ein blöder Hund wie Jesco so plötzlich an ein solches Vermögen gekommen sei, hatte Jon sich dennoch nicht verkneifen können. Auf welche Weise er k.o. gegangen war, das blieb dem guten Jon ebenfalls ein Geheimnis. Seine Kopfverletzung würde ihm sicherlich noch über eine längere Zeit plagen. Die Übelkeit und Bewegungsstörungen hatten ihn jedenfalls noch längst nicht verlassen, als Jesco und Tadeya ihn schließlich in dem kleinen Ortshospital zurückließen.
Heute Morgen hatte Jesco in aller Frühe seine rückständige Miete von den wenigen Geldscheinen beglichen, die er für sich selbst zurückbehalten hatte. Selbstverständlich wusste er, an wen er wegen dieser glücklichen Wendung seinen Dank zu richten hatte. Die drei oft floskelartig verwendeten Worte "Gott-sei-Dank" besaßen eine tief gehende Bedeutung für ihn.
Tadeya hatte ihm allerdings angeraten, besser dem Mann zu danken, der Jon außer Gefecht gesetzt und anschließend das viele Geld zurückgelassen hatte. Obwohl dieser sich als "Freund der Familie Sleyvorn" ausgab, beteuerte sie Jesco, ihn nicht zu kennen. Aber sie wollte sich schon aus reiner Neugier bei Elisa über ihn erkundigen und Jesco gleich am nächsten Tag Bericht erstatten.
Doch heute Morgen erschien Tadeya nicht am Treffpunkt. Es nützte Jesco rein gar nichts, sich selbst einzureden, sie würde jeden Moment, vielleicht mit etwas verschlafenem Gesicht, hier auftauchen. Er fragte den Herrn, was denn dieses dumpfe Gefühl der Unruhe in seinem Inneren zu bedeuten habe und wartete auf Antwort. In den folgenden Minuten stellte er nichts Weiteres fest, als dass die böse Ahnung weiter anwuchs. Er beschloss, den Weg zum Haus der Sleyvorns einzuschlagen.
Jesco kam nur etwa zwei Meter weit, als er plötzlich harten, schnellen Hufschlag hinter sich hörte. Er blickte sich um. In gestrecktem Galopp sah er ein Ungetüm von einem schwarzen Pferd auf sich zukommen. Schnell machte er einen Schritt zur Seite und im nächsten Augenblick raste das Tier dicht an ihm vorüber. Kleine Steine wurden von den fliegenden Hufen aufgewirbelt und prasselten zu Boden. Jesco hatte trotz der immensen Geschwindigkeit, mit der das Pferd unterwegs war, den Reiter erkannt. Es war der selbst ernannte "Freund der Familie Sleyvorn". Und er hatte es anscheinend gewaltig eilig.
War er wohl auf dem Weg zu Elisa?
Jesco blickte ihm nach. Bevor Pferd und Reiter endgültig aus seinem Blickfeld verschwanden, sah er, dass der Mann auf der Weggabelung das Tier nach rechts lenkte und nicht zu den Sleyvorns. Nach rechts ging es entweder auf dem Weg an der Steilküste entlang zum Ort - oder hinunter zum Strand unter den Klippen.
Er gab dem Impuls, dem Reiter zu Fuß zu folgen, nach. Es schien Jesco fast sicher, dass er ihn am Strand wiederfinden würde. Erst an der Weggabelung beschlich ihn ein kurzer, leiser Zweifel, ob das, was er tat, vernünftig war. Tadeya daheim bei ihrer Großmutter zu suchen schien jedenfalls naheliegender, als diesem fremden Mann ohne erkennbaren Grund hinterher zu laufen.
Doch als er den Herrn danach fragte, wurde der Drang, nach rechts statt nach links abzubiegen, nur noch stärker. Also zögerte er nicht mehr länger und tat, was ihm offensichtlich aufs Herz gelegt war. Schon von Weitem erblickte er zwischen der Brandung des Meeres und dem steilen Felsüberhang am Strand das schwarze Pferd. In dem feuchten Sand zu Fuß einigermaßen schnell vorwärtszukommen entpuppte sich als ein mühsames Unterfangen. Der Wind wehte hier kräftig und kalt. Er kroch in Jescos Kleidung und ließ ihn erschauern.
Erst nach einer geraumen Weile war Jesco nah genug herangekommen, um erkennen zu können, dass unter den Klippen eine kleine, steinerne Hütte kauerte, die auf die Entfernung beinah unsichtbar war. Das Pferd stand direkt neben dieser gut getarnten Behausung. Es hatte den Kopf mit den bebenden Nüstern erhoben. Der Hals glänzte nass von Schweiß und die dichte Mähne wehte wie ein Banner im Wind.
Als Jesco noch näher herankam, erblickte er eine geöffnete Tür an der Seite des steinernen Unterschlupfs. Das Pferd schüttelte unruhig den Kopf und stampfte mit den Hufen im Sand. Der Reiter trat aus der Hütte heraus und legte dem Tier einen Sattel auf den Rücken. Aus seinen Bewegungen war abzulesen, dass er es eilig hatte. Die Schnalle am Bauch des Pferdes war schnell geschlossen und der Mann wieder in der Behausung verschwunden, ohne dass er auch nur einmal aufgesehen hätte. Jesco bemerkte, dass die Satteltaschen prall gefüllt waren.
Er wusste wirklich nicht, was er hier zu tun hatte. Doch Gottes Wege waren schließlich nicht seine Wege.
Seine Schritte führten ihn an dem schnaubenden Pferd vorbei direkt auf die geöffnete Tür zu. Sekunden, bevor er die Hütte erreichte, kam der fremde Mann, Herr Adlam, wieder heraus. Jesco blieb stehen. Der Mann sah ihn nur kurz an und ging, ohne inne zu halten, an ihm vorbei. Er befestigte zwei Beutel an dem Pferdesattel und er hob den Fuß in den Steigbügel, um aufzusitzen. Jesco hatte keine Ahnung, wie man ihn aufhalten konnte. Es war ihm nicht einmal klar, was er sagen sollte, denn er kannte den Grund, warum er hier war, selbst nicht. Und plötzlich kamen ihm Worte über die Lippen, die nicht seine eigenen waren. Er hatte sie noch heute Morgen in den Psalmen gelesen: "Der Hohn hat mein Herz gebrochen und es ist unheilbar; und ich habe auf Mitleid gewartet - aber da war keins...".(*FN* Psalm 69, 21 *FN*)
Der Fremde ließ seinen Fuß sinken, wandte sich zu Jesco um. In seiner Miene war deutliches Befremden abzulesen.
"Was ist das?" fragte er.
"Ein Text aus dem Alten Testament", erwiderte Jesco mechanisch.
Nach einem kurzen Moment der Stille wollte sein Gegenüber in vernehmlich schärferem Tonfall wissen: "Was willst du hier?"
"Wovor laufen Sie davon?" war Jescos Gegenfrage.
Doch der Mann war ganz offensichtlich nicht gewillt, darauf zu antworten. Seine Züge verhärteten sich. Er schüttelte den Kopf, drehte sich wieder zu dem Pferd und stemmte sich in den Sattel.
"Ich glaube,", sagte Jesco in festem Ton, "dass Gott zu Ihnen sprechen möchte." Denn das war es, was er in seinem Inneren spürte.
Der Mann wandte ihm wieder das Gesicht zu, doch in seiner Miene war nichts als kalter Spott zu lesen: "Richte ihm aus, wenn du ihn triffst: Es ist zu spät, falls er es noch nicht bemerkt hat."
Das Pferd riss an den Zügeln und konnte den nächsten Galopp offensichtlich kaum erwarten. Doch Herr Adlam hielt es noch zurück und richtete die Augen über den Kopf des Tieres hinweg den Strand hinauf. Jesco folgte seinem Blick. Von Weitem erblickte er ein sich schnell nahendes Pferd, einen schlanken Fuchs. Jesco kniff die Augen zusammen, denn er glaubte im ersten Moment, nicht richtig zu sehen: Der Reiter des Fuchses trug eine schwarze Kapuze über dem Kopf, die nur mit schmalen Sehschlitzen versehen war. Außerdem war er in ein schwarzes Gewand gehüllt, das hinter ihm im Wind flatterte. Dies war ein wahrlich bizarrer Anblick.
Die vermummte Gestalt näherte sich rasch. Und als der gesichtslose Reiter bis auf wenige Meter herangekommen war, hob er den Arm und schleuderte ein dunkles Stück Stoff in den Sand, direkt vor die Füße des schwarzen Hengstes. Einen Augenblick später wendete der Fuchs in einem solchen Tempo, dass es ihn dabei beinah von den Beinen riss. Sand stob unter den Hufen auf.
Herr Adlam gab die Zügel des Hengstes frei und das Tier machte einen mächtigen Satz nach vorn. Im nächsten Moment war das schwarze Pferd an der Seite des davongaloppierenden Fuchses. Innerhalb von Sekundenbruchteilen wurde der Reiter des roten Pferdes aus dem Sattel gerissen, fiel rücklings herunter und klatschte in den feuchten Sand. Was diesen Sturz genau verursacht hatte, das konnte Jesco nicht erkennen. Herr Adlam hatte nicht einmal die Hand nach dem Vermummten ausgestreckt.
Jesco setzte sich in Bewegung, in Richtung des Gestürzten, und hob unterwegs das Stoffstück von der Erde auf. Er sah, dass der Fuchs noch einige Galoppsprünge machte, dann aber in eine langsamere Gangart fiel und in einiger Entfernung schließlich stehen blieb. Herr Adlam wendete sein Pferd und saß neben dem am Boden liegenden Mann ab. Jesco erschien diese Szene beinah wie ein dejà vue Erlebnis: Schon wieder lag dort jemand reglos auf der Erde und Herr Adlam beugte sich über diese Person. Er fragte sich ernsthaft, ob dies nun zu einer täglichen Routine werden würde. Jesco erreichte den Ort des Geschehens, als Herr Adlam gerade den Gestürzten offensichtlich nach Waffen abgetastet, irgendetwas in seine Manteltasche gesteckt und anschließend der Person die Kapuze vom Kopf gezogen hatte. Darunter kam das Gesicht eines etwa vierzigjährigen Mannes zum Vorschein, der einen ungepflegten Schnurrbart trug und mit geweiteten, wasserblauen Augen zu ihnen hinauf starrte.
"So wenig wert bist du deinem Meister, dass er dich dies hier tun ließ", sagte Herr Adlam zu ihm. "Du bist für ihn ein Bauernopfer."
Der am Boden Liegende konnte offensichtlich nichts antworten, denn die Angst hatte ihren festen Griff um seine Kehle gelegt. Jesco hielt Herrn Adlam das schwarze Stoffstück hin. Es handelte sich um eine Kapuze, ähnlich der, die der vermummte Reiter getragen hatte. Herr Adlam nahm ihm die Kapuze aus der Hand und besah sie sich einen Moment. Seine Miene blieb dabei verschlossen. Jesco hatte keine Ahnung, was in seinem Gegenüber vorging. Er erkannte nur, dass dieses Mitbringsel ihn nicht gerade freute. Dann plötzlich bückte Herr Adlam sich und zog dem Mann zu seinen Füßen das schwarze Stück Stoff über den Kopf. Jetzt erst stellte Jesco fest, dass diese Kapuze keine Sehschlitze besaß.
"Und nun: Steh auf", forderte Herr Adlam den Mann auf, dessen Gesicht nun wieder komplett verhüllt war. Als dieser nicht reagierte, griff er nach den Armen des Mannes und zog ihn auf die Beine. Der Reiter hatte den harten Sturz ganz offensichtlich nicht unverletzt überstanden, denn er gab ein gequältes Ächzen von sich und dumpf waren unter der Kapuze die Worte "Bitte... nicht..." zu hören.
Jesco musste an die Psalmworte denken, die vorhin aus seinem Mund gekommen waren. Nur verschwommen konnte er sich an Zeiten erinnern, als sein eigenes Herz voll Hohn und Spott für Gott und die Welt gewesen war. Doch die Mitleidslosigkeit, die er hier sah, tat ihm in der Seele weh und hätte ihn auch früher nicht unberührt gelassen. Herr Adlam ließ sich von dem Flehen des sich vor Schmerzen krümmenden Mannes keine Spur beeindrucken. Er zwang den Verletzten zum Stehen und hielt ihn mit beiden Händen fest.
"Was hat er getan, dass Sie so mit ihm umgehen?" fragte Jesco. "Ich sah nur, dass er ein Stück Stoff vor Ihnen in den Sand warf."
Herr Adlam zog den sich windenden Mann zu dem schwarzen Pferd. Wieder kamen die schmerzhaft lang gezogenen Worte "bitte.... nicht", unter der Kapuze hervor.
"Er hat sich mit den falschen Leuten eingelassen", war die Antwort in barschem Ton.
Herr Adlam zwang den Verletzten auf das Pferd. Der Mann rutschte immer wieder an der Seite des Tieres ab und kam kaum hinauf.
"Sie gehen mit Menschen um, wie mit Vieh", stellte Jesco fest.
"Wenn dich das stört", meinte Herr Adlam, "dann versuch den Trick mit dem Messer doch noch einmal."
"Sie wissen, dass ich es nicht mehr habe", sagte Jesco und trat gleichzeitig näher heran. Der Vermummte war inzwischen auf den Pferderücken gelangt und lag vornüber gebeugt auf dem Hals des Tieres. Jesco streckte die Hand aus und legte sie dem zitternden Mann auf das Bein. Damit hatte er den Arm direkt zwischen Herrn Adlam und seinen Gefangenen gestreckt.
Jesco wandte das Gesicht Herrn Adlam zu und bat innerlich um Beistand. Seine Wahrnehmung schien geschärft und er war sich deutlich bewusst, dass er sich hier in große Gefahr begab. Doch er empfand in diesem Moment keine Angst, sondern ungewöhnliche innere Ruhe. Herr Adlam entgegnete seinem Blick und Jesco sah in den Augen seines Gegenübers heißen Zorn aufblitzen.
"Ich bitte Sie hiermit um Gnade für diesen Mann", sprach Jesco mit ruhiger Stimme. "Was immer er getan hat, bitte verzeihen Sie ihm und haben Sie Mitleid."
Herr Adlam ließ den Verletzten los und drehte sich nun ganz zu Jesco. Seine dunklen Augen funkelten böse: "Du hast genau zwei Sekunden, Jesco Fey, um dich umzudrehen und wegzulaufen. Ich werde mich nicht mehr in deine Angelegenheiten mischen - ebenso wie du nicht mehr in meine."
Jesco hob beide Hände und zog damit seinen Arm zurück. Er streckte seinem Gegenüber die leeren Handflächen entgegen. "Ich greife Sie nicht an", stellte er fest. "Ich halte keine Waffe in der Hand. Ich bin nur ein Bittsteller. Es ist nicht nöitig, mir zu drohen."
Die Hand von Herrn Adlam fuhr in seine Manteltasche, aus der er eine schwarze Pistole hervorholte. Mit geübtem Handgriff entsicherte er die Waffe, während der Lauf auf Jesco gerichtet war. Dann drehte er die Pistole herum, dass der Lauf auf ihn selbst zeigte, und drückte sie Jesco in die dargebotene Rechte.
"Du bist befördert", sagte er. "Vom Bittsteller zum Gesetzeshüter. Ich weiß, dass du kämpfen kannst. Also: Tu es."
Jesco konnte sich nicht erinnern, jemasls auf einen solchen Zynismus getroffen zu sein. Mit dem kalten Metall in der Hand fühlte er sich mit einem sehr Mal hilflos. Er hatte selbst einmal eine sehr ähnliche Waffe besessen. Die Erinnerung daran, welch ein Gefühl von Überlegenheit ihn in solchen Momenten überkommen hatte, wenn er das Tötungsinstrument auf einen Menschen richtete, überwältigte ihn für einen Augenblick. Doch der Preis für diese Art von Stärke war viel zu hoch gewesen. Nichts in dieser Welt war verzehrender als die fatale Kombination von Menschenhass und Stolz, die damals in ihm gewachsen war. Er war sich selbst der Nächste gewesen, in einer Welt voller Feinde.
Er war sich bewusst, dass seine Stimme ein wenig zitterte, als er, die Waffe noch immer genau so haltend, wie sie ihm gegeben worden war, fragte: "Wer auf der Welt war so unbarmherzig zu Ihnen, dass das aus Ihnen geworden ist: ein Spötter und Menschenfeind? Wer hat mit seinem Hohn Ihr Herz gebrochen?"
Herr Adlam trat einen Schritt von ihm zurück. Sein Blick blieb finster, doch der brennende Zorn war erloschen. Er schaute Jesco nur an und gab keine Antwort. Dann plötzlich wandte er sich ab und stieg hinter dem Verletzten auf sein Pferd.
Ein stummes Kopfschütteln, das war es, was Jesco sah, bevor Herr Adlam das Pferd wendete und es zu dem einige Meter entfernt stehenden Fuchs lenkte. Den kraftlos nach vorn gesackten Mann vor sich mit einem Arm umfassend, beugte er sich zur Seite, griff nach dem Zügel des anderen Pferdes und befestigte es am Sattelknauf. Dann entfernten sich Pferde und Reiter im Schritt-Tempo.
Jesco senkte den Blick zu der Waffe in seiner Hand. Er musste hart schlucken, denn sein Inneres war aufgewühlt wie kaum jemals zuvor. Im Grunde genommen war ihm zum Heulen zumute.
"Herr,", bat er inständig, "bitte bring Heilung. Hier kannst nur noch du helfen.“
Der neue Weg
Dank Elisas nasenweißen Jungen, Asno, blieb unser Aufbruch aus dem Lager der Bacidas bei weitem nicht so unbemerkt, wie geplant. Ich habe schon gestern geahnt, dass das Kind Ärger machen wird. Und ich möchte bezweifeln, dass man Elisas Worten glauben kann, sie habe dem Jungen weder etwas von ihrem Fortgehen noch von unserem Geheimnis erzählt. Elisa hängt mit beinah abgöttischer Liebe an dem aufmüpfigen Knaben. Ich erinnere mich nur zu gut daran, dass sie ohne zu zögern bereit gewesen wäre, allein für ihn ihr eigenes Leben zu geben, als die Kinder ihres kleinen Volkes im Sterben lagen. Er wird mir ein Unterpfand sein, dass Elisas Loyalität auch in Zukunft mir gelten wird.
Asno weigerte sich hartnäckig, von der Seite seiner Schwester zu weichen. Und er war ständig darauf aus, einen Streit mit mir anzufangen. Ich ließ mich nicht von diesem halbwüchsigen Rebellen und seinen unreifen Bemerkungen provozieren. Doch frage ich mich ernsthaft, warum er einem eigentlich völlig Fremden gegenüber auf diese herausfordernde Weise auftritt. Sicher reagieren auch die ihn umgebenden Menschen ablehnend auf alle Personen, die nicht ihrem eigenen Volk entstammen. Doch ist die Ablehnung bei ihnen eher passiver Natur, währenddessen er mir gegenüber von Anfang an in Angriffsstellung ging.
Sein völlig überflüssiges Theater erregte mehr Aufmerksamkeit, als mir lieb war. Und statt ihren aufsässigen Sohn in die Schranken zu weisen, verfiel Elisa in ein beharrliches Schweigen. Obwohl sie kaum eine Miene verzog, bemerkte ich doch, dass sie mehr als nur Stolz auf ihren vorlauten Sprössling empfand. Also musste ich sie beiseite nehmen und ihr sagen, dass, wenn sie den Jungen nicht sehr bald schlafen schickte, ich es tun würde. Elisa erwiderte darauf nichts, schien aber nicht sehr erbaut über diese Worte.
Schließlich entschied sie sich dafür, den Arm um Asno zu legen und mit ihm im Dunkel des bereits nächtlichen Lagers zu verschwinden. Jolin, die bereits aufgrund der fortgeschrittenen Stunde sehr müde war, bleib allein bei mir zurück. Sie ist ein stilles, aber äußerst kluges und willensstarkes Mädchen. Die hoch kostbaren Anlagen, die in ihr schlummern, liegen wie ein offenes Buch vor mir. Welch ein gewaltiges Potential, dass nach etlichen Jahren des Forschens, der Suche und des Wartens endlich in meine Hand gegeben ist!
Ich beschloss, nicht auf Elisas Rückkehr zu warten. Jolin, die mir mit sehr viel weniger Ablehnung gegenüber trat, als ihr großer Bruder, und sogar eine zurückhaltend geäußerte, aber intensive Neugier gegenüber meiner Person zeigte, war mit wenigen Worten dazu zu bewegen, mir zu folgen. Ich hatte gleich bei unserer ersten Begegnung das Erkennen in ihren Augen gesehen. Sie wusste vom ersten Augenblick an, dass uns etwas Bedeutsames miteinander verband. Und sie war offensichtlich gespannt darauf, zu erfahren, um was genau es sich handelte.
Der kleine Tumult, der nur wenige Minuten darauf im Lager losbrach, als Jolin und ich gerade den letzten Wagen hinter uns gelassen hatten und gemächlichen Schrittes, wie zu einem kurzen Spaziergang, Seite an Seite im Mondlicht wanderten, war fraglos durch Asno verursacht worden. Plötzlich erhoben sich laute Stimmen hinter unserem Rücken. Und über allem Lärm war deutlich Asnos Ruf nach seiner Schwester zu hören. Dass sie ihm Antwort gab, wusste ich zu verhindern.
Schon sehr bald ist die Stunde gekommen. Eine Vereinigung der neuen Art wird stattfinden. Und doch wird daraus etwas Uraltes in einem Kind heutiger Zeit zum Leben erwachen. Ich bin zuversichtlich, dass meine Pläne gelingen werden, obwohl nie zuvor in der Geschichte ein vergleichbares Projekt durchgeführt wurde. In der Tat bin ich in all der Zeit, die ich den Erdball bereise, niemals einem Menschen begegnet, der auch nur eine Ahnung von der Macht unserer frühesten Vorfahren hat. Man ist heute allseits bereit, die neuen Lehren anzunehmen, unser Geschlecht sei aus dem Tierreich hervorgegangen. Lamarck sprach bereits um die Jahrhundertwende von der Höherentwicklung der Lebewesen durch Vererbung erworbener Eigenschaften. Die neuesten Werke von Chambers und einem verblendeten Engländer namens Darwin vergehen sich in pseudowissenschaftlichen Theorien über dieses Thema. Doch Darwins Finken sind ebenso wie die heutigen Menschen eine stark spezialisierte und damit in ihren Erbanlagen eingeschränkte, schlicht degenerierte Lebensform.
Die Theorie über die "Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl" ist nichts weiter als eine als Naturwissenschaft getarnte neue Form des Aberglaubens. Der sogenannte denkende Mensch möchte die Kräfte des Übernatürlichen wegdiskutieren, weil sie seinem reinen Materialismus im Wege stehen.
Blind sind sie allesamt, meine lieben Zeitgenossen.
Ich habe im afrikanischen Urwald einen wahren Herrscher gefunden. Einen König und Priester alter Art, der entwicklungsgeschichtlich weit über dem modernen Menschen thront. Sie selbst sind kaum mehr als Tiere verglichen mit diesem erhabenen Vorfahren. Das alte Erbe ist über Tausende von Jahren verblüht - und siehe, in dieser Zeit ist nunmehr der kärgliche Rest davon übrig.
Doch das, was ich in Jolin gefunden habe, wird ausreichen, den alten Samen erneut keimen zu lassen:
Der alte Herrscher wird Vater werden.
Vater eines einzelnen oder gar eines ganzen Volkes.
Der neue Mensch alten Blutes wird, wie seine Ahnen vor Urzeiten, wahre Macht ausüben, statt ein blinder und tauber Spielball ihm fremder Mächte zu sein.
------- ROBERT ADLAM ------
Er war eine ganze Weile geritten, bis zu diesem ihm unbekannten Nadelwaldstück. Seine Sinne waren während des gesamten Weges aufs Äußerste geschärft. Für einen eventuellen Verfolger gab es keine Anzeichen. Doch war er sich nicht völlig sicher, dass er die Nähe des so genannten schwarzen Priesters tatsächlich wahrnehmen würde. In der Tat hielt sich Elmor wahrscheinlich schon seit Tagen oder gar Wochen in unmittelbarer Umgebung des kleinen Küstenortes auf, ohne dass Robert auch nur eine Ahnung darüber beschlichen hatte.
Zwischen den Kiefern lag ein kleiner, etwas sumpfiger Teich. Es gab also Wasser für die Pferde. Jegliche menschliche Ansiedlung lag ein gutes Stück entfernt.
Der verletzte Mann, um den er fest den linken Arm gelegt hielt, hatte sich seit einiger Zeit nicht geregt. Anfangs hatte der Verletzte bei stärkeren Bewegungen des Pferdes noch gestöhnt und gejammert, doch nun war er still geworden. Auch das Zittern des kraftlos nach vorn gesackten Körpers hatte aufgehört. Robert zügelte den Schwarzen direkt neben dem Wasser. Er löste den Haltegriff um den vor ihm Sitzenden. Dessen Oberkörper sank hinab auf den Hals des Pferdes. Robert stieg ab, während beide Tiere die Köpfe zum Trinken senkten. Er nahm die Zügel des Fuchses vom Sattelknauf und ließ sie fallen, sodass das Tier mehr Bewegungsfreiheit hatte, um das Maul zum Wasser zu führen. Dann löste er den Gurt am Bauch des schlanken, roten Pferdes und warf den Sattel auf den Waldboden. Unter dem Sattel war das Fell des Tieres kaum feucht, es war nur über kurze Zeit in hohem Tempo geritten worden und der Schweiß war auf dem langsameren Weg ohne Reiter getrocknet.
Robert hatte den fuchsigen Wallach auf den ersten Blick erkannt. Dieses Tier war von seinen eigenen Pferdepflegern mit der Flasche großgezogen worden. Die Stute, die es auf die Welt gebracht hatte, wäre an den Komplikationen während der Geburt beinah gestorben und musste danach mühsam wieder hochgepäppelt werden. Der elegante, schlanke Fuchs stammte aus seiner eigenen Zucht, die er vor etwas mehr als einem Jahr mitsamt seinem Wohnsitz und aller zugehörigen Güter aufgegeben hatte. Das Tier vor sich zu sehen war, als habe sich ein kleines Fenster in ein anderes Leben geöffnet. Doch die meisten Erinnerungen blieben fern und dumpf. Und diejenigen, die ihm noch klar und deutlich vor Augen standen, waren wie glühende Kohlen in seinem Inneren. Davon konnte er nichts vergessen.
Er wandte sich um, griff mit beiden Händen nach dem leblosen Körper auf dem Rücken des Schwarzen und zog ihn an der Seite des Tieres herunter. Der ziehende Schmerz, der dabei in seinen Händen aufflammte, war ein weiteres Andenken aus einem früheren Kapitel seines Lebens. Es hatte lange gedauert, bis es ihm gelungen war, die Finger wieder so weit zu krümmen, wie es ihm heute möglich war. Und noch immer war jede Greifbewegung eine kleine Tortur. Doch er benutzte seine Hände unter Missachtung der Schmerzen wenn möglich genauso wie vorher. Vielleicht würde es irgendwann einmal besser werden. Vielleicht auch niemals.
Mit nicht allzu großer Vorsicht ließ er den bewusstlosen Mann auf den Boden sinken. Dann sattelte er den Schwarzen ab, der deutlich mehr geschwitzt hatte, als der Wallach. Aus einem der am Sattel befestigten Beutel zog er eine Decke hervor, mit der er das feuchte Fell des Tieres abrieb, während der Hengst noch immer gierig trank. Danach wandte sich Robert wieder der Gestalt am Boden zu. Er kniete sich neben den Mann und zog ihm, nach kurzem Zögern, die Kapuze vom Kopf. Was er nun in den Händen hielt, war nichts weiter, als ein einfacher, schwarzer Sack. Doch er hasste den bloßen Anblick. Fast konnte er Elmors tiefes, väterliches Lachen hören: "Ja, mein Lieber, nun schweigen die Waffen. Es ist Zeit für ein Gespräch unter Freunden." Zweimal hatte Elmor ihn mit diesem einfachen Mittel schachmatt gesetzt. Beim ersten Mal, um ihn zu einem Treueschwur zu zwingen. Und beim zweiten Mal, um ihn auf einem steinernen Altar langsam verbluten zu lassen, weil er die erzwungene Treue nicht hatte einhalten wollen.
Er legte die Kapuze beiseite.
Dann zog er einen der Handschuhe aus und legte seinen Handrücken an die Halsschlager des Bewusstlosen, weil er wusste, dass er mit den Fingern den Puls nicht spüren konnte. Für derart feine Empfindungen waren sie nicht mehr brauchbar.
Der Puls war kräftig, beinah normal. Sein Gefühl, dass der Mann relativ stabil war, trog ihn wohl nicht. Doch hatte dieser sich ohne Frage einige Knochen gebrochen bei dem Sturz aus vollem Galopp. Robert empfing bei der Berührung des Verletzten deutliche Signale des zerschlagenen Körpers. Er zog die Hand zurück und streifte sich den Handschuh wieder über. Dann ließ er sich aus der knienden Haltung zurücksinken und setzte sich auf den mit Moos bewachsenden Boden. Er beobachtete einige Zeit die beiden Pferde. Der Schwarze reckte den Hals nach einem tief hängenden Zweig und schüttelte bei der Berührung seines Mauls mit den Baumnadeln widerwillig den Kopf. Der Fuchs wiederum machte mit gesenktem Kopf einige Schritte am Wasser entlang, blieb dann stehen und suchte den Boden nach fressbarem Grün ab. Doch an diesem Ort gab es kaum etwas Nahrhaftes für die Tiere.
Robert wusste nicht, wohin er nun gehen sollte. Das Mädchen hatte er schnell genug versteckt, sicherlich noch bevor Elmor von dem Scheitern seines Entführungsplanes erfahren hatte. Doch es stellte ein Risiko dar, das Versteck jetzt oder später wieder aufzusuchen. Er wollte den Schwarzen Priester nicht auf direktem Weg zu dem Objekt seiner Begierde führen. Es war nicht einzuschätzen, ob und auf welche Weise Elmor Robert beobachtete. Denn an einem Umstand hatte sich auch in dem einen vergangenen Jahr nichts geändert: Der schwarze Priester war seinem ehemaligen Schüler an Wissen weit voraus. Er hatte Robert unterwerfen wollen, bevor er seine weiterführenden Kenntnisse mit ihm teilte. Doch diese Unterwerfung war in einem Inferno aus Blut und Feuer gescheitert.
Robert hatte seinen Unterschlupf am Strand geräumt, um nicht dort, womöglich im Schlaf, überrascht zu werden. Doch wirklich sicher davor war er auch an keinem anderen Ort. Er hatte sich zwei Ziele gesetzt. Das erste war, um wirklich jeden Preis zu verhindern, dass Elmor mit Tadeya davonkam. Niemals mehr sollte der Schwarze Priester die Chance bekommen, seinen zerstörerischen Pfusch an der Natur zu wiederholen. Das zweite Ziel bestand darin, Elmor aus seinem Versteck zu locken und ihm Auge in Auge gegenüberzustehen. Robert wusste, dass Elmors Ruf weithin für ihn hörbar wäre, sollte der Schwarze Priester mit ihm verhandeln wollen. Er würde auf diesen Ruf reagieren. Am Ende wollte er nicht nur annehmen müssen, sein Feind sei tot. Er wollte es diesmal wissen, auch wenn er dafür wieder einmal durch die Hölle gehen musste.
Er konnte es nicht akzeptieren, dass der Mann noch am Leben war, der sich selbst zu seinem Gott aufgeschwungen hatte. Der ihn aus totem Samen gezeugt und im Leib einer jungen Frau hatte heranwachsen lassen, die in seinen grausamen Händen innerlich gestorben war. Der nicht einmal die Stirn besaß, diese bizarre Geschichte dem Produkt seines Größenwahns mitzuteilen.
Bei fremden Menschen hatte Elmor das Erzeugnis seines Experiments aufwachsen lassen. Das neugeborene Kind der Familie hatte er heimlich fortgenommen und dafür sein Kuckucksei eingeschmuggelt. Robert Adlam war schon lange tot. Derjenige, der an seine Stelle getreten war, so lange, bis die Familie ausgedient hatte und ebenfalls vom Erdboden getilgt wurde, besaß keinen eigenen Namen. Vielleicht hatte er nicht einmal ein reelles Anrecht, zu leben.
Doch er war am leben, auch wenn er das nicht immer spürte. Seit dem Tag, als er sich mit zerschnittenen Händen, mehr tot als lebendig von dem Opferstein erhoben hatte, um mit letzter Kraft den Schwarzen Priester in die Knie zu zwingen, war es in seinem Herzen zumeist kalt und leer. Die Fähigkeit zu lieben hatte er verloren. Selbst als er nach Monaten der Suche auf einen Teil seiner wahren Familie gestoßen war, hatte er sich nicht wirklich zu diesen Menschen hingezogen gefühlt. Er war in Elisas und Tadeyas Nähe geblieben, weil es zurzeit keinen besseren Ort gab, zu dem er gehen konnte.
Die selteneren Zeiten, wenn die Leere aus seinem Inneren wich, waren von Schmerz und einem heißen Zorn erfüllt. Tadeyas heimlicher Verlobter hatte eine offensichtliche Gabe, in Wunden herumzustochern. Hätte Jesco doch nur versucht, die ihm in die Hand gelegte Pistole wirklich zu benutzen. Ein zweites Mal hätte Robert ihn nicht mit solcher Zurückhaltung behandelt. Doch dieser Kerl war jemand, der zuerst mutig Anlauf nahm und dann plötzlich aufgab.
Der verletzte Mann kam langsam wieder zu Bewusstsein. Er schlug die Augen auf, schloss sie wieder und öffnete sie erneut. Dann drehte er langsam den Kopf, zuerst nach links und danach nach rechts. Als er Robert neben sich am Boden sitzen sah, hielt er in der Bewegung inne und starrte ihn an. Sein Mund bewegte sich, doch es kam vorerst nur ein heiseres Krächzen heraus. Er räusperte sich, fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und versuchte noch einmal zu sprechen. Diesmal kamen zwar heisere, aber verständliche Worte heraus, in einem deutlichen Ton der Verwunderung. "Ich... lebe noch...".
"Tatsächlich", sagte Robert mit wenig Interesse.
"Wo ist der...", begann der am Boden Liegende und seine Augen wanderten einige Sekunden lang suchend umher. Aber er fand nicht, wonach er Ausschau hielt: den Mann, den er für ihn um Gnade hatte bitten hören.
Robert antwortete ihm auf die nur halb ausgesprochene Frage nicht.
Die auffällig hellblauen Augen des Mannes fanden wieder ihren Fokus auf Roberts Gesicht. Blass, sehr blass tauchte ein Bild in Roberts Kopf auf von einer jungen Frau, deren Iris dieselbe helle Farbe besessen hatte. Er war erst fünfzehn gewesen, Elmors getreuer Schüler seit bereits zwei Jahren, und hatte die Frau, eine zum Sterben verurteilte Gefangene des Priesters, von ihren Fesseln befreit. Mit diesem Tag war in seinem Herzen eine Rebellion ausgebrochen, die zur gewaltsamen Trennung von seinem Meister geführt und einen ein Jahrzehnt dauernden Stellungskrieg eingeläutet hatte.
Es war offenkundig, wie der Verletzte zwischen Hoffnung und Angst schwankte. Der Versuch, aufzustehen schien ihm gar nicht in den Sinn zu kommen. Die Wahrscheinlichkeit war gering, dass er dazu überhaupt in der Lage war.
Robert empfand rein gar nichts für diesen Mann. Es war kein Mitleid für seinen verletzten Gefangenen vorhanden. Und die Wut des ersten Aufeinanderpralls war verflogen. Er überlegte, ob er die Sache nicht besser jetzt sofort beenden sollte.
Der Verletzte hob Kopf und Oberkörper ein wenig und verzog dabei kurz das Gesicht. Aus großen Augen blickte er zu Robert.
„Es wird sicher einen Weg geben...“, brachte er mühsam hervor, stockte dann mitten im Satz.
Robert schaute ihn an.
„Ich könnte dir... sein Versteck zeigen", versuchte der Mann es weiter.
Robert sah, dass dieser Mann alles daran setzen würde, mit dem Leben davonzukommen. Es gab in dieser Situation keine Spur von treuer Hingabe an den schwarzen Priester. Elmors ehemaliger Helfer würde versuchen, seinem überlegenen Gegenüber in irgendeiner Weise zu gefallen.
Doch der vorgeschlagene Handel war in Wahrheit keiner. Elmor saß nicht herum und wartete auf die Rückkehr des Boten. Der Schwarze Priester suchte sich Leute wie diesen Mann, denen das Leben zu langweilig geworden war und die ihre Machtphantasien ausleben wollten. Er nutzte seine Helfer aus und warf sie weg. Diesen Boten hatte er bewusst in den Tod geschickt und anschließend sofort sein Versteck gewechselt. Den Verrat durch einen in Bedrängnis geratenen Untergebenen kalkulierte er ein.
Als der verletzte Mann daraufhin keine Antwort bekam, sackte sein Oberkörper wieder kraftlos zurück auf den Boden. Doch er machte sofort einen weiteren Vorschlag, sein Leben zu retten. "Wenn du mich heilst", schnaufte er angestrengt, "und mich verschonst, dann werde ich dir dienen, statt ihm."
"Wie sollte ich dich heilen?" fragte Robert zurück.
„So, wie bei dieser reichen Dame. Mein Meister hat... ich habe davon gehört."
"Ich muss dich enttäuschen", sagte Robert. "Ich kann das nicht."
Der Verletzte blickte irritiert.
Doch Robert hatte ihm die Wahrheit gesagt, auch, wenn er keinen Anlass sah, seinem Gesprächspartner eine weitere Erklärung hierzu abzugeben. Er hatte einen über Clara Neuberg verhängten Fluch gebrochen. Das war etwas anderes, als die Heilung eines kranken oder verletzten Menschen. Und wenn er gebrochene Knochen dazu bringen könnte, wieder zusammenzuwachsen: Was sollte er mit diesem Mann anfangen, einem verräterischen Klotz am Bein?
Deutlich sichtbar lief ein Schweißtropfen vom Haaransatz über die Stirn des Boten.
„Aber ich weiß doch, dass du es kannst“, keuchte er. "Hör zu“, setzte er hinzu, mit unüberhörbarem Flehen in der Stimme. „Ich will nicht sterben. Ich habe sicher einen großen Fehler gemacht. Aber ich habe doch nicht verdient... ich habe nicht das hier verdient! Ich will auch zurückgehen zu meiner Familie, wenn du das für gut hältst. Aber sterben, sterben will ich nicht.“
Robert antwortete ihm mit einem stummen Kopfschütteln.
"Kennst du denn wirklich kein Mitleid?" fuhr der Mann flehentlich fort. "Schau mich doch an: Bin ich eine Gefahr für dich? Bitte bring mich in ein Hospital! Oder zu einem Arzt!"
Robert stand auf und wandte sich ab. Er spürte deutlich, wie die Blicke des am Boden Liegenden ihm folgten. Die Leute des schwarzen Priesters kamen niemals mit dem Leben davon. Wer sich für diesen Herrn und Meister entschied, wählte ohne es zu wissen den Tod. Nach getaner Arbeit zurückzukehren in das alte Leben, zu Frau und Kind, war unmöglich, denn Elmor wusste es gründlich zu verhindern, dass in aller Welt Zeugen seines Tuns herumliefen. Über das weitere Schicksal dieses Mannes gab es somit keine Ungewissheit.
Robert hatte es sich nie zur Aufgabe gemacht, die Hand über Elmors Helfer zu halten. Und er sah auch keinen Anlass, jetzt damit zu beginnen. In diesem Moment verspürte er nicht einmal die Neigung, sich noch länger mit diesem Mann zu befassen. Er ging zu den beiden Pferden, die noch immer relativ dicht beieinanderstanden, und befestigte die Zügel an einem Baum. Dann bewegte er sich tiefer in den Wald hinein, den Verletzten und die Tiere hinter sich lassend.
Seine alte Heimat war von ausgedehnten Waldflächen umgeben, sein halbes Leben hatte sich unter dem Dach grüner Blätter abgespielt. Der schroffe, teilweise finstere Nadelwald, in dem er sich nun befand, barg für ihn nur eine vage Erinnerung an diese vergangenen Zeiten. Doch war auch dieser Ort von tiefer Ruhe erfüllt und zugleich durch und durch lebendig. Er hatte den Wald immer als einen atmenden Organismus erlebt, der schützender Freund und bedrohlicher Feind zugleich sein konnte. Er hatte im Wald, bei den magischen Zeremonien des schwarzen Priesters, Menschenblut vergossen. Und sein eigenes Blut war in den Waldboden gesickert, als er selbst zum Opfer erklärt wurde.
Nun setzte er einfach einen Fuß vor den anderen, ohne darüber nachzudenken, in welche Richtung er ging und was ihn eigentlich umtrieb. Er dachte nicht an Tadeya, die sicher längst in ihrem Gefängnis erwacht war. Auch Elmor verschwand in diesen Minuten aus seinen Gedanken. Es leerte Kopf und Herz, um nicht zu ersticken.
Viele Wochen hatte er in den letzten anderthalb Jahren ähnlich verbracht, in einer Art Sich-Treiben-Lassen, ohne Ziel. Sein Einsatz bei den Neubergs hatte weder etwas mit Geld noch mit Mitgefühl zu tun. Geld war nie ein Problem für ihn gewesen. Er hatte den Großteil seines früheren Lebens mit dem Abschließen ertragreicher Geschäfte jeglicher Art zugebracht. Sein altes Vermögen hatte er ohne Bedauern in den Händen einer jungen Frau zurückgelassen, die nicht die geringste Ahnung von Geldgeschäften besaß.
Vielleicht hatte ihn am ehesten die Langeweile dazu getrieben, die sterbende Clara Neuberg aufzusuchen. Er hatte ein vages Interesse daran gespürt, wie diese Menschen sich verhalten würden, forderte man ihre finanzielle Grundlage. Das Ergebnis war wie erwartet wenig spektakulär. Er hatte in Heinrich Neubergs Gedanken lesen können, wie in einem offenen Buch: Beim ersten Anlauf hatte der Mann versucht, sich um die Bezahlung des geforderten Preises herumzumogeln. Und genau das würde er auch ein zweites Mal tun. Doch diese Geschichte war für Robert nun abgeschlossen.
Seine Schritte lenkten ihn wie automatisch durch den schweigenden Wald. Dass dem verletzten Mann, den er zurückgelassen hatte, die ungewisse Zeit seines Fortbleibens wie eine Ewigkeit erscheinen musste, kam ihm nicht in den Sinn. Erst nach etwa einer Stunde kehrte Robert zurück an den Teich und fand den Boten des Priesters auf dem Bauch liegend zwischen den Pferden vor, die vom Baum losgerissenen Zügel des Fuchses mit der Rechten umklammernd. Der Mann hatte augenscheinlich versucht, auf das Pferd zu klettern, war aber gescheitert. Als der Verletzte die nahenden Schritte hörte, hob er mühsam den Kopf, um seine Augen auf den Ankommenden zu richten. Doch aus diesem Blickwinkel war es kaum möglich, irgendetwas zu sehen, höchstens die Stiefel eines direkt neben ihm Stehenden. Zitternd ließ er den Kopf nur Sekunden später wieder sinken.
Robert bückte sich, um dem Mann die Zügel aus der Hand zu nehmen. Dieser wehrte sich nicht dagegen, denn die Gelegenheit zur Flucht, falls es jemals eine für ihn gegeben hatte, war nun endgültig verstrichen. Dann machte sich Robert daran, den Schwarzen wieder zu satteln und das weitere Gepäck zu verstauen. Er nahm wahr, wie der Mann am Boden sich währenddessen langsam und unter Mühen auf die Seite wälzte und ihn schließlich anschaute. Dann sprach der verletzte Bote mit schwacher Stimme in das Schweigen hinein. "Du willst mich wirklich hier liegen lassen."
Robert, der seine Arbeit gerade beendet hatte, drehte sich um und blickte in ein extrem blasses Gesicht, das von Furcht gezeichnet war. Der Mann fuhr angstvoll fort: "Weißt du, was das bedeutet? Ich werde elendig sterben. Das kann Tage dauern. Hier wird mich niemand finden. Hier komme ich niemals weg."
"Viel Zeit zum Nachdenken", erwiderte Robert kurz.
"Bitte", flehte der Mann am Boden, "sage irgendjemandem, wo ich bin, damit ich hier nicht jämmerlich umkomme."
"Du wirst warten müssen und sehen, was geschieht", wies Robert ihn an, ergriff die Zügel des zweiten Pferdes und saß anschließend auf dem Schwarzen auf. Den Sattel des Fuchses ließ er auf dem Boden liegen. Er verließ mit den beiden Tieren seinen kurzzeitigen Lagerplatz.
------- JESCO FEY ------
Nachdem er die Türglocke mehrmals geläutet hatte, ohne dass sich im Inneren irgendetwas regte, lenkte er seine Schritte am Eingangsportal vorbei, um das Haus herum. Eine böse Vorahnung hatte ihn zu Elisas Haus getrieben, obwohl Tadeya ihn mit ihrer Großmutter bewusst noch nicht bekannt gemacht hatte. Frau Sleyvorn nannte ein relativ großes Anwesen ihr Eigen. Das Haus war umgeben von einer baumbestandenen Grünfläche, die offenbar selten von menschlicher Hand in Stand gesetzt wurde. Das Gras stand mehr als knöchelhoch und das verstreut liegende Herbstlaub knisterte unter seinen Schritten. Die Reste des Fallobstes vom letzten Sommer säumten seinen Weg. Das Gebäude selbst befand sich in gutem Zustand, doch war es höchstens zwei Jahrzehnte alt. Es war, bis auf das mächtige Eichenholztor an der Front, architektonisch unauffällig und schlicht geweißelt.
Zwischen den Bäumen gab es einen freien Blick auf die eingezäunte, großräumige Koppel, die seitlich an den Garten grenzte. Die beiden grau-gelben Kaltblüter standen dort mit gesenkten Köpfen, grasend. Doch das an sich friedliche Bild fand ein jähes Ende, als Jesco die Rückseite des Hauses erreichte: Einige Meter vom Gebäude entfernt war die Rasenfläche in einem Durchmesser von mehr als vier Metern wie von einer Explosion zerrissen und die Erde einige Zentimeter tief aufgewühlt. Eine große Zahl Zweige und Äste von den umstehenden Bäumen lagen am Boden.
Jesco wandte den Blick zur Hauswand. Diese schien ihm zuerst unversehrt. Aber bei genauerem Hinsehen erkannte er, dass sämtliche Fensterscheiben in beiden Stockwerken zerstört waren. Wenige Reste scharfkantiger Glasstücke hingen noch in den teilweise ebenfalls zersplitterten, hölzernen Fensterrahmen. Auf dem Boden um sich herum konnte Jesco keine Scherbe entdecken.
Er verlangsamte seine Schritte. Er spürte deutlich, wie sich sein Herzschlag erhöhte. Die Zerstörungskraft, die hier ihre Spuren hinterlassen hatte, war vergleichbar mit der einer guten Ladung Dynamit, die mitten im Garten gezündet worden war und deren Druckwelle die Fensterscheiben nach innen gedrückt hatte. Jedoch, obwohl die Spuren am Boden sehr frisch erschienen, fehlte der typische verbrannte Geruch in der Luft.
Durch eines der größten Fenster im Erdgeschoss, das dem Explosionsherd genau gegenüberlag, blickte Jesco direkt in das Haus hinein. Der Boden des Raumes war übersät von Scherben. Die schweren Vorhänge, die ehemals von innen das Fenster verhangen hatten, lagen inmitten der verstreuten Glasstücke. Und in dem Chaos stand Elisa Sleyvorn, in aufrechter Haltung. Das glatte, schlohweiße Haar trug sie wie zumeist offen. Und in eben diesem Augenblick wandte sie ihren Kopf und schaute Jesco aus dunklen Augen unvermittelt ins Gesicht. Ein wenig fühlte sich Jesco wie beim Schnüffeln ertappt, doch das Unbehagen lastete nicht allzu schwer. Vielmehr wollte er in Erfahrung bringen, was genau hier geschehen war. Und darum hielt er sich nicht damit auf, lange zu erklären, was ihn dazu veranlasste, auf Elisas Privatgrundstück herumzuspazieren und durch die glaslosen Fenster zu spähen. Er fragte geradeheraus: "Frau Sleyvorn, was ist passiert?"
Sie drehte sich vollständig zu ihm um und ihr Gesichtsausdruck bedeutete ihm, dass er sich nicht willkommen zu fühlen hatte.
"Jesco Fey", sprach sie laut und deutlich seinen Namen. Jesco hätte zuvor daran gezweifelt, dass sie überhaupt wusste, wer er war. Sie hatten sich bisher niemals ein Wort miteinander gewechselt. "Ich nehme an, Sie führt nicht der Zufall her."
Ihr Blick und ihre Art, mit ihm zu sprechen, ließen Jesco in diesem Moment ahnen, dass sie über die Beziehung zwischen Tadeya und ihm besser informiert war, als er bisher angenommen hatte. Dass er sich auf der Suche nach Elisas Enkelin befand, schien ihr ein offenes Geheimnis. Langatmige Erklärungen oder gar Rechtsfertigungsversuche waren hier fehl am Platz.
Er entschloss sich, geradeheraus zu fragen: "Wo ist Tadeya? Geht es ihr gut?"
"Ich habe kein Verlangen, mit Ihnen darüber zu sprechen", war Elisas abweisende Antwort. "Und wenn ich Besuch empfangen wollte, dann hätte ich Ihnen die Tür geöffnet, als sie läuteten."
"Ich möchte Tadeya sehen", beharrte Jesco auf sein Anliegen. "Ich will mit ihr sprechen und sehen, ob sie unversehrt ist."
"Und ich möchte,", erwiderte Elisa kalt, "dass Sie umgehend mein Grundstück verlassen."
So, wie Frau Sleyvorn dort stand, mit durchgestrecktem Rücken, erhobenem Haupt und einem Blick, der wahrscheinlich glühende Kohlen gefrieren lassen konnte, kam sie Jesco vor wie der Inbegriff einer absolutistischen Herrscherin. Man wagte kaum, ihr zu widersprechen. Die kleine Geste mit der Hand bedeutete ihm, wo der Weg zurück zum Tor war.
Doch wenn es eine Untugend gab, die Jescos Leben nicht regierte, dann war das die Menschenfurcht. Man konnte ihn nur schwerlich einschüchtern.
"Tadeya war mit mir verabredet", stellte er frei heraus fest. "Sie ist nicht erschienen. Ich denke, ich habe ein Recht, mich um sie zu sorgen. Besonders, wenn ich dies hier sehe." Er deutete auf das Chaos um sie beide herum. "Verstehen Sie bitte,", fügte er hinzu mit einem langen Blick in ihre Augen, "dass ich mich nicht so einfach umdrehen und gehen kann."
"Sie werden aber genau das tun müssen", erwiderte Elisa fest. "Denn hiermit hat Ihre Verbindung zu dieser Familie ein Ende."
"Ich weiß nicht, wovon Sie reden", sagte Jesco. "Erklären Sie mir das bitte."
Es war kaum zu übersehen, dass sein standhaftes Verharren in ihrem Inneren Wut erzeugte. Ihre Mimik veränderte sich nur wenig, aber unverkennbar. Sie machte einen großen Schritt nach vorn, näher an das klaffende Fenster heran. Unter ihren Schuhen knirschten Scherben.
"Muss ich es wirklich noch einmal wiederholen?" fragte sie, sich zu ihm vorbeugend. Auch ihre Gesichtszüge hatten etwas Königliches, stellte Jesco fest. "Sie, Herr Fey, sind hier unerwünscht."
"Frau Sleyvorn,", war Jescos unverdrossene Erwiderung, "ich habe jemanden getroffen, der sich als guten Freund Ihrer Familie bezeichnet, doch Tadeya kannte ihn nicht. Sein Name ist Robert Adlam...".
Elisas Augenbrauen fuhren hoch. Sie hob den Zeigefinger und für einige Sekunden sah Jesco an ihrer Hand einen erstaunlich großen Rubin funkeln.
"Die Wahl Ihrer Bekanntschaften ist mehr als bedenklich, Herr Fey", stellte sie fest. "Wenn Sie so weitermachen, dann könnte am Ende ein früher Tod stehen."
"Wer ist dieser Mann? Hat er irgendetwas damit zu tun, was hier geschehen ist?" fragte Jesco weiter, ohne sich von ihren drastischen Worten beirren zu lassen. Er wusste bereits, auch ohne Elisas Mahnung, dass Herr Adlam nicht der nette Nachbar von nebenan war. Aber schließlich hatte Jesco sich nicht um diese neue Bekanntschaft gerissen. Es musste ein Sinn hinter ihren beiden scheinbar zufälligen Begegnungen stecken.
"Hatten wir dieses Gespräch nicht vorhin beendet?" entgegnete ihm Elisa, während sie sich wieder zu voller Größe aufrichtete, um von ihrem erhöhten Standort einen finsteren Blick auf ihn herab zu werfen.
"Nein", sagte Jesco. "Wir haben nicht aufgehört, zu reden."
"Dann hören wir jetzt damit auf", stellte Elisa in entschiedenem Ton fest und machte auf dem Absatz kehrt. Ohne sich noch einmal zu ihm umzudrehen, gebot sie ihm mit lauter Stimme: "Verlassen Sie auf der Stelle mein Grundstück, Herr Fey. Sollten Sie es nicht tun, dann wäre Polizeigewalt noch das Harmloseste, was ich Ihnen antun könnte."
Jesco zögerte einige Sekunden, während er beobachtete, wie Elisa Sleyvorn durch den zerstörten Raum zur Tür schritt. Dann wandte auch er sich ab.
"Mit dieser alten Dame ist nicht gut Kirschen essen", murmelte er vor sich hin, während er den Rückweg zur Straße einschlug. Elisa war augenscheinlich fest entschlossen, ihm nichts, aber auch gar nichts zu verraten. Und ziemlich sicher handelte es sich bei dem verwüsteten Zimmer, in dem Elisa sich aufgehalten hatte, um Tadeyas Schlafkammer. Das Bett im Hintergrund an der Wand, mit einem Himmel aus üppigem, weißen Stoff versehen, war unverkennbar die Schlafstätte einer jungen Frau.
Ein Satz, den Elisa zu ihm gesprochen hatte, machte Jesco zu schaffen: nämlich, dass hiermit seine Verbindung zu der Familie Sleyvorn ein Ende hätte. Was war mit Tadeya geschehen, dass Elisa solche Worte zu ihm sprach? Der Gedanke drängte sich auf, dass Tadeya schwer verletzt oder gar getötet worden sein könnte. Und dass Elisa gut daran tat, darüber zu schweigen.
Einige Meter vom Haus der Sleyvorns blieb er stehen. Die Hände in den Taschen krampfhaft geballt, schloss er fest die Augen. Er musste sich selbst zur Ruhe rufen, denn ein Sturm der Gefühle braute sich in seinem Inneren zusammen. Er fühlte sich hilflos vor ein Rätsel gestellt, das einen Großteil seines Lebensglücks infrage stellte. Niemals zuvor hatte er ein Mädchen die Weise geliebt, wie er Tadeya liebte. Er betrachtete sie als ein Geschenk Gottes an ihn und keinesfalls wäre er auf die Idee gekommen, dass der Herr es zulassen würde, dass er sie so schnell wieder verlor.
Sie kannte den lebendigen Gott nicht und nahm ihn nicht einmal ansatzweise ernst. Doch, na und? Jesco hatte ihn selbst bis vor kurzem ebenfalls nicht gekannt. Der Herr besaß wahrlich Mittel und Wege, sich seinen Geschöpfen höchstpersönlich vorzustellen. Und nach solch einer Begegnung gab es keinen Weg mehr an dem Schöpfer vorbei, selbst, wenn man es sich wünschte.
Er hatte darauf vertraut, dass es in Deyas Leben irgendwann einmal einen guten Zeitpunkt für solch eine Begegnung geben würde. Er hatte sie voll Zuversicht in Gottes Hände gelegt und war froh über jedes seiner Wunder, das sie miterleben durfte.
"Wie kann ich sie finden?" fragte er nun seinen Herrn. "Vielleicht bausche ich die ganze Sache auf und sie ist völlig unversehrt, ganz in meiner Nähe. Ich muss darüber Gewissheit haben. Halte du bitte deine Hand über sie. Und, Vater, bitte, führe mich zu ihr."
Die Antwort ließ nicht auf sich warten, obwohl sie ihm rätselhaft erschien. Einen etwa halbstündigen Fußmarsch von hier entfernt, am Rande des Ortes, gab es einen kleinen Gasthof mit vier Gästezimmern und einem Schankraum. Man konnte dort günstig eine deftige Mahlzeit bekommen. Doch sein Geld hatte, seit er sich an diesem Ort aufhielt, nie dazu gereicht, überhaupt in irgendeine Gaststätte einzukehren. Sein Verlangen danach war auch nicht sehr groß, denn verrauchte Kneipen hatte er in seinem Leben zur Genüge von innen gesehen. Dem Wirt des Gasthofes war er einmal auf dem Fischmarkt am Hafen begegnet und mit ihm ins Gespräch gekommen. Und genau diesen Mann hatte er nun vor Augen, wie er an einem Zapfhahn stand und schäumendes Bier in hohe Krüge füllte.
Jesco hatte noch einige Scheine von dem überraschenden Geldsegen in der Tasche. Kurzerhand entschloss er, den Gasthof aufzusuchen und sich dort ein kühles Glas zu genehmigen. Erstaunlicherweise empfand er über diesen Gedanken ein wenig Freude, obwohl seine Sorgen nicht fortgeblasen waren. Doch wenn es Antwort gab, dann gab es auch Hoffnung, dessen war er gewiss.
Hinter dem Tresen stand der Gastwirt, die eine Hand am Zapfhahn, die andere im flinken Wechsel an den zu füllenden Krügen. Jesco hatte sich einen Platz auf einen der hohen Hocker an der Theke ausgesucht und war über einen seichten Plausch mit dem Kneipier nicht hinausgekommen.
Der Schankraum erwies sich als nicht halb so verraucht, wie Jesco es sich ausgemalt hatte. Mit den dunklen Stadtkneipen, die oft Treffpunkt gewesen waren für ihn und einen Haufen so genannter Freunde, hatte dieser Ort kaum etwas zu tun. Es saßen sogar zwei junge Damen in Begleitung einer älteren Gouvernante an einem Tisch am Fenster. Dabei handelte es sich zweifellos nicht um die Art von Mädchen, die des Öfteren auf Jescos Schoß Platz genommen und ihm mit einem Augenaufschlag seine drei letzten Geldstücke aus der Tasche gezaubert hatten.
Das Bier schmeckte ihm sehr gut, und ehe er es sich versah, war er bereits beim zweiten Krug angelangt. Mit jedem weiteren Schluck jedoch und jeder Minute, die verstrich, beschlich ihn das Gefühl, eine düstere Wolke senke sich mehr und mehr auf ihn herab. Er rechnete kaum damit, dass die Tür aufging und Tadeya wie aus dem Nichts hineinspazierte. Trotzdem ließ er den Eingang zur Schänke die erste Zeit über nicht aus den Augen.
Als er den dritten Krug bestellte, machten sich nagende Zweifel in ihm breit, ob er sich wirklich am richtigen Ort befand. Vielleicht, so mutmaßte er, war das Bild des zapfenden Wirtes nur aus dem unbewussten Wunsch heraus entstanden, seine Sorgen in Alkohol zu ertränken. Und damit wäre er keinen Schritt weiter, als zuvor. Dann wäre es wirklich sehr viel sinnvoller gewesen, heimlich in Elisas Haus einzudringen und die Räume nach Hinweisen zu durchstöbern. Oder die kleine Steinhütte am Strand aufzusuchen und dort nachzusehen, ob der Bewohner irgendetwas zurückgelassen hatte, was Jesco weiterhelfen könnte. Vielleicht verstrich jetzt gerade wertvolle Zeit, die, auf vernünftige Weise eingesetzt, Tadeyas Leben retten könnte. Und er saß hier herum und trank ein Bier nach dem Nächsten.
"Das hatten wir schon", murmelte er vor sich hin. "Menschliche Vernunft versus Heiliger Geist." Er musste ein wenig lächeln.
"Wusstest du schon,", sagte der Wirt, "dass die Neuberg-Werft nicht mehr die Neuberg-Werft ist? Das war eine ganz plötzliche Sache. Heute Morgen verkauft an den Dörenhaus. Und der Kerl hat sich jahrlang krumm und schief gebuckelt, um die Neuberg-Werft pleite zu machen oder sie in die Hand zu bekommen. War eine harte Konkurrenz für den reichen Sack. Und plötzlich gehört sie ihm. Jetzt hoffen natürlich alle, dass keine Leute gefeuert werden unter dem neuen Chef."
"Ja", antwortete Jesco, ohne richtig hingehört zu haben. "Hoffe ich auch."
"Die Spiele der Großen und Reichen versteht wirklich kein Schwein", fuhr der Wirt fort. "War doch die Werft immer Heinrich Neubergs ganzer Stolz."
"Vielleicht,", stellte Jesco die halbherzige Vermutung an, "brauchte Herr Neuberg sehr schnell sehr viel Geld. Auch die Großen und Reichen sitzen manchmal einfach in der Patsche."
"Das ist die einzige Form von Gerechtigkeit in dieser Welt", brummte der Wirt. "Patschen und Klemmen sind für alle da, ob sie nun große Tiere sind, oder kleine."
"Sind wir denn selbst so gerecht, dass wir Gerechtigkeit fordern können?" fragte Jesco noch immer ziemlich geistesabwesend zurück.
"Mmh", machte der Wirt und packte die fertig Gezapften auf ein Tablett. "Muss ich drüber nachdenken." Damit ging er und bediente seine Gäste. Jesco ertappte sich selbst dabei, wie er in seinen Krug zu starren begann. Erste Anzeichen von Trunkenheit machten sich bemerkbar.
"Tut mir echt leid", murmelte er so leise in sein Bier, dass es niemand um ihn herum hören konnte. "Wahrscheinlich wolltest du mir nicht sagen: Gönn dir mal vier bis fünf Bier, dann sieht die Welt schon anders aus. Vielleicht vermassele ich das, was immer ich hier soll, völlig. Gibt es hier irgendjemanden, mit dem ich sprechen müsste?"
Nachdem er diese Frage leise ausgesprochen hatte, hob Jesco wieder seinen Blick und sah sich um. Die beiden jungen Damen erhoben sich gerade von ihren Plätzen, während die Gouvernante zahlte. Drei ältere Herren saßen an einem Tisch im hintersten Winkel und genossen eine deftige Mahlzeit. Ein eher derb wirkendes Ehepaar saß sich schweigend gegenüber, der Mann einen Krug Bier vor sich, die Dame ein dampfendes Kännchen heißer Schokolade. Zwei jüngere Männer nahmen einen weiteren Tisch in Beschlag, spielten Karten und erzählten sich Witze. Keine von diesen Personen stach ihm besonders heraus und alle waren für ihn völlige Fremde. Er verspürte nicht den geringsten Drang, sich an irgendeinen ihrer Tische zu setzen, ein Gespräch zu beginnen und Bekanntschaft zu schließen. Doch was um alles in der Welt hatte er sonst hier zu tun?
Die Eingangstür öffnete sich. Mechanisch wandte Jesco den Kopf und erblickte einen jungen Mann um die zwanzig Jahre alt, mit langem, roten Lockenschopf. Das Gesicht, das noch recht jungenhaft wirkte, war von der kalten Winterluft leicht gerötet. Der Mann schaute sich nur kurz in der Gaststätte um, während er schon dabei war, seinen sichtbar schon etwas älteren, schweren Wollmantel abzustreifen. Nachdem er den Mantel mit einer nachlässigen Bewegung über einen der freien Garderobenhaken geworfen hatte, ging er geradewegs zur Theke, nickte Jesco wie einem entfernten Bekannten mit einem Lächeln höflich zu und setzte sich neben ihn auf einen der Hocker. Der Wirt kam mit seinem leeren Tablett herbeigeschlurft. „Guten Abend, junger Mann. Was kann ich Ihnen heute anbieten?"
"Guten Abend, Herr Kalbers", grüßte der neu angekommene Gast zurück. Man hörte an dem leichten Akzent, dass seine Muttersprache eine andere war. "Bringen Sie mir einfach das Tagesgericht. Ich weiß, dass das am schnellsten fertig ist. Und bis dahin wäre ich schon sehr froh über einen großen Krug Bier."
"Ich höre, Sie haben wieder viel Hunger und Durst mitgebracht, junger Mann", stellte der Wirt zufrieden fest. Jesco war sich nicht sicher, ob sein Gesichtsausdruck einfach nur die Freude über das Erscheinen eines guten Stammkunden ausdrückte, oder ob er diesen ihm bekannten Gast besonders mochte. Die zweite Möglichkeit kam durchaus infrage, denn das Erscheinungsbild von Jescos neuem Sitznachbarn war sympathisch und seine Art auf natürliche Weise freundlich. Er könnte einen durchaus angenehmen Gesprächspartner abgeben.
Der Wirt verschwand hinter einer Tür in der Küche. Bald darauf hörte man ihn laut mit einer Frau reden. Jesco wandte sich zu dem rothaarigen jungen Mann. "Sie sind scheinbar öfter hier", merkte er an.
"Ja", war die Antwort. "Ich habe festgestellt, dass man hier gut satt werden kann."
"Das habe ich auch schon aus anderen Quellen gehört", bestätigte Jesco.
"Mein Name ist Robin", stellte sich sein Gegenüber spontan vor und reichte ihm die Hand. Den Händedruck empfand Jesco als angenehm. Robin sah ihm dabei geradewegs in die Augen, mit einem offenen Lächeln auf den Lippen.
"Jesco", stellte Jesco sich vor.
"Ja, ich weiß", erwiderte Robin überraschenderweise. "Jesco Fey, der Maler. Man spricht von Ihnen, hier im Ort."
"Oh", meinte Jesco mit einem Lächeln. "Das hatte ich befürchtet."
"Nein, nicht auf diese Weise", war die Antwort. "Wahrscheinlich wissen Sie gar nicht, wie viele Einwohner stolz darauf sind, einen Künstler am Ort zu haben."
"Wenn sich dieser Stolz auf meine Aufträge niederschlagen würde, dann wüsste ich es", entgegnete Jesco. "Wahrscheinlich sind die Einwohner auf dieselbe Weise stolz auf mich, wie auf ein langsam zerfallendes Denkmal." Er sprach diese Worte ohne eine Spur von Groll. Vielmehr amüsierte ihn sein Status als bestaunter Künstler ohne Einkommen sogar ein wenig.
Robin gab ein kurzes, warmes Lachen von sich. "Wenn Sie viele Erben zeugen,", sagte er, "dann werden die vielleicht später reich sein."
Jesco lachte mit ihm. Seine Stimmung stieg in dieser Gesellschaft spürbar. Die dunkle Sorgenwolke hob sich von seinen Schultern.
"Was treibt Sie hierher, Robin?" fragte er seinen neuen Bekannten. "Ich hoffe sehr, Sie sind ein reicher Kunstsammler mit exquisitem Geschmack."
Robin schüttelte seine dichten Locken. "Nein, nein. Ich bin einfach auf der Durchreise und halte mich hier ein paar Tage auf."
Das war keine konkrete Antwort. Jesco wagte eine etwas genauere Frage. "Sind es Geschäfte, die Sie locken? Oder die frische Seeluft? Oder vielleicht ein Mädchen?"
"Ich schlage vor, dass wir uns duzen", meinte Robin daraufhin. "Und über meine Affären spreche ich nicht." Er lächelte breit. Jesco fiel nebenbei auf, dass seinem Gesprächspartner im seitlichen Bereich zwei oder drei Zähne fehlten. Doch dies fiel kaum ins Gewicht.
"Einverstanden", sagte Jesco. "Ich würde gerne mit dir anstoßen, aber leider hast du noch kein Bier - und mein Krug ist leer."
Gerade in diesem Moment kam der Wirt wieder aus der Küche heraus und trat, als hätte er es gehört, an den Zapfhahn, um Robins Bier einzuschenken. Jesco bestellte sich eilends ein Neues. Mit nur leichtem Unbehagen erinnerte er sich daran, dass dies bereits sein Viertes war.
"Weißt du,", begann Jesco, als er nach einiger Zeit seinen frischen Krug in der Hand hielt und der Wirt wieder in der Küche verschwunden war, "ich bin nicht durch reinen Zufall hier. Ich bin auf der Suche nach einer Freundin von mir. Ich habe Gott gebeten, mir zu helfen und er hat mich hierher geführt."
Etwas unbehaglich war ihm bei diesen Worten schon zumute, obwohl er mit seinem Bekenntnis normalerweise nicht zurückhaltend war. Sein Sitznachbar blickte ihn stumm aber gleichbleibend freundlich an, als warte er auf weitere Erklärungen. "Mir ist klar, was du denkst", fügte Jesco nach einer kurzen Pause an. "Die meisten Männer, deren Mädchen auf die eine oder andere Weise verschwinden, werden von Gott auf rätselhafte Art in die nächsten Kneipe geführt, wie?"
Robins Lächeln breitete sich bei diesen Worten abermals über sein Gesicht aus. "Ich fühle mich ertappt", gab er zu.
"Und leider erfülle ich das Klischee nur allzu gut, indem ich hier sitze und trinke", meinte Jesco weiter. "Doch ich bin nicht hergekommen, um zu trinken. Als ich Gott um Hilfe bat, da zeigte er mir vor meinem inneren Auge den Wirt dieser Gaststätte. Ich hatte das Gefühl, hier einen Hinweis zu erhalten, wie und wo ich Tadeya finden kann. Und ob sie gesund ist."
Robins Gesichtsausdruck wurde bei Jescos letzten Worten deutlich ernster.
"Passiert dir so etwas öfter?" fragte er ohne Spott in der Stimme.
"Ich habe Gott mein Leben gegeben", erwiderte Jesco. "Seitdem bekomme ich Antwort, wenn ich zu ihm spreche. Er ist für mich so greifbar, wie mein Krug Bier."
Er legte, um seine Worte zu veranschaulichen, beide Hände um den Krug vor sich und presste sie zusammen. "Nicht zu leugnen,", stellte er fest, "dass dieser Krug real ist."
"Mein Stiefvater hat auch geglaubt", erwiderte Robin. "Er hat ständig gebetet. Aber er hat mir nie davon erzählt, dass er auch Antwort bekam."
Etwas im Gesichtsausdruck seines Gegenübers sagte Jesco, dass die Erinnerung an den Stiefvater ihm nicht behagte. Eine leichte Verhärtung der Mimik fiel ihm auf. Robins zuvor so offener Blick kehrte sich für eine Weile wie nach innen.
Nach einer kurzen Weile des Schweigens meinte Jesco: "Wir haben in selbst gewählter Verbannung einfach das Hören verlernt."
Robin lehnte sich auf seinen Stuhl leicht zurück.
"Sei mir bitte nicht böse", sagte er. "Erzähle mir lieber von deinem Mädchen."
Jesco atmete einmal tief durch.
"Verzeihung", meinte Robin sofort. "Ich wollte dich nicht verletzen."
Mit ein wenig Erstaunen nahm Jesco wahr, wie sein Gegenüber in feiner Geste beinah ehrerbietig den Kopf senkte. Er war hier tatsächlich auf einen außergewöhnlich höflichen Gesprächspartner getroffen.
"Es ist in Ordnung", entgegnete er. "Ich erzähle dir von Deya." Er musste einen Moment innehalten, denn mit einem Schlag drängte sich wieder der Gedanke auf dass, während er gemütlich hier saß und redete, Tadeya sich vielleicht in großer Gefahr befand. "Sie ist heute nicht an unserem Treffpunkt erschienen. Wenn du mich kennst, dann hast du sie vielleicht auch schon einmal gesehen: Tadeya Sleyvorn, die Enkelin von der alten Dame, die man hier im Ort die Zigeunerin nennt."
"Ich habe von der alten Dame und ihrer Enkelin gehört", sagte Robin.
"Sie ist ein hübsches Mädchen, zierlich, dunkelhaarig, mit dunklen Augen", erklärte Jesco weiter und sah dabei deutlich ihr Bild vor sich, wie sie, nachdem sie durch Sturm und Wetter über den Strand geritten war, mit diesem ihm so vertrauten, spitzbübischen Lächeln vor seiner Tür stand. "Oft ist sie auf einem der Kaltblüter ihrer Großmutter unterwegs, in einem dicken, braunen Wollmantel. Man fragt sich, wie sie diese schweren Tiere überhaupt zu lenken in der Lage ist. Doch sie kann sich durchsetzen. Das kann sie wirklich..." Jesco brach ab, seine Gedanken schweiften zu diversen gemeinsamen Erlebnissen, wo er Tadeyas willensstarkes Wesen zu spüren bekommen hatte.
Robins Blick war aufmerksam auf ihn gerichtet. Er bemerkte nicht, wie der Wirt einen Teller mit dampfendem Fleisch und einem Berg Kartoffeln vor ihn auf den Tresen stellte.
Jesco machte eine kurze Geste in Richtung des Tellers. "Dein Abendessen ist da."
"Oh, ja, vielen Dank", sagte sein Gesprächspartner und wandte sich kurz ab, um dem Wirt freundlich zuzunicken. Wieder an Jesco gewandt bat er: "Lass dich bitte nicht stören, wenn ich jetzt mit dem Essen anfange. Ich höre weiter zu. Nur habe ich leider einen großen Hunger."
"Klar", sagte Jesco. Ihn hatte noch nie jemand um Entschuldigung dafür gebeten, während eines Gesprächs eine Mahlzeit einzunehmen. "Ich hatte mich mit ihr verabredet, vor etwa zwei Stunden", erzählte Jesco weiter. "Der Treffpunkt lag ganz in der Nähe ihres Hauses, sie hatte keinen weiten Weg. Doch sie ist nicht gekommen." Schon wieder musste Jesco eine Pause machen. Einen Moment lang fehlten ihm die Worte, weiter zu reden. Er wollte Robin gerne begreiflich machen, dass es sich bei seiner Beziehung zu Tadeya nicht um irgendeine Affäre handelte, sondern dass sie so wertvoll für ihn war, wie nichts anderes in dieser Welt. Und dass er sich nichts Schlimmeres vorstellen konnte, als sie zu verlieren. Doch er konnte diese Gefühle nicht ausdrücken. "Weißt du, ich liebe Tadeya", sprach er eine in seinen Ohren jämmerlich abgedroschen Phrase aus. "Sehr", fügte er augenblicklich hinzu, denn es störte ihn, wie schwach diese Worte klangen.
Robin legte sein Besteck kurz beiseite. Die Botschaft schien trotz Jescos fehlender Ausdruckskraft bei ihm angekommen zu sein. Das Gesicht seines Zuhörers jedenfalls drückte Betroffenheit aus.
"Wie du das sagst...", meinte er, mit einer Spur Verblüffung in der Stimme.
"Verstehst du?" fragte Jesco zurück. "Die Sache mit ihr ist alles andere, als ein Scherz. Ich liebe sie wirklich." Jetzt hatte er zum zweiten Mal das gesagt, was seine alten Freunde von jeder billigen Nutte gesagt hatten. Er fühlte sich schlecht dabei, denn er hatte das Gefühl, ehrliche Empfindungen in unehrliche Worte zu packen. Doch Robin schien zu verstehen, was er sagen wollte. Zumindest besagte dies sein Gesichtsausdruck.
"Ich bin direkt zum Haus ihrer Großmutter gegangen", berichtete Jesco weiter. Robin hatte indessen mit dem Essen nicht wieder begonnen. "An einer Seite des Hauses waren sämtliche Fenster wie aus den Rahmen gesprengt und die Gardinen von den Stangen gerissen. Frau Sleyvorn stand in einem der unteren Zimmer und wollte mir keine Fragen beantworten. Ich glaube, dass das Zimmer, in dem sie sich aufhielt, Tadeyas Schlafkammer war. Und genau gegenüber dieses Fensters schien das Zentrum der Explosion, oder als was auch immer man es bezeichnen soll, gewesen zu sein."
Robin hustete.
"Frau Sleyvorn hat mich vom Grundstück verjagt", fuhr Jesco fort. "Und mir gesagt, dass jegliche Beziehung, die ich zu ihrer Familie habe, hiermit beendet sei."
Sein Zuhörer schaute ihn stumm an.
"Ich habe Gott um Hilfe gebeten, direkt vor dem Haus der Sleyvorns, auf der anderen Straßenseite", erzählte Jesco. "Und als Antwort hat er mir den Wirt gezeigt, wie er am Zapfhahn steht und Bier in seine Krüge laufen lässt."
Wieder hustete Robin, hielt sich die eine Hand vor den Mund und klopfte sich mit der anderen kräftig gegen die Brust.
"Hast du Tadeya gesehen?" fragte Jesco hoffnungsvoll. "Denn vielleicht sollte ich ja dich hier treffen."
Sein Gegenüber brauchte eine Weile, um seine Kehle wieder frei zu bekommen. Erst dann erwiderte er, mit stark belegter Stimme: "Ich habe sie nicht gesehen."
Danach wandte er sich recht abrupt wieder seinem gefüllten Teller zu und nahm Messer und Gabel in die Hand.
"Vielleicht kannst du mir aber etwas über den Mann erzählen, der sich in einer Steinhütte am Strand niedergelassen hat. Er nennt sich Robert Adlam und reitet ein kräftiges, schwarzes Pferd", fragte Jesco unbeirrt weiter.
Robin, der gerade einen Bissen zum Mund geführt hatte, lies die Gabel wieder sinken. "Wann hast du den denn getroffen?" fragte er deutlich erschüttert.
"Als ich auf Tadeya wartete bereits zum zweiten Mal", antwortete Jesco. "Du kennst ihn?"
"Kennen", meinte Robin, sichtbar noch immer zwischen Verblüffung und Verlegenheit, "ist zu viel gesagt."
"Und wie ist es richtig gesagt?" forschte Jesco nach. Nun dämmerte ihm, dass er wohl tatsächlich mit der richtigen Person sprach. Er musste herausbekommen, was genau Robin mit der ganzen Sache zu tun hatte.
Robin schaute herab auf seinen Teller und steckte sich dann die vorhin verschmähte, gehäufte Gabel in den Mund. Danach kaute er eine Weile, den Blick noch immer konzentriert auf seine Mahlzeit gesenkt.
In Jesco stieg eine bohrende Ungeduld auf. Um sich ein wenig zu beruhigen, kippte er einen großen Schluck Bier hinunter und klammerte sich dann an dem Krug fest. Im Stillen bat er den Herrn um eine ehrliche Antwort seines Gesprächspartners. Doch eigentlich wusste er genau, dass die Ehrlichkeit eines jeden Menschen allein von dessen Willen abhängig war - und Gott respektierte nichts mehr, als eben diesen Willen. Nach beinah einer Ewigkeit schaute Robin wieder zu Jesco und erklärte mit etwas brüchiger Stimme: "Du solltest dem Mann aus dem Weg gehen."
"Etwas Ähnliches hat mir auch Frau Sleyvorn gesagt", berichtete Jesco. "Leider habe ich das Gefühl, dass alle, die das zu mir sagen, weniger um mich besorgt sind, als dass sie etwas vor mir verbergen wollen."
Bereits während er diese Worte aussprach, bereute Jesco sie auch schon wieder. Damit hatte er Robin ganz eindeutig vor den Kopf gestoßen. Wenn dieser nun beleidigt war und das Gespräch abbrach, dann hatte er mit seiner unbedachten Art alles vermasselt. Doch Robin schien die Bezichtigung, die in diesen letzten Worten lag, gar nicht wahrzunehmen, denn er ging nicht darauf ein. In seiner Miene spiegelte sich ein Wirrwarr von Gefühlen wieder, die Kränkung war an ihm vorbeigegangen.
"Ich meine das so ernst, wie du, wenn du sagst, dass du dein Mädchen liebst", betonte Robin, mit weiterhin brüchiger Stimme. "Geh dem Mann einfach aus dem Weg."
"Erzähl mir, was du von ihm weißt. Ansonsten muss ich mich auf den Weg machen und es selbst herausfinden", bestand Jesco auf sein Anliegen.
Robin räusperte sich. Eine Weile gab er keine Antwort. Dann brachte er etwas mühsam heraus: "Das kann ich nicht."
"Dann erzähle zuerst ich dir etwas", gab Jesco nicht auf. "Ich sah ihn, wie er zu der Hütte am Strand ritt und allerlei Sachen herausholte. Als er dabei war, sein Pferd zu beladen, kam ein großer, schlanker Fuchs mit einem dunkel maskierten Reiter auf ihn zu. Der Reiter warf ihm einen schwarzen Sack vor die Füße. Herr Adlam stieg auf sein Pferd, holte den davon reitenden Mann ein und dieser wurde im nächsten Moment zu Boden gerissen. Der maskierte Reiter hatte sich schwer verletzt, doch Herr Adlam war offenbar über irgendetwas sehr wütend und zerrte den Mann trotz dessen großer Schmerzen vom Boden hoch und verfrachtete ihn auf seinen Hengst. Er ritt mit beiden Pferden davon."
Er schwieg kurz, um die sehr komprimierte Geschichte etwas sacken zu lassen. Er konnte sich Robins Aufmerksamkeit sicher sein, denn dieser starrte ihn mit großen Augen an.
"Dazu habe ich einige Fragen", fuhr Jesco fort. "Erstens: Wer war der Reiter auf dem Fuchs?"
Robin schüttelte langsam den Kopf. "Wenn du glaubst, dass ich das weiß...". Sein Gesicht war während dieser Erzählung merklich erbleicht.
"Es könnte ja sein", sagte Jesco und schwieg eine weitere Weile, um seinem Gegenüber Zeit zum Überlegen zu geben. Doch dieser begann, schon nach wenigen Augenblicken abermals den Kopf zu schütteln.
"Ich glaube, du weißt es", bohrte Jesco weiter. "Du siehst so aus, wie jemand, der sich gerade furchtbar erschreckt hat."
Robin schluckte. "Du hast selbst gesehen,", brachte er tonlos heraus, "dass dieser Mann brutal ist."
"Hast du Angst vor ihm?" war Jescos sofortige Frage.
"Wie könnte ich nicht, wenn ich das höre", erwiderte Robin.
"Wer war der Mann, den Herr Adlam vom Pferd geholt hat?" fragte Jesco abermals. Und dann fügte er, mit gesenkter Stimme hinzu: "Bitte, Robin, ich habe Angst um Tadeya. Wenn du weißt, wo sie ist, dann bitte ich dich inständig, mir zu helfen."
Nun schüttelte Robin seinen Kopf mit Nachdruck.
"Ich weiß nicht, wo sie ist", beteuerte er. "Ich kann dir nicht helfen, Jesco. Wirklich nicht."
"Du weißt doch etwas", drängte Jesco noch immer weiter. "Wenn du selbst irgendetwas getan hast, was nicht legal war, dann werde ich darüber schweigen. Ich möchte nur Tadeya zurück, sonst nichts."
"Es tut mir leid", erwiderte Robin und senkte ein weiteres Mal seinen Kopf in dieser merkwürdig ergebenen Art. Dann griff er in seine Tasche und legte mit einer kurzen Handbewegung einen Geldschein auf die Theke, während er sich bereits erhob. "Ich kann dir nicht helfen. Vielleicht kann es dein Gott."
Damit ließ er seine Mahlzeit und sein Bier stehen, nahm sich seinen Mantel und verließ die Gaststätte.