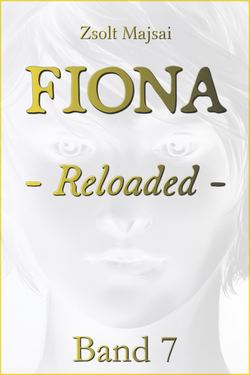Читать книгу Fiona - Reloaded - Zsolt Majsai - Страница 8
ОглавлениеHunger.
Die Dunkelheit seit dem letzten Gongschlag ist mal wieder undurchdringlich. Brauche Kerze. Dringend. Kratzgeräusche, von irgendwoher. Sie machen mich nervös. Eigentlich ist nur Grauhaar da. Und Ratten. Die Ratten mag ich nicht, aber sie sind ungefährlich. Außerdem gut zu essen, wenn nichts anderes da ist.
Ich muss auf die Jagd gehen. Habe keine Vorräte mehr. Also nehme ich meinen Stock und verlasse mein Versteck. Trotz der völligen Dunkelheit gelange ich problemlos nach draußen. Ich kenne den Weg auch blind.
Vor dem verwahrlosten Gebäude bleibe ich stehen, um mich zu orientieren. In den Quons zwischen den beiden Gongschlägen, wenn es dunkel ist, muss ich mich auf meine Ohren und Nase verlassen. Wenn mich etwas bereits berührt, ist es zu spät. So viel habe ich schon herausgefunden. Verbunden mit Schmerzen. Aber Schmerzen sind nützlich, um etwas zu lernen. Auch das weiß ich inzwischen ziemlich gut.
Licht streift mein Auge. Das kann nur Grauhaar sein. Sie ist leichtsinnig, das Feuer ist von draußen zu sehen. Kann ungebetene Gäste anlocken. Und das endet oft schmerzhaft. Ich muss nachher mit Grauhaar reden. Dabei weiß sie das doch.
Ich sehe die Stadt, ihre Lichter, zwischen den Bäumen. Ich mag sie nicht, zu viele Menschen, die unberechenbar sind. Sie mögen mich nicht, ich mag sie nicht. Weder die Stadt noch die Menschen.
Mich mag ich auch nicht wirklich. Ich weiß ja nicht einmal, wer ich bin. Ich bin eine Frau, so viel habe ich inzwischen herausgefunden. Auch eine schmerzhafte Erfahrung gewesen. Allerdings nicht nur für mich. Frausein ist gefährlich. Eine wichtige Lektion. Seitdem passe ich besser auf.
Ich gehe durch den Wald in Richtung Stadt. Rechts sehe ich irgendwann das Haus vom Alten. Es ist kleiner als das Haus, in dem ich … lebe. Und die Grauhaar. Ich glaube, der Alte hat auch mal in dem großen Haus gelebt. Früher. Da war die Grauhaar noch nicht hier. Und ich auch nicht.
Wobei, was mich betrifft, weiß ich es ja nicht. Aber der Alte scheint mich nicht zu kennen, daher glaube ich nicht, dass ich damals in dem großen Haus gelebt habe. Wann das auch immer gewesen sein mag.
Ich bleibe stehen, um die blöden Gedanken abzuschütteln. Obwohl ich nicht ständig darüber nachdenken will, passiert es dennoch. Immer und immer wieder. Wer bin ich? Was bin ich? Wie komme ich hierher?
Ich habe keine Ahnung.
Grauhaar hat irgendwann erwähnt, ich wäre bestimmt hübsch, wenn ich mich endlich mal waschen würde. Sie hat wohl recht. Aber wenn ich hübsch aussehe, wollen die Männer wieder, dass ich eine Frau bin. Das wiederum tut weh. Also bin ich lieber hässlich und stinke.
Ich will wieder losgehen und die dämlichen Gedanken im Wald lassen, als mir etwas auffällt. Im Haus des Alten ist es zu hell. Und da sind Schatten. Obwohl keine sein dürften. Das ist sehr seltsam. Ich sollte nachsehen, ich mag den Alten ja. Aber vermutlich wird es schmerzhaft, ganz sicher sogar. Solche Sachen enden immer schmerzhaft.
Aber ich mag den Alten und er scheint in Gefahr zu sein.
Den Stock fest umklammernd, gehe ich möglichst leise auf das Haus zu. Im Dunkeln ist das nicht so einfach, zumal es unterwegs einige Stufen gibt. Der Garten des Hauses liegt niedriger als der Rest. Warum auch immer. Ich weiß ja nicht einmal, wozu es einen Garten gibt. Früher wusste ich das vermutlich, zumindest habe ich ein vertrautes Gefühl, wenn ich an einen Garten denke.
Doch jetzt sollte ich mich lieber auf die Gäste des Alten konzentrieren. Wobei, Gäste sind es nicht, denn sie haben ihn geschlagen. Der Alte liegt auf dem Boden in seinem Haus, neben einem Feuer. Drei Männer sind bei ihm. Sie sehen so aus, dass ich lieber weglaufen sollte. Möglichst lautlos.
Doch dann wird der Alte sterben. Er sieht jetzt schon so aus, als würde er nicht mehr lange leben. Die haben ihn anscheinend nicht nur geschlagen, sondern mit ihren Messern auch verletzt.
Sehr schmerzhaft.
Ich atme tief durch. Gegen diese drei komme ich sicher nicht an, es ist dumm, noch länger hier zu bleiben.
Neben mir kreischt ein Tier. Keine Ahnung, was für eines, ich sehe es nicht. Aber ich höre es, und nicht nur ich. Die drei Männer blicken zum Fenster, dann laufen zwei zur Tür.
Ich drehe mich um und laufe auch. Weg vom Haus. Vor mir ist es stockfinster, ich sollte nicht so schnell laufen. Dazu kenne ich den Garten nicht gut genug.
Wo ist überhaupt diese blöde Stufe?
Ich werde langsamer, ich will nicht stolpern. Doch dann höre ich jemanden hinter mir keuchen und beschleunige wieder.
Genau als die Stufe kommt. Stechender Schmerz zuckt durch meinen Fuß, mit dem ich hängenbleibe, dann falle ich und komme auf dem weichen Boden zum Liegen. Dabei verliere ich meinen Stock, der raschelnd ins Gebüsch fliegt.
Nicht gut.
Ich will aufstehen, doch ganz schaffe ich es nicht, als ich an den Haaren gepackt und nach hinten gerissen werde. Ich schreie auf und schlage blindlings um mich, treffe sogar etwas. Bis ich dann getroffen werde. In den Bauch. Der Schlag raubt mir den Atem. Ich kann mich nicht dagegen wehren, dass ich von einem der Männer an den Haaren ins Haus geschleift werde.
Er wirft mich neben das Feuer, das mir fast die Haare versengt. Hastig krabbele ich davon und zur Wand. Das Atmen fällt immer noch schwer, aber der Schmerz lässt endlich nach.
Der Alte liegt links von mir und sieht mich an. Er liegt in einer Blutlache. Er röchelt leise. Ich glaube nicht, dass er es noch lange macht. Schade. Ich mochte ihn wirklich. Kurz erwidere ich seinen Blick, dann setze ich mich auf und blicke mich um.
Drei Männer. Der, welcher mich erwischt hat, ist klein und kräftig gebaut. Braune Haare, Stiefel, Hose und Hemd. Einer von denen, die außerhalb der Stadt leben. Sie sind gefährlich und oft hungrig. Manchmal verdingen sie sich als Söldner. Gefürchtet sind sie, hat mir der Alte mal erzählt und dringend vor ihnen gewarnt.
Er scheint recht zu haben.
Die beiden anderen sind größer. Vor allem der eine, mit roten Haaren. Er sieht so aus, als wäre er den Anführer.
Nun kommt er zu mir und hockt sich vor mir hin. Seine braunen Augen mustern mich aufmerksam.
„Wen hast du denn da gefunden, Zama?“, fragt er spöttisch.
„Eine Wildkatze. Sie beißt und schlägt um sich. Pass bloß auf.“
Sie lachen. Was war denn daran witzig? Natürlich schlage, beiße und kratze ich, wenn mir jemand wehtun will. Das ist überhaupt nicht zum Lachen.
„Bisschen dreckig, aber eigentlich doch ein hübsches Ding“, sagt der Rothaarige und legt den Kopf schief.
„Er gehört dir, Raun“, sagt Zama, aber sein Gesichtsausdruck meint das nicht so. Er würde lieber selbst sein Ding reinstecken.
Im Moment möchte ich keine Frau sein.
Raum streckt eine Hand nach mir aus und schiebt mein Kleid hoch. Ich sitze mit angezogenen Beinen an der Wand und starre ihn an. Als das Kleid auf Kniehöhe ist, fällt es an den Oberschenkeln nach unten.
Raun versucht einen Blick zwischen meine Beine zu erhaschen.
„Mach sie auseinander“, sagt er heiser.
Ich schüttele stumm den Kopf. Mein Blick wandert zum dritten Mann. Er ist nicht ganz so groß wie Raun und viel dünner. Er beobachtet mich mit einem neugierigen Blick.
„Mach die Beine auseinander!“, wiederholt Raun deutlich lauter.
Er steht auf und schiebt seine Hose hinunter. Sein Ding kommt zum Vorschein. Groß und fest. Ich starre es in panischer Angst an. Es ist viel größer als das, was mir so wehgetan hat.
„Na, das ist doch mal etwas Ordentliches, oder?“, bemerkt Raun grinsend. „Du scheinst noch nicht sehr erfahren zu sein. Das werden wir nun ändern. Nimm es in den Mund! Los jetzt!“
Er kommt näher und greift nach meinem Kopf. Vermutlich will er mich zwingen, seinem Befehl zu gehorchen.
Irgendwas lässt mich mit beiden Händen sein Ding packen. Hart und irgendwie pulsierend. Und es stinkt. Ruckartig bewege ich meine Hände, als würde ich einen Stock entzwei brechen.
Rauns Schrei ist bestialisch und lässt die anderen erstarren. Ich warte nicht ab, was mit ihm geschieht, sondern springe an ihm vorbei zum Feuer, packe ein brennendes Holzscheit und drücke es gegen den Kopf des Kleinen. Seine Haare gehen sofort in Flammen auf.
„Fett brennt gut“, hatte mal Grauhaar gesagt, als sie in einem Gefäß Rattenfett heiß gemacht hat. Um zu kochen, wie sie sagte.
Zamas Haare müssen sehr fettig sein.
„Tande!“, schreit er. „Mach sie fertig!“
Während er nach draußen rennt, wahrscheinlich, um Wasser zu suchen, werde ich vom dritten Mann, der demnach Tande heißt, gepackt und in die Höhe gehoben. Da er hinter mir steht, kann ich nicht nach ihm treten.
Dann wirft er mich auf den Rücken. Ich bleibe benommen liegen. Er setzt sich rittlings auf mich, seine schlanken Finger legen sich um meinen Hals und drücken zu. Immer fester.
Ich packe seine Handgelenke, aber meine Kraft reicht eindeutig nicht aus. Ich kann ihn auch nicht abwerfen, obwohl ich mich wild hin und her winde. Er ist viel stärker als er aussieht.
Sein Mund verzieht sich zu einem Grinsen.
„Ich werde dich töten. Und dann werde ich dich nehmen. Dein Fleisch bleibt noch ein paar Stunden frisch. Werde viel Spaß mit dir haben.“
Wenn mir nicht etwas einfällt, wird genau das passieren. Das ist mir bewusst. In meiner Wut und Verzweiflung schlage ich nach seinem Kopf. Er lacht nur. Mir kommt eine Idee. Ich packe seine Haare und drücke die Daumen, bevor er etwas dagegen unternehmen kann, in seine Augen. Mit einem wilden Schrei lässt er meinen Hals los und presst die Hände auf seine Augen. Zwischen seinen Händen sickert etwas durch.
Heftig keuchend greife ich nach seinem Messer. Am liebsten würde ich einfach nur liegenbleiben, aber dann werde ich sterben.
Ich stoße Tande von mir und verpasse ihm einen Schlag mit dem Messergriff, sodass er umfällt. Jetzt setze ich mich auf ihn. Er wehrt sich, aber mit einem Hieb gegen eins seiner Augen oder was davon noch übrig ist, ersticke ich seine Gegenwehr.
Dann hole ich aus und ramme das Messer in seine Brust. Doch die Klinge trifft eine Rippe und rutscht ab. Ich falle fast auf Tande, kann mich gerade noch abfangen.
Er schreit wie am Spieß, denn die Klinge hat sich ein wenig zwischen zwei Rippen gebohrt. Ich drehe sie so, dass ich sie zwischen ihnen hindurch tiefer drücken kann. Der Schrei geht ins Röcheln über, aus dem Mund dringt plötzlich Blut.
Und dann erstarrt er. Sein Körper bäumt sich auf. Wahrscheinlich ist die Klinge jetzt in sein Herz eingedrungen.
Es ist still. Unheimlich still.
Und dann erschlafft sein Körper unter mir.
Schwer atmend erhebe ich mich und drehe mich um.
Vor mir steht Zama. Ohne Haare auf dem Kopf, die Haut verkohlt, das Gesicht schwarz. Aber er lebt und brennt darauf, mich zu töten. Mit einer Axt.
Ich springe zur Seite und lasse meine Klinge durch sein Gesicht fahren. Die Axt saust herab und spaltet den Brustkorb von Tande. Der scheinbar tote Körper bäumt sich erneut auf.
Hoffentlich zum letzten Mal.
Zama richtet sich schwerfällig auf. Das holt mich aus der Erstarrung und ich beginne, die Klinge in seine Seite zu rammen. Immer und immer wieder. Sein Blut spritzt, meine Hand ist schon ganz rot, auch etwas anderes hängt daran, vielleicht ein Teil seines Darms. Aber ich höre erst auf, als der unmenschliche Schrei des Kerls endlich verstummt und er langsam umfällt, auf Tande rauf, auf die Axt, die sich noch tiefer in den toten Körper frisst.
Ich sehe mich nach Raun um. Er liegt auf der Seite, beide Hände zwischen seine Beine gepresst. Gut zu wissen, dass die Männer am Ding so empfindlich sind. Das muss ich mir merken. So kann ich ihnen wehtun und nicht sie mir.
Richtig wehtun.
Raun atmet ganz flach, kaum hörbar. Seine Augen sind fast aus ihren Höhlen gequollen. Ob er mich überhaupt sieht?
Ich atme einige Male tief durch, bevor ich ihm die Kehle durchschneide, ganz so wie bei einem erbeuteten Tier.
Er röchelt nur leise, sein Körper spannt sich noch mehr an. Doch nur für kurze Zeit, sein Blut spritzt erschreckend schnell aus dem Hals. Mir wird bewusst, dass sein Herz wie verrückt rast.
Erst als er sich überhaupt nicht mehr bewegt, richte ich mich auf und trete zum Alten.
Seine Augen starren mich regungslos an.
Ich unterdrücke die Tränen. Bald werden andere kommen und seine Vorräte plündern. Wahrscheinlich sogar sehr bald schon.
Ich säubere mich, so gut es geht. Dann gehe ich in das Zimmer, in dem das Bett des Alten steht, und zerre es zur Seite. Darunter befindet sich die Falltür in einen Raum unter dem Haus, in dem er all das gesammelt hat, was er aus dem Haus seines Herrn hat mitnehmen können.
Ich nehme so viel an mich, wie ich tragen kann: Nahrung, Kerzen, zwei Messer. Ich muss mich beeilen. Die Schreie werden schon in kurzer Zeit andere anlocken und sie werden sich gegenseitig totschlagen.
Ich kann noch ein zweites Mal etwas mitnehmen, doch als ich das dritte Mal ins Haus gehen will, sind bereits andere da. Ich höre, wie sie sich streiten und ziehe mich hastig zurück.
In Zukunft werde ich besser einen großen Bogen um dieses Haus machen.
Ich kehre zurück in mein Versteck. Zünde eine Kerze an. Nach kurzem Überlegen nehme ich eine Flasche, in der sich Wein befindet. Grauhaar liebt Wein. Sie hat auch Wein und mir mal welchen angeboten. Danach ging es mir für eine Weile besser. Und dann schlechter.
Mit dem Wein gehe ich zu Grauhaar. Dabei nutze ich einen Weg, auf dem ich die Kerze brennen lassen kann, ohne dass mich das Licht verrät.
Grauhaar sieht auf, als ich ihr Versteck betrete. Hier brennt ein kleines Feuer, doch dieser Raum hat keine Fenster. Es ist ungefährlich.
„Weißt du, wer so geschrien hat?“
Ich gehe zu ihr und setze mich neben ihr ans Feuer. Dann halte ich die Flasche hoch.
„Ich habe Wein.“
„Von dem Alten?“
„Er ist tot. Sie haben ihn getötet.“
Grauhaar mustert mich nachdenklich.
„Das waren nicht seine Schreie.“
„Ich habe die Männer getötet, die ihn getötet haben.“
Sie sieht bestimmt die Blutflecken an meinem Kleid.
„Wie viele waren es?“
„Drei.“
„Und du hast sie getötet? Alle drei?“
„Ja.“
Grauhaars Gesichtsausdruck verändert sich, aber ich verstehe nicht, was er bedeutet.
„Ich würde zu gerne wissen, wer du wirklich bist“, murmelt sie.
„Ich auch“, erwidere ich. „Trinken wir jetzt den Wein?“
Grauhaar nickt. „Ja. Der Alte wird bestimmt nichts dagegen haben.“
„Er ist tot.“
„Ja.“ Sie nimmt die Flasche und trinkt aus ihr. „Er ist tot, du sagst es.“
Ich beobachte sie beim Trinken. Und frage mich, warum sie das sagt. Eigentlich war es gar nicht so schwer, die drei Männer zu töten. Ob Grauhaar das spürt und sich deswegen so seltsam verhält?
Ich beschließe, dass es mir egal ist. Jetzt ist nur wichtig, vom Wein zu trinken.
Dann geht es mir gut.
Zumindest für kurze Zeit.
Kyo.
Kyo klingt gut. Das ist mein neuer Name. Sicher nicht mein richtiger. Aber irgendein Name ist besser als gar kein Name.
Grauhaar hat ihn mir gegeben. Weil ich kämpfen kann wie ein Kyo, die wilde Raubkatze. Da hat sie wohl recht. Der Name fällt ihr ein, nachdem ich ihr endlich erzähle, was in der Hütte vom Alten passiert ist.
Ja, Kyo klingt gut. Gefällt mir.
Es ist noch nicht viel Zeit seit dem letzten Gongschlag, der die Helligkeit verkündet hat, vergangen. Ich beeile mich, denn ich habe viel vor und muss es schaffen, bevor es wieder dunkel wird. Die Zeit zwischen den Gongschlägen ist immer gleich lang, sagt die Alte. Ich bin mir da nicht so sicher, aber es kann schon sein, dass ich es nur unterschiedlich empfinde, je nachdem, was ich tue.
Als Erstes gehe ich zum Fluss. Ich will mich waschen. Bisher dachte ich, ich sollte lieber stinken und hässlich sein. Dann wollen die Männer mich nicht als Frau. Aber anscheinend ist es den Männern egal, wenn eine Frau stinkt und hässlich ist. Also kann ich mich ja auch waschen. Vielleicht hört dann das Jucken auf. Die Alte meinte, dass es aufhören wird.
Ich ziehe das Kleid aus und gehe ins Wasser. Das Kleid nehme ich mit, es stinkt auch. Ihm ist das zwar egal, aber mir nicht. Ich tauche unter, dann schwimme ich am Ufer entlang hin und her. Schließlich gehe ich wieder aus dem Wasser raus und ziehe das nasse Kleid an. Fühlt sich unangenehm an, wie sonst nach einem Regen. Zum Glück regnet es nur in jeder fünften Num, aber dann durchgehend, im Hellen und im Dunkeln. In so einer Num vermeide ich das Rausgehen.
Heute ist es jedenfalls schön warm und trocken.
Ich fülle die beiden Kannen mit Wasser, die ich mitgebracht habe. Eine ist für Grauhaar. Die stelle ich im Hauseingang ab, bringe meine Kanne in mein Versteck, dann hole ich die zweite Kanne und gehe zu Grauhaar.
Sie liegt neben dem Feuer auf dem Rücken. Mit offenen Augen. Ich stelle die Kanne hastig ab und laufe zu ihr.
„Grauhaar!“
Sie blickt mich an. „Da bist du ja. Kyo. Kyo ist ein schöner Name!“
„Er gefällt mir auch“, erwidere ich und setze mich, erleichtert, dass sie nicht tot ist.
„Wo warst du?“
„Am Fluss. Gebadet. Und Wasser geholt. Und das habe ich dir doch gesagt, dass ich das machen will.“
„Ach ja, stimmt. Habe es vergessen.“
Ich mustere sie. Sie hat viel mehr Wein getrunken als ich und anscheinend geht es ihr immer noch gut. Ich hatte vorhin Kopfschmerzen, aber die sind inzwischen weg.
„Ich glaube, ich bin betrunken“, sagt sie und grinst.
„Betrunken?“
„Vom Wein! Ich habe zu viel getrunken!“
„Das nennt man betrunken? Wenn man sich gut fühlt?“
Grauhaar lacht auf. „So nennst du es? Du hast recht, ich fühle mich auch gut! Richtig gut!“
Das glaube ich ihr gerade nicht. Ihre Augen sagen etwas Anderes. Vielleicht glaubt man nur, dass man sich gut fühlt, wenn man betrunken ist. In Wirklichkeit ist das eine Lüge. Ich sollte keinen Wein mehr trinken.
„Sie haben sie getötet“, sagt sie plötzlich. „Einfach so getötet!“ Sie stiert mich an.
„Wer hat wen getötet?“ Ich blicke mich verwirrt um, denn wir sind allein, und mir ist vorhin, als ich kam, nichts Verdächtiges aufgefallen. Ich hätte es gesehen, wenn Leichen herumgelegen hätten. Wovon redet sie also?
„Meine Familie. Sie haben meine Familie getötet. Meinen Mann. Meine Kinder. Alle haben sie getötet! Einfach abgeschlachtet haben sie sie!“
„Wer?“
„Die Soldaten. Ich glaube, es waren Soldaten. Nicht unsere. Die aus dem Nachbarland. Sie hätten gar nicht da sein dürfen. Waren sie aber.“ Grauhaar beugt sich vor und zeigt auf mich. „Grenzüberfall. Unsere Soldaten machen das, ihre Soldaten machen das. Dreckschweine!“
„Aha“, erwidere ich. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Ich habe keine Ahnung, wovon sie redet. Außer, dass jemand irgendwann ihre Familie getötet hat. Deswegen versteckt sie sich ja hier. Aber wo ist die Grenze?
„Die Samenfrau hat gesagt, dass das passieren wird. Dass ich alleine überleben werde. Ich habe sie ausgelacht. Hach!“ Sie richtet sich auf. „Ich habe sie ausgelacht! Ich habe laut und schallend gelacht!“ Und sie macht es vor. Klingt nicht fröhlich. Dann beginnt sie plötzlich zu weinen.
Was mache ich jetzt?
Schließlich stehe ich auf, gehe um das Feuer herum und setze mich neben sie. Dann lege ich die Arme um sie. Sie drückt sich an mich und das nasse Gesicht in meine Halsbeuge. Sie stinkt, sie sollte auch mal im Fluss baden. Aber das werde ich ihr vielleicht später sagen, nicht jetzt.
Irgendwann wird sie ruhiger und atmet wieder gleichmäßig. Sie hebt den Kopf.
„Entschuldige.“
„Was?“
„Dass ich dich vollgejammert habe. Es ist schon lange her.“
„Warum weinst du dann?“
„Weil ich mich erinnere. Und es wehtut.“
Ich wende mich ab und starre ins Feuer.
„Es tut mir leid, ich habe nicht daran gedacht. Du würdest dich ja gerne erinnern.“
Ich nicke.
„Ist da gar nichts? Nicht einmal Schmerz?“
„Nein.“
„Das ist traurig. Dann hast du ja gar nichts. Wirklich gar nichts. Das ist sehr traurig.“
Und sie ist wirklich betrunken.
Ich erhebe mich und sehe auf sie hinunter. „Ich komme wieder, wenn du nicht mehr betrunken bist.“
Sie bleibt sitzen und stiert vor sich hin, während ich gehe. Ich verlasse das Haus. Mein Ziel ist die Stadt. Ich muss vorsichtig sein, die Menschen in der Stadt sind komisch. Sie tun so, als hätten sie Angst vor mir. Warum denn? Ich tue ihnen nichts, wenn sie mich in Ruhe lassen.
Die Stadt ist auf der anderen Seite des Flusses und es gibt eine Brücke. Sie ist aus Stein, ich muss aufpassen, um nicht auszurutschen. Vor allem wenn es regnet, sind die Steine sehr glitschig.
Ich brauche ein neues Kleid. Doch weit in die Stadt hinein will ich nicht gehen. Je mehr Menschen mich sehen, desto gefährlicher für mich. Vor allem, wenn sie merken, dass ich eine Frau bin.
Nach der Brücke kommen erst einige Häuser in größeren Abständen. Eigentlich sind es mehrere Häuser, die zusammen gehören. Höfe, hat mir mal Grauhaar erklärt. In einem Gebäude wohnen die Menschen, in den anderen die Tiere. So ganz habe ich das nicht verstanden, doch es interessiert mich auch nicht wirklich.
Der Weg führt in einiger Entfernung von den Höfen her. Bäume und Sträucher schützen mich davor, gesehen zu werden. Aber ich sehe die Höfe. Und ich sehe, dass auf einem Wäsche zum Trocknen hängt. Da sind auch Kleider dabei.
Ich schleiche mich heran. Hohes Gras und Gebüsch dienen mir als Deckung. Zum Schluss kommt ein Stück, auf dem ich mich nicht verstecken kann. Das ist der gefährlichste Teil.
Ich verharre hinter einem Strauch und lausche. Kindergeschrei ist zu hören, sonst nichts. Es ist ziemlich nah. Das gefällt mir nicht. Kinder haben meist bessere Augen und Ohren als die Erwachsenen.
Ich kaue nachdenklich auf meiner Unterlippe herum. Ich könnte weitersuchen, auf einem anderen Hof. Das hieße, dass ich noch länger auf dieser Seite des Flusses bleibe. Auch das ist gefährlich, vielleicht sogar gefährlicher als Kinder, die irgendwo in der Nähe spielen.
Ich mustere die Kleider, die aufgehängt sind. Der Wind spielt mit ihnen. Sie könnten mir passen. Und sie sind sauber und nicht zerrissen wie meins.
Ich sollte es wagen.
Die Kleider hängen an einem aufgespannten Seil. Ein Ende des Seils ist am Haus befestigt, das andere an einem Baum. In der Nähe des Baums flattert ein Kleid, das meinen Zwecken völlig genügen würde. Ich kann schnell hinrennen, es nehmen und wieder in mein Versteck zurückkehren.
Ich lausche kurz auf das Geschrei, um sicherzugehen, dass die Kinder mich nicht bemerken können, dann setze ich meinen Plan um. Ich brauche nur wenige Augenblicke dafür. Gleich darauf hocke ich keuchend hinter dem Strauch und halte das erbeutete Kleid in den Händen.
Nach kurzem Zögern ziehe ich das alte aus und das neue an. Das alte schiebe ich so unter das Gestrüpp, dass es kaum zu sehen ist, dann mache ich mich auf den Rückweg.
Als die Brücke in Sichtweite kommt, beginne ich leise zu summen. Ich habe doppelt Glück gehabt. Ich musste gar nicht wirklich in die Stadt gehen und ich wurde nicht gesehen.
Auch ich darf mal Glück haben. Das hat jedenfalls der Alte bei irgendeiner Gelegenheit gesagt. Als er noch gelebt hat. Der Gedanke an den Alten lässt mich verstummen und meine gute Laune ist fort.
Ich betrete die Brücke. Die Steine sind hart unter meinen nackten Sohlen, ich muss vorsichtig gehen, damit ich mich nicht schneide. Wie kann man nur so blöde Brücken bauen?
Als ich fast in der Mitte der Brücke bin, höre ich plötzlich ein Geräusch. Ich verharre. Lausche. Dann wird mir klar, dass es Pferde sind, die im Galopp ankommen. Kaum wird mir das klar, tauchen sie auch schon aus dem Wald auf und kommen auf mich zu.
Hastig versuche ich, auf eine Seite der Brücke zu gelangen, um aus dem Weg zu sein. Dabei stolpere ich, weil ich mich an einer blöden Steinkante doch noch schneide. Zwar hat die Brücke Seitenbegrenzungen, aber sie sind gerade mal kniehoch. Und aus Steinen. Beim Versuch, mich mit den Händen abzustützen, rutsche ich ab, vom eigenen Schwung getragen. Während mein Kopf gegen etwas Hartes kracht, setzt mein Körper ohne mein Zutun den Weg ins Wasser fort.
Dann wird alles dunkel.
Kalt. Dunkel. Gestank. Alles gleichzeitig.
Ich hebe den Kopf. Spüre Steine unter dem Bauch. Von rechts kommt kaum bemerkbares Licht. Das flackernde Licht einer weit entfernten Kerze wahrscheinlich. Die Steine sind kalt. Und ich bin nicht allein. Ich höre Menschen atmen. Viele Menschen. Einige flüstern.
Ich setze mich auf. Kälte, Gestank, fast völlige Dunkelheit. Das Letzte, was ich sah: Soldaten.
Ich bin im Kerker. Grauhaar hat davon erzählt. Böse Menschen kämen hierher. Aber ich bin nicht böse. Was habe ich denn getan? Ja, ich habe die drei Männer getötet, aber böse waren sie, nicht ich.
Was ist überhaupt passiert? Ich war auf der Brücke, bin ausgerutscht und mit dem Kopf gegen die Seitenmauer gestoßen. Ich taste nach der Stelle und spüre getrocknetes Blut. Ich bin wohl in den Fluss gefallen. Vermutlich haben mich die Soldaten herausgeholt.
Warum haben sie mich in den Kerker gebracht?
Ich atme tief durch, um die Angst zu beherrschen, die aus meinem Bauch kriecht und den ganzen Körper in ihren Besitz bringen will.
„Neben mir ist noch Platz.“
Es ist die Stimme eines alten Mannes. Er klingt nicht so, als wäre er gefährlich. Nach kurzem Nachdenke krabbele ich in seine Richtung, bis ich ein Bein berühre. Dann spüre ich seine Hand, die mir den Weg weist. Er sitzt mit dem Rücken an der Wand.
Links von mir sitzt oder liegt auch jemand und atmet ganz schwach. Grauhaar hatte wohl recht, als sie meinte, hier käme niemand lebend raus. Der links von mir kommt bald hier raus, das höre und spüre ich.
„Danke“, sage ich leise.
„Gerne getan. Die Wärter sagten, sie bringen eine Diebin. Was hast du gestohlen? Brot?“
„Ein Kleid. Mein altes war blutig und zerrissen.“
„Verstehe. Du hörst dich jung an.“
„Ja.“ Ich versuche, seine Umrisse in dem sehr schwachen Licht von draußen zu erkennen. „Du nicht.“
„Ich bin schon alt“, sagt er und lacht leise. „Wohl zu alt für dich.“
„Ich bin für alle zu alt“, erwidere ich hastig. Ich hätte mich nicht neben ihn setzen sollen.
„Oh, du brauchst von mir nichts zu befürchten. Ich bin nur ein alter Mann, der hier auf sein Ende wartet.“
„Ein blinder, alter Narr!“, ruft jemand aus der Dunkelheit. „Und jetzt seid still, wir wollen schlafen!“
Er ist blind? Ich halte den Atem an und schäme mich.
„Lass ihn reden“, sagt der Alte und lacht leise in sich hinein. „Er hat einen großen Mund, aber wenn es darauf ankommt, hört man nichts von ihm.“
„Sei bloß still!“, ruft die Stimme von vorhin.
„Es wäre besser, du würdest endlich dein Maul halten!“, erwidere ich laut.
Jemand lacht, aber der mit dem großen Mund scheint wirklich ein Feigling zu sein. Jedenfalls sagt er gar nichts mehr.
„Warum sperren sie einen alten, blinden Mann hier ein?“, erkundige ich mich.
„Weil ich gebettelt habe. Und das passt dem feinen Lord nicht, in seiner schönen Stadt Iokya hat niemand zu betteln. Dann sollte er halt seinen Leuten genug zu essen geben!“ Er lacht wieder, aber es klingt nicht fröhlich.
„Welchem Lord?“
„Na, unserem Lord.“
„Ich kenne unseren Lord nicht. Was ist ein Lord?“
„Du weißt nicht, was ein Lord ist? Wo kommst du her?“
Ich schweige. Woher soll ich das denn wissen? Und dass ich mich nicht erinnere, will ich hier nicht laut sagen. Also schweige ich lieber.
„Ein Lord ist jemand, dem eine Stadt gehört. Sie gehört ihm nicht wirklich, aber er verwaltet sie für den König. Lord Sakumo verwaltet Iokya für König Askan. Von König Askan hast du aber schon gehört?“
„Nein.“
Jetzt schweigt er. Er schweigt so lange, dass ich einschlafe. Nur kurz. Glaube ich. Ich sehe Menschen mit aufgeschnittenen Bäuchen oder abgeschnittenen Händen. Grauhaar hat erzählt, dass Diebe bestraft werden, indem sie ihnen die Hände abschneiden.
Dann schreit jemand und ich schrecke auf. Es ist draußen wieder hell, also habe ich länger geschlafen und geträumt. Doch das Schreien habe ich nicht geträumt, denn ich höre es immer noch.
Ich sehe mich um. Jetzt kann ich erkennen, dass ich in einem Verlies bin. So nannte Grauhaar die Orte im Kerker. Mit etwa 20 anderen Leuten, von denen die meisten auch an der Wand sitzen oder liegen.
Aber nicht alle. Eine Frau liegt halb auf dem Boden, sie blutet am Kopf. Sie ist diejenige, die schreit. Und sie schlägt auf einen dreckigen Mann ein, der ähnlich gekleidet ist wie die drei aus der Hütte des Alten. Er hockt halb auf einem Mädchen, das deutlich jünger ist als ich oder die blutende Frau. Dann verstehe ich endlich ihr Geschrei. Sie schreit, dass er ihre Tochter in Ruhe lassen soll. Und ich sehe, dass der Rock des Mädchens zerrissen ist und er gerade sein Ding rausholt.
„Tue das nicht“, sagt der blinde, alte Mann.
Woher weiß er, was ich vorhabe?
Ich springe auf, als Einzige. Die anderen blicken weg. Obwohl der dreckige Kerl das Mädchen gegen seinen Willen nehmen will. Wie mich damals ein anderer, dreckiger Kerl, dem ich die Nase abgebissen hatte. Und dann mit dem Messer sein Ding abgeschnitten. Der wird nie wieder ein Mädchen nehmen.
Und dieser hier auch nicht! Ich werfe mich auf ihn, wir fallen beide auf den Boden. Ich drehe mich hastig um, doch dieser Kerl scheint kampferfahren zu sein. Er ist bereits auf den Knien und schlägt mir die Faust ins Gesicht. Ich falle nach hinten.
„Du bist ja noch besser als die Kleine“, sagt er und lacht, während er mich zu sich zerrt und auf den Bauch dreht. Mit einer Hand umfasst er meine Handgelenke, mit der anderen schiebt er mein Kleid hoch. Dann legt er sich auf mich und drückt sein Ding in mich hinein.
Ich stöhne vor Schmerz auf und merke gleichzeitig, dass ich wieder zu mir komme. Meine Hände hält er mit einer Hand auf dem Rücken fest, mit der anderen Hand stützt er sich neben mir ab. Sein Unterleib geht auf und ab. Ich spüre etwas Nasses zwischen meinen Beinen. Wahrscheinlich Blut, wie beim letzten Mal auch. Mein Blut.
Mit einer wilden, ruckartigen Bewegung drehe ich mich zu seiner Hand hin, die neben mir aufliegt. Er schreit auf und rollt sich ab. Wie gut, dass ich von Raun gelernt habe, dass ich Männern wehtun kann. Ihr Ding ist ziemlich empfindlich. Gut für mich.
Ich drehe mich von dem schreienden Mann weg, bis ich gegen irgendwelche Füße stoße. Doch als ich mich aufrichten will, werde ich von dem Dreckigen wieder auf den Boden gedrückt, und er beginnt, auf mich einzuschlagen. Ich halte die Arme vor das Gesicht, ziehe beide Beine an und stoße ihn mit den Füßen weg.
Er hebt kurz ab, dann prallt er gegen eine Wand. Es macht ein seltsames Geräusch, als auch sein Kopf die Wand berührt, dann sackt der Körper in sich zusammen.
Ich krieche auf allen Vieren zu ihm. Er rührt sich nicht, aber er atmet noch. Ich setze mich auf seine Brust, packe mit beiden Händen seine Haare und beginne, den Kopf gegen den Boden zu schlagen. Zuerst macht es ein hartes Geräusch, aber dann wird es immer weicher. Genau wie sein Kopf. Blut und noch etwas verteilt sich auf dem Boden.
Ich höre erst auf, als sein Kopf in meinen Händen breiartig geworden ist. Ich starre in das, was mal sein Gesicht gewesen ist. Irgendwie sieht es verrutscht aus. Wie ein Lappen.
Dann geht die Tür auf und zwei Männer stürmen herein. Die anderen weichen alle zurück. Die beiden interessieren sich aber nur für mich. Ich vermute, sie sind Wärter.
„Was ist denn hier los?“, fragt einer entgeistert und betrachtet die Reste von dem Dreckigen.
„Er wollte mich nehmen. Ohne meine Erlaubnis“, erwidere ich. Die Sache ist eindeutig: Er war böse, ich habe mich gewehrt. Vielleicht holen sie mich sogar raus?
„Das glaube ich einfach nicht“, sagt der andere. „Los, wir nehmen sie mit. Und ihr alle, wenn ihr auch nur einen Laut von euch gibt, holen wir den Nächsten!“
Das hört sich nicht gut an. Ich will mich aufrichten, doch der Erste packt mich an den Haaren und zerrt mich nach draußen. Ich verliere das Gleichgewicht und schaffe es nicht, auf die Füße zu kommen, während er mich hinter sich herzieht.
Ich höre meine eigenen Schreie, während ich durch enge Korridore geschleift werde. Dann geht es eine Treppe hinauf. Mehrmals stoße ich mit Kopf oder Beinen gegen die harten Stufen, was mir Kraft und Atem raubt.
Als er mich endlich loslässt, bleibe ich keuchend liegen.
„Eigentlich schade um sie“, sagt derjenige, der mich hinter sich hergezogen hat.
Der andere lacht und schiebt mit dem Fuß meine Beine auseinander.
„Was hat sie eigentlich getan?“, fragt er dabei.
„Hat wohl ein Kleid gestohlen und ist dann von der Brücke ins Wasser gefallen. Als man sie in die Stadt bringen wollte und sie bewusstlos auf dem Pferd hing, haben einige Kinder sie als Diebin erkannt, also wurde sie hierher gebracht.“
„Dann ist es doch nicht schade um sie, oder?“
„Hast recht. Eigentlich nicht. Aber ein hübsches Ding, ohne den ganzen Dreck.“
„Ja.“
Sie mustern mich an der Stelle, wo das Kleid hochgerutscht ist. Mein blutiger, nackter Unterleib liegt vor ihnen. Ich spüre Wut in mir hochsteigen.
„Es wäre schade, die Gelegenheit nicht zu nutzen“, sagt der Erste. Der mich an den Haaren gezogen hat.
„Auf jeden Fall. Aber zuerst sollten wir sie töten. Sie ist ganz schön wild. Hast du gesehen, wie der Kopf von dem einen aussah?“
„Allerdings. Richtig übel.“
Ich setze mich auf und wische Blut aus meinen Augen. Die Wut wird immer stärker. Das ist gut, sie gibt mir Kraft.
„Sie ist ja richtig zäh“, bemerkt der zweite Kerl und lacht.
Als ich aufstehe, lacht er nicht mehr. Stattdessen zieht er sein Schwert, genau wie der andere.
„Das ist mehr als nur zäh“, sagt der Erste. „Wir töten sie besser jetzt sofort.“
Sie kommen auf mich zu, beide mit blanken Klingen. Ich beobachte sie und balle die Hände zu Fäusten. Eigentlich ballen sie sich von selbst zu Fäusten, ich will das gar nicht. Ich will weglaufen, doch mein Körper gehorcht mir einfach nicht. Ich will weglaufen, doch er geht sogar auf die beiden zu, mit tänzelnden Bewegungen.
Was geschieht hier?
Als würde ich mich selbst von außerhalb sehen, beobachte ich meinen Körper dabei, dass er den zuschlagenden Klingen geschmeidig ausweicht, sich wegduckt, dann den Ersten am Arm packt und den Ellbogen gegen ihr hochschnellendes Knie schlägt. Ich höre Knochen brechen und den schrillen Schrei des Wärters.
Mein Körper macht inzwischen eine Drehung, der Fuß schnellt hoch und trifft den Zweiten im Gesicht. Er fällt nach hinten um, sein Schwert fliegt im hohen Bogen davon.
Ich entreiße dem Ersten sein Schwert und aus einer Drehbewegung heraus lasse ich die Klinge durch seinen Hals fahren.
Er verstummt, starrt mich an. Dann, nach einigen Augenblicken, fällt sein Kopf nach vorne herunter und der Rest kippt nach hinten.
Der Zweite versucht, hastig aufzustehen, doch mein Körper ist schneller. Die bereits blutige Klinge bohrt sich in den Rücken und kommt vorne aus der Brust raus. Der Zweite erstarrt auch, fast so, wie vorhin der andere. Er dreht den Kopf, bis er mich sehen kann. Sein Mund öffnet sich, doch es kommt nur Blut heraus.
Ich sehe, wie er stirbt und sein Körper erschlafft. Gleichzeitig merke ich, dass ich nicht mehr von außerhalb zuschaue. Ich spüre den Schwertgriff in meinen Händen. Hastig ziehe ich die Klinge aus dem Toten und fahre herum, denn ich höre Lärm.
Natürlich, die Schreie haben andere Wärter angelockt.
Ich blicke mich um. Neben mir der Fluss, auf der anderen Seite das Gebäude mit dem Kerker. Aus dem mehrere Wärter gerannt kommen. Einige haben auch Pfeil und Bogen.
Ich überlege nicht länger, sondern springe ins Wasser. Das Schwert nehme ich mit, obwohl es mich beim Schwimmen behindert. Trotzdem komme ich am anderen Ufer an, bevor die ersten Wärter den Fluss erreichen.
Hastig klettere ich die Böschung hoch und renne in den Wald. Ich renne, bis ich niemanden mehr hinter mir höre.
Dann lege ich mich einfach unter einen Strauch, presse das Schwert an mich und beginne zu weinen.
Ich begrüße die Wärme und stehe mit erhobenen Armen nackt vor meinem Baum. Grauhaar hatte von der kalten Numoa erzählt, wenn mit dem Gongschlag des Dunkelhellwechsels plötzlich kalt wird, Schnee fällt und Wasser hart wird. Jetzt weiß ich auch, was Schnee ist. Weißes Wasser, das wieder flüssig wird, wenn man es in die Hand nimmt. Oder in den Mund. Es ist aber nicht so hart wie das Eis, hartes Wasser, das aber auch wieder weich wird, wenn man es in den Mund nimmt.
Und man braucht gute Kleidung in der kalten Numoa. Denn es ist wirklich kalt. Zum Glück bin ich ja vorbereitet gewesen und habe mir Kleidung von Soldaten besorgt. Sie haben nach mir gesucht, aber im Wald konnte ich mich gut verstecken. Und ich weiß jetzt, dass ich gegen sie kämpfen kann, auch wenn ich nicht verstehe, wieso. Ich denke, das habe ich mal gelernt und es vergessen, so wie ich alles vergessen habe. Die Soldaten wissen auch, dass ich gegen sie kämpfen kann, und sind vorsichtig, aber eben nicht vorsichtig genug. Das heißt, jetzt schon. Nachdem ich einige von ihnen überwältigt habe, weil ich Kleidung brauchte, sind sie viel vorsichtiger geworden und gehen nur noch in größeren Gruppen durch den Wald. Wenn überhaupt.
Mir egal.
Ich verbrachte die kalte Numoa in meiner Baumhöhle, die ich zufällig entdeckt habe. Sie gehörte einem Tier, aber es sah ein, dass ich stärker bin, und suchte sich ein neues Zuhause.
Nun bin ich froh, dass die kalte Numoa vorbei ist. Mit dem Dunkelhellgongschlag ist der Schnee verschwunden und ich brauche nicht mehr unbedingt Kleidung. Wobei sie sinnvoll ist. Im Wald ist es unangenehm ohne Kleidung, sie schützt vor Dornen und Krallen. Aber wenigstens reicht das Kleid wieder.
Ich war bei Grauhaar, nachdem ich die Wärter getötet hatte. Sie sagte, ich sollte mich verstecken, sie werden überall nach mir suchen. Ich durfte ihr nicht sagen, wo ich mich verstecken wollte.
Als Erstes gehe ich im Fluss baden. Das tut nach den vielen Numos gut. Zwischendurch werfe ich einen Blick auf mein Kleid und das Schwert, das auf dem Kleid liegt. In dieser Gegend sind sonst keine Menschen, aber sie werden jetzt, wo es wieder warm ist, sicher erneut nach mir suchen. Ich muss vorsichtig sein.
Und ich muss nachdenken. Was soll ich tun? Hierbleiben? Woanders wird es doch nicht besser sein. Oder doch? Ich klettere aus dem Wasser und setze mich nackt neben mein Kleid, um trocken zu werden. Die warme Luft streichelt meine Haut, und ich habe das Gefühl von Vertrautheit. Etwas ist aber anders. Ich weiß nur nicht, was. Und was überhaupt so vertraut ist.
Wenn ich mich nur erinnern könnte. An irgendetwas. Egal was.
Ich lege mich hin, mit dem Kopf auf dem Kleid. Mit einer Hand umklammere ich den Schwertgriff und weine leise.
Doch vom Weinen wird nichts besser, im Gegenteil. Ich wische die Tränen ab, streife das Kleid über und gehe zurück zu meinem Baum. Ich beschließe, Grauhaar zu besuchen.
Zuerst muss ich sichergehen, dass sie allein ist, also beobachte ich das Haus, das an einigen Stellen nicht mehr so aussieht wie vor der kalten Numoa. Es verfällt, hat Grauhaar mal gesagt. Jetzt kann ich gut sehen, was sie damit gemeint hat.
Ich glaube, ich verfalle auch. Nicht mein Körper, der verfällt gar nicht, aber etwas in mir verfällt. Ich weiß nur nicht, was das ist.
Da Grauhaar allein zu sein scheint und auch sonst niemand zu sehen ist, gehe ich ins Haus. Grauhaar finde ich in ihrem Zimmer, wo sie fast immer ist, wenn ich sie sehe. Als sie mich sieht, lächelt sie.
„Kyo! Kyo ist da!“
„Es ist warm“, erwidere ich und setze mich neben ihr. „Hast du Wein?“
„Ich denke, du trinkst keinen Wein mehr“, sagt sie, holt aber trotzdem eine Flasche hervor. Ohne aufzustehen. Sie hat fast alle ihre Sachen so um sich angeordnet, dass sie nur selten aufstehen muss.
„Heute ausnahmsweise. Wie geht es dir?“
Sie trinkt aus der Flasche, bevor sie mir diese reicht. Ich nehme auch einen Schluck.
„Meine Knochen tun weh. Von der Kälte. Doch jetzt wird es bald besser.“
„Geh doch nach draußen. Da ist es viel wärmer!“
„Zu gefährlich.“ Sie mustert mich. „Für dich auch. Die Leute reden über dich, weil du den Soldaten das Fürchten lehrst. Und es wird geredet, dass der König kommt.“
Ich zucke die Achseln. „Was interessiert mich der König?“
„Seine Soldaten sind gefürchtet. Sie sind nicht so ängstlich und schwach wie die Soldaten von Lord Sakumo.“
„Ja. Gut. Ich passe auf.“ Und sie nervt mich. Manchmal. Obwohl sie recht hat. Ich kann gut kämpfen, das weiß ich ja inzwischen. Aber auch andere können bestimmt gut kämpfen. Echte Soldaten auf jeden Fall. Ich beschließe, dass ich wirklich aufpassen werde.
„Wie ist der König?“, erkundige ich mich.
Grauhaar grinst. „Er interessiert dich also doch! Nun, ein großer Mann, von majestätischer Erscheinung. Wie ein König eben. Ein echter König. Ein weiser, gerechter König.“
„Dann wird er mich nicht jagen lassen! Dann wird er wissen, dass ich nichts Böses getan habe! Ich habe mich nur verteidigt!“
„Woher soll er das wissen? Lord Sakumo wird ihm das bestimmt nicht erzählen.“
„Dann tue ich das!“
Grauhaar lacht kurz auf. „Du kommst nicht einmal in seine Nähe! Halt dich einfach versteckt, solange er da ist. In den Wäldern werden dich auch seine Soldaten nicht finden.“
Ich starre sie wütend an.
„Du brauchst nicht so zu schauen, du Wildkatze. Es ist so, wie ich es dir sage. Oder habe ich dich mal angelogen?“
„Nein“, antworte ich missmutig.
„Dann hör auf mich.“
„Hast du den König schon gesehen?“
Grauhaar nickt. „Er war schon einige Male hier. Er reist oft durch sein Land. Ich glaube schon, dass er dir begnadigen würde, wenn er wüsste, was wirklich passiert ist. Aber er wird es nicht erfahren.“
„Ja. Dann gehe ich lieber jagen. Ich komme nachher nochmal.“
Grauhaar nickt erneut. Ich gebe ihr die Flasche zurück und gehe wieder in den Wald. Dabei denke ich darüber nach, was sie erzählt hat. Der König scheint ein guter Mann zu sein, wenn Grauhaar so über ihn spricht, aber ich glaube, er wird von seinen Leuten beschützt und nur solche wie der Lord können direkt mit ihm sprechen. Das macht er irgendwie falsch, der König. Er müsste eher auf Menschen hören, die wissen, was in seinem Land geschieht.
Zum Beispiel auf dich, Wildkatze?
Ja, zum Beispiel. Wieso rede ich eigentlich mit mir selbst?
Kopfschüttelnd verscheuche ich die Gedanken und konzentriere mich auf das Jagen. Und das ist auch gut so. Ich höre Tiere und schleiche mich an sie heran.
Bären. Eine ganze Bärenfamilie. Von ihnen könnte ich lange satt werden. Allerdings könnte es auch passieren, dass sie von mir satt werden. Nur nicht ganz so lange. Ich suche mir lieber leichtere Beute.
Ich muss nicht lange suchen. Den Elch kann ich riechen, bevor ich ihn sehe oder höre. Wenn ich ihn rieche, dann riecht er mich wahrscheinlich nicht. Ich schleiche mich möglichst lautlos heran. Einmal knackt ein Zweig, aber nicht unter meinem Fuß. Da kann ich den Elch schon sehen. Er reißt den Kopf mit dem gewaltigen Geweih in die Höhe und lauscht. Dann bemerkt er, wie ich auch, dass das Geräusch von einem Fuchs verursacht wurde, und grast weiter.
Ich atme leise aus.
Schließlich trennen nur noch ein paar Bäume den Elch und mich voneinander. Ich beobachte das große, starke Tier. Es widerstrebt mir, es zu töten, aber ich habe ziemlich großen Hunger. Und das frische Fleisch würde mir guttun.
Ich treffe eine Entscheidung und springe mit erhobenem Schwert vor. Der Kopf des Elchs geht nach oben, dadurch muss ich die Richtung der Klinge etwas ändern. Doch ich habe damit gerechnet. In der kalten Numoa habe ich Gelegenheit gehabt, das schnelle, schmerzlose Töten von Nahrung zu üben. Auch dieses Mal dauert es nicht lange. Erst fällt der Kopf des Tieres ins Gras, dann bricht der Körper nach ein paar Fluchtschritten zusammen.
Ich zerlege ihn hastig, denn ich weiß, dass auch Bären gerne Elchfleisch essen. Bis auf ein Hinterbein vergrabe ich alles neben einem Baum, dann pinkele ich auf die Stelle. Mit etwas Glück wird das andere Tiere davon abhalten, hier zu graben.
Mit dem Bein in der Hand gehe ich wieder zu Grauhaar, wie ich es ihr versprochen habe. Sie kann das frische Fleisch auch gut gebrauchen, die Spuren der Entbehrung aus der kalten Zeit sind ihr sehr deutlich anzusehen. Das macht mir etwas Sorgen.
Ich bleibe am Waldrand stehen und blicke mich um. Es sieht alles wie vorher aus. Trotzdem habe ich ein komisches Gefühl. Ist Grauhaar vielleicht etwas passiert? Ich mustere kurz das Bein in meiner Hand und denke nach. Ich glaube nicht, dass die Männer des Lords hier sind. Das würden sie nicht wagen, dazu haben sie viel zu viel Angst vor mir. Wieso habe ich dann trotzdem das Gefühl, etwas stimmt nicht?
Ich finde es jedenfalls nicht heraus, wenn ich hier stehenbleibe. Also nähere ich mich dem Haus, in der linken Hand das Bein und in der rechten das Schwert. Dabei beobachte ich aufmerksam meine Umgebung, mit allen Sinnen.
Das rettet mich. Als sich Männer aus Schatten lösen und aus dem Haus kommen, weiß ich, was ich wahrgenommen habe. Darüber, wieso sie sich hierher getraut haben, denke ich lieber später nach.
Zwei Soldaten sind besonders nah. Einem von ihnen schlage ich das Bein auf den Kopf, was ihn zu Boden schickt, den anderen halte ich mit der Klinge auf Abstand. Er springt zurück, die Klinge streift dennoch seine Nase. Aufschreiend presst er die Hand auf die Wunde, während ich mich umdrehe und losrenne.
„Ich will sie lebend!“, ruft jemand mit dunkler, kräftiger Stimme.
Das freut mich, denn das erhöht meine Chance zu entkommen sehr.
Ich erreiche den Waldrand. Gleich bin ich in Sicherheit, denn zumindest mit Pfeilen können sie mich dann nicht mehr treffen. Außerdem weiß ich, dass ich im Wald wesentlich schneller bin als sie. Das konnte ich oft genug ausprobieren.
Dann reißt mir etwas den Boden unter den Füßen weg und mich in die Höhe. Es schnürt mir die Bewegungsfreiheit ab und umgibt mich aus allen Richtungen.
Ein Netz!
Ich schreie vor Wut auf, doch mehr kann ich nicht tun. Zwar habe ich das Schwert noch, aber meine Arme werden an den Körper gepresst, und ich kann sie nicht bewegen. Hilflos muss ich zulassen, dass jemand zu mir tritt und das Schwert aus meiner Hand zieht. Ich starre ihn an, doch er erwidert den Blick nur grinsend.
„Das war es für dich, Kleines“, sagt er. Er ist groß und muskulös. Seine grüne Augen wirken kalt.
Ich antworte nicht, sondern sehe mich um, soweit es in meiner Lage überhaupt möglich ist. Zumindest kann ich den Kopf drehen und so erkennen, dass mehrere Männer auf mich zukommen, unter anderem einer, der eindeutig das Sagen hier hat. Sowohl seine Kleidung als auch seine Körperhaltung verraten es.
Unterdessen sind weitere Männer neben den Grünäugigen getreten und mustern mich unverhohlen.
„Vor der haben Sakumos Leute so eine Angst?“, fragt einer ungläubig. „Ist ja ein Mädchen!“
Grünauge schüttelt den Kopf. „Hast du gesehen, wie sie sich mit Schwert und Schinken verteidigt hat? Sie ist zwar nur ein kleines Mädchen, aber trotzdem nicht ungefährlich. Eine Wildkatze.“
Ich versuche ihn anzuspucken, aber in meiner Lage ist es schwierig, das zu treffen, was ich treffen will. Zumal er lachend zurückspringt.
„Ob ihre Spucke giftig ist?“, meint ein weiterer lachend. „Vielleicht sollten wir ihr ihr Kleid in den Mund stopfen!“
„Das reicht jetzt!“, sagt der Befehlshaber. Dieselbe Stimme, die mich vorhin lebend haben wollte. „Holt sie runter und fesselt ihre Hände!“
Jemand schneidet das Seil durch, mit dem das Netz aufgehängt wurde. Ich falle auf den Boden, was mir den Atem raubt. Bis ich wieder klar denken kann, sind meine Hände auf dem Rücken gefesselt. Das lange Ende der Fessel hält jemand in der Hand. Als ich auf ihn losstürmen will, richten sich mehrere Schwertspitzen auf mich.
Ich erstarre.
„Du hast die Wahl“, sagt der Befehlshaber. „Du läufst freiwillig mit oder wir fesseln dir auch die Füße und schleifen dich hinterher. Wie ist es dir lieber?“
„Laufen.“
„Gut. Holt die Pferde!“
Die Soldaten steigen alle auf Pferde, ich nicht. Ich soll hinter einem herlaufen. Da meine Hände hinten gefesselt sind, muss ich darauf achten, dass das Seil sich nicht spannt, sonst werde ich von den Füßen gerissen. Einmal passiert es mir. Die Männer lassen ihre Pferde sofort anhalten und warten, bis ich aufgestanden bin.
„Lauf schneller!“, sagt der Befehlshaber. „Weiter.“
Ich muss schnell gehen, aber nicht rennen. Zwischendurch kann ich sogar die Männer beobachten. Der Grünäugige reitet zusammen mit sechs anderen etwas abseits. Der Befehlshaber hat kurze, schwarze Haare. Er ist nicht viel größer als ich, aber kräftig gebaut. Er ist es vermutlich nicht gewohnt, dass er Widerworte kriegt. Ich habe das Gefühl, dass er nicht gemein ist, im Gegensatz zu dem Grünäugigen, den seine Gefährten Moyto nennen.
Wir überqueren die Brücke, was etwas schmerzhaft ist, denn die Pferde werden nicht langsamer. Das führt zu blutenden Füßen. Der Befehlshaber bemerkt das etwas später, lässt alle anhalten und kommt zu mir.
„Was ist los?“
„Die Brücke“, erwidere ich und konzentriere mich darauf, die Tränen zu unterdrücken.
Er steigt ab und schaut sich meine Füße an. Dann steigt er wieder auf und bemerkt: „Nur kleine Kratzer. Davon stirbst du nicht. Weiter.“
Vielleicht ist er doch gemein. Aber er hat recht, denn bald blutet es nicht mehr und die Schmerzen lassen nach. Außerdem bin ich beschäftigt, denn wir erreichen die Häuser. Die Menschen bestaunen uns, insbesondere mich. Ich vermeide es, sie anzusehen.
Die Häuser werden immer größer und die Menschen mehr. Mir fällt es zunehmend schwer, die Leute zu ignorieren. Einige Kinder laufen mit und schmeißen Steine nach mir, bis der Befehlshaber dafür sorgt, dass sie damit aufhören.
Schließlich erreichen wir ein sehr großes Gebäude, das von einer Mauer umgeben ist. Durch ein Tor gelangen wir auf die andere Seite der Mauer.
Vor dem Eingang ins Gebäude stehen einige Männer herum und warten. Anscheinend auf uns, denn einer von ihnen kommt jetzt auf uns zu und baut sich vor mir auf. Er mustert mich mit unverhohlenem Ekel.
„Dieses Mädchen soll meine Soldaten so eingeschüchtert haben?“
Das ist also Lord Sakumo. Ich erwidere seinen Blick, dann trete ich nach ihm. Er weicht aus und mein Fuß streift ihn nur. Sofort danach werde ich von mehreren Männern gepackt und auf den Boden gedrückt. Ich versuche, mich zu wehren, doch es ist aussichtslos.
„Genug!“, ruft eine Stimme, die ich noch nicht kenne. Sie ist ähnlich durchdringend wie die des Befehlshabers, aber es ist einer der Männer, die auf uns gewartet haben. Er trägt schwarze Kleidung und wirkt sehr groß.
„Lasst sie aufstehen!“
Die Männer lassen von mir ab, bleiben aber bei mir. Einige haben ihre Schwerter gezogen. Ich richte mich auf und starre den Mann, der vielleicht sogar der König ist. Selbst Lord Sakumo wagt es nicht, ihm zu widersprechen.
„Wir sollten sie sofort hinrichten, öffentlich“, sagt der Lord jetzt leidenschaftlich. „Damit dieses Gesindel ein für alle Mal lernt, dass hier Recht und Ordnung herrschen!“
„Nein“, erwidert große Mann. „Sie blutet im Gesicht. Wischt ihr das Blut ab.“ Nachdem einer der Männer mein Gesicht gesäubert hat, betrachtet der Mann mich. „Ich bin König Askan. Wie ist dein Name?“
„Kyo.“
Er lächelt jetzt. „Der Name scheint zu passen. Ist es wahr, dass Du Lord Sakumos Männer grundlos getötet hast?“
Ich schüttele den Kopf.
„Du hast sie nicht getötet?“
„Nicht grundlos.“
„Ich verstehe.“ Er wendet sich an den Mann mit der tiefen Stimme. „Gaskama, sorge dafür, dass sie in den Kerker kommt. Aber allein. Sie soll Wasser und was zu essen bekommen. Die Fesseln werden ihr abgenommen. Und, Lord Sakumo, wenn ihr was zustößt, verantwortet Ihr das persönlich. Habt Ihr das verstanden?“
„Ja, mein Herr“, erwidert der Lord und wirft mir einen hasserfüllten Blick zu.
Gaskama, der Mann mit der tiefen Stimme, gibt zwei Männern einen Wink, die mich daraufhin in den Kerker bringen. Er begleitet uns. In der Zelle schneidet er meine Fesseln durch, während die beiden Männer mir ihre Schwerter an den Hals halten. Dann gehen sie, aber schon nach kurzer Zeit kommt jemand mit Wasser und Brot. Er legt beides so hin, dass ich es mir holen kann, und geht wieder, ohne etwas zu sagen.
Es wird still. Sehr still.
Ich setze mich an die Wand gegenüber der Tür und starre die Schalen an. Die Tränen wollen wieder mit aller Macht nach draußen, doch ich will nicht weinen. Jetzt nicht und niemals wieder.
Leider gehorchen sie mir nicht. Es dauert eine Weile, bis sie versiegen. Ich erhebe mich schließlich und hole die Schalen mit Wasser und Brot, denn ich habe noch mehr Hunger als vorhin. Während ich die letzten Bissen mit Wasser herunterspüle, erklingen Schritte.
Es ist der König, und er ist allein. Er bleibt vor der Tür stehen und mustert mich nachdenklich.
Ich rühre mich nicht.
„Warum hast du die Männer des Lords getötet?“, fragt er nach einer Weile.
Ich denke darüber nach, ob ich ihm erzählen soll, was passiert ist. Aber ich bezweifle, dass er das verstehen wird. Er ist ein Mann und hat ein Ding. Er kann es nicht verstehen.
„Du redest also nicht mit mir“, sagt er seufzend. „Ich komme in der nächsten Num wieder. Bis dahin kannst du ja darüber nachdenken.“
Er geht wieder und die grauenvolle Stille senkt sich über mich. Ich atme tief durch.