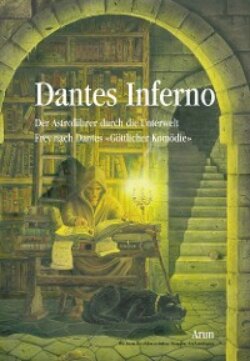Читать книгу Dantes Inferno I - Akron Frey - Страница 5
Vorwort
ОглавлениеDANTES «DIVINA COMMEDIA»
Dantes Werk im Spiegel der Zeit
Wenn sich heute jemand an Dante heranwagt, muß er sich zunächst einmal ganz klar darüber werden, was er sagen will. Um Himmel und Hölle kann es ja nicht mehr gehen. Der ewig Strebende, der die Schreckensgewölbe durchdringt und ins Paradies eingeht – ist das noch einsehbar? Zwar kennt die Weltliteratur kein vergleichbares Werk, das in seinen epochalen Ausmaßen Himmel und Hölle so ausschließlich miteinander verbindet und in dem sich das ganze Weltbild seiner Zeit in einem überragenden Kunstwerk von solch hoher Qualität zusammenballt. Dantes gewaltiges Gedicht mit seinen hundert Gesängen führt in einer geistigen Schau von der Darbietung des Jammers (Inferno) über die Schutthalden des Seeleninneren (Purgatorio) bis hin zu den Türmen der Erlösung (Paradiso). Doch obwohl die Kraft seiner inneren Visionen sich bis heute als unerreicht zeigt, stellt sich die Frage, ob der Geist, den der Christ Dante einem jeden Ereignis aus seiner christlich-moralischen Sicht unterlegte, in unserer Zeit noch greift; ob Dantes Universalität, Himmel und Hölle durch ein persönliches Erleben in seiner ganzen Tiefe zu durchleiden und gewissermaßen als persönliche Abrechnung zu einem monumentalen Kulturgemälde zu verarbeiten, über den Status einer Pflichtlektüre an höheren Schulen hinausreichen kann und noch andere Leserkreise als nur die der Literaturwissenschaftler und Kulturhistoriker zu interessieren vermag.
Der moderne Leser, der allenfalls an Gott, kaum noch an Jesus, am allerwenigsten jedoch an Himmel und Hölle glaubt, könnte ein Werk als befremdlich empfinden, das sich mit einzigartiger dichterischer Kraft ausschließlich der Wanderung durch Himmel und Hölle widmet, um so mehr da aus der heutigen Sichtweise klar wird, daß die Hölle zu Dantes Zeit weniger ein Gleichnis für die inneren Ängste war, sondern vor allem ein zum eigenen Machtgewinn benutztes Instrument der Einschüchterung seitens der Priesterkaste. Im Licht dieser Erkenntnis muß dem Leser Dantes geistige Achse seines Riesenepos trotz der hymnischen Kraft seiner Gesänge etwas schief erscheinen. Da die Vorstellungen vom Jenseits natürlich immer auch die geistige Entwicklung einer Gesellschaft innerhalb ihrer Zeit repräsentieren, war es daher unabdingbar, Dantes «Höllentrichter», der entstand, als Luzifer bei seinem Abfall von Gott aus dem Kristallhimmel in den Mittelpunkt der Erde geschleudert wurde, mit den heutigen Erkenntnissen über die Abgründe im Menschen in Verbindung zu bringen.
Dantes alttestamentarische Ausrichtung
Wenn wir Dantes Lebenslauf betrachten, so erkennen wir, daß dem frühen Erfolg, der ihn bereits in jungen Jahren in hohe politische Ämter aufsteigen ließ, schon bald die Verstrickungen in politische Intrigen mit anschließender Flucht und lebenslangem Exil folgten. Bemühte er sich vorerst, die Wiederherstellung seines Rufes und Ranges vor allem durch schriftstellerische Leistungen zu erkämpfen, so brach er dieses sinnlose Bemühen später ab. Aber schon hier wird Dantes zwiespältige Haltung zwischen geistiger Erneuerung und gesellschaftlicher Anpassung sichtbar, die ihn und sein Werk in das sengende Fegefeuer zwischen Revolution und Resignation schickte. Denn von ihrer architektonischen Form her wurde die Hölle von ihm nicht revolutioniert. Er hat seine Visionen im Stil der älteren, populären Überlieferungen der jüdischen Apokalyptik entwickelt, wie sie sich etwa im Henochbuch (3./2. Jh.v. Chr.) finden. Die jüdisch-apokalyptische Vorstellung einer von Würmern belagerten Jenseitslandschaft, in der ein großes Feuer wütet und Strafengel die Folterung der Sünder vorbereiten, muß als direkter Vorfahre von Dantes «Inferno» gelten, wo die Sünder bei lebendigem Leibe im Schlamm begraben, in Sümpfe verbannt, in Felskammern gesperrt, an Steine gekettet und zwischen Baumstämme geklemmt geschildert werden. Sein inhaltlicher Beitrag war dementsprechend auch kein grundlegend-verändernder, sondern nur ein formal-umkehrender: statt der üblichen Sünder und primitiven Gesellen ließ er historische Persönlichkeiten, Fürsten, Kirchenobrigkeiten und andere «Schreibtischtäter» im Feuer schmoren. Diese ketzerischen Spitzen verleihen seinem Werk aus heutiger Sicht durchaus einen Anstrich revolutionären Umbruchs, doch im inhaltlichen Sinn ist er über Denker wie beispielsweise Origenes nicht hinausgekommen, der schon im 3. Jahrhundert die Meinung vertrat, daß Gott reiner Geist sei und das Höllenfeuer metaphorisch, und der das schreckliche Höllengericht durch die universale Versöhnung mit Gott ersetzte, wodurch letztlich alle Sünder erlöst würden. Auch der logische Scharfsinn, mit dem Thomas von Aquin über den Sinn der Höllenstrafen nachdenkt und sich mit der Frage beschäftigt, ob das Mitleid der Seligen die Strafen der Gottlosen nicht mildere und ob das Strafmaß der Ewigkeit die Richter nicht selbst zu Tätern mache, wird von Dante nur stellenweise gestreift, etwa, wenn sich die Verdammten vor Dante ob ihrer Taten schämen, aber nicht, um das unerbittliche Strafmaß der Höllen aufzuweichen, sondern um ihre Greueltaten zu zementieren und die Lauterkeit seiner Visionen, die die politisch Ungerechten und die machtgeile Kirchenmafia in der Hölle beeinflußt, seinerseits wieder abzusichern.
Dantes kultureller Einfluß
Aus dieser Perspektive ist Dantes genialer Ansatz unter geistig-erneuerndem Aspekt gar ein rückwärtsgerichteter oder konservativer, weil die persönliche Abrechnung, die Dante in seine höllischen Gesänge mit hineingepackt hat, ohne die dunkle Kraft ihrer Poesie die Jahrhunderte wohl kaum überdauert hätte. Und dieser visionären Schau eines über sich selbst hinausweisenden Epos ging es natürlich zuallerletzt darum, den Mißbrauch der Hölle zur Einschüchterung der Menschen abzubauen. Damit arbeitete Dante in seinem Werk ironischerweise der von ihm bekämpften Kirche in die Hände, die natürlich sehr daran interessiert war, daß die Hölle ihren negativen Nimbus behielt. Indem sie jeder Sünde eine bestimmte Höllenstrafe zuordnete und mit Fürbitten oder Totenmessen die Einflußnahme auf das jenseitige Geschehen regelte, steigerte sie natürlich auch ihre eigene Autorität. Man könnte sogar behaupten, daß sich das bis weit über die Romantik hinaus so fruchtbar entwickelnde Höllenszenarium, wo in unzähligen Hausbüchern über Größe, Zahl der Insassen sowie Eigenart der Folterkammern in der Hölle Klarheit herrschte, neben der durch die kirchlichen Drohungen gesteuerten Volksfrömmigkeit gerade auch Dantes Einfluß zuzuschreiben ist. Zeugnisse für die kirchlich tolerierte Unterstützung makabrer Phantasien finden sich bis ins 20. Jahrhundert, und die Nachwirkungen können bis zur aktuellen Gegenwart in Schülerbefragungen nachvollzogen werden. Selbst in der Neuzeit kämpfen reaktionäre Theologen gegen ein bloß metaphorisches Höllenverständnis. Und in den Dunstkreisen der Esoterik feiern die längst totgeglaubten und zu Grabe getragenen Engelwesen und Dämonen fröhlich Wiederauferstehung. Deshalb stellt sich hier die Frage: «Was ist die Hölle wirklich?» Und zwar hinter dem von der Kirche seit Jahrtausenden propagierten Bild eines glühenden Feuerofens. Für den rückwärts orientierten Menschen klingt die Wahrheit zynisch: «Sie ist der Himmel selbst!»
DAS LICHT DES INFERNOS
Die Finsternis und das Licht
Wenn wir die Hölle jenseits der apokalyptischen Vorstellung einer ewig brennenden Feuerlandschaft suchen, dann stellen wir fest, daß es sich bei den Sündern um Menschen handelt, die sich den von der Kirche aufgestellten christlichen Geboten widersetzt haben. Verboten aber wurde alles, was den kirchlichen Interessen widersprach. Und wenn wir aus heutiger Sicht weiter erkennen, daß die Gebote weniger dazu dienten, die Menschen in den Himmel zu führen, als sie politisch und kulturell zu kontrollieren und damit zu steuern, dann können wir auch sehen, daß die Hölle weniger ein Instrument der Sühne als vielmehr ein Instrument der Machtentfaltung war, die im Zuge der politischen Ausweitung von der Kirche zur Einschüchterung der Menschen und damit zum eigenen Machtmißbrauch mißbraucht worden ist. Damit hat die Kirche im Teufel ihren verdrängten Schatten nur deshalb heraufbeschworen, um ihren Kampf gegen das Böse zu legitimieren und damit das verdrängte Böse selbst auszuleben, indem sie durch die Verhinderung des scheinbar Bösen vermeintlich Gutes tat. Ergo wird auch klar, daß die Hölle die andere Seite des Himmels ist, also jener Teil, der im Schatten existieren muß, damit der andere sich weiter im Licht sonnen kann. Beide sind gleichermaßen dual und unvollständig und gehören dergestalt zu jenen Stufen menschlicher Entwicklung, die durch Erkenntnis und Bewußtseinserweiterung zu überwinden sind und erst durch Synthese zu einem die Triebnatur einbeziehenden sozialen Bewußtsein führen können. Wenn wir das wissen, erkennen wir plötzlich, daß Himmel und Hölle das Ego erhöhen und für die innere Sehnsucht nach Überwindung der gesellschaftlichen Enge und Beschränkung stehen. Der Unterschied liegt darin, ob sich diese Sinnsuche innerhalb der gesellschaftlichen Normen bewegt oder nicht, denn sowohl hinter der kontrollierten (Himmel) als auch der unkontrollierten Gier (Hölle) nach Sex, Besitz und Macht verbirgt sich nur die zu kompensierende Leere im Leben, denn beide Wege dienen dem Ego letztlich dazu, zu überleben und über die anderen hinauszuwachsen, um seinem Leben einen Sinn abzuringen. Der Unterschied ist wirklich nur der Standpunkt, von dem wir dieses Ziel betrachten, und die Suche nach Sinn der Weg in die Hölle oder ins Paradies. Ein Denker wie Meister Eckhart würde das heute so ausdrücken: «Der Weg in die Hölle ist mit Sinnsuche gepflastert.»
Die Hölle aus esoterischer Sicht
Die Suche nach Sinn ist der Weg in die Hölle, und das Finden des Un-Sinns die Rückkehr ins Paradies. Das Erkennen der Sinnlosigkeit der Sinnfrage wäre dann das «Fegefeuer», und die Erkenntnis, daß es keinen Sinn zu finden gibt und daß die Suche das sinnlose Ziel in sich selbst ist, entweder der «Himmel», wenn wir die Sinnlosigkeit der Sinnsuche erkennen (den Dämon der Sinnfrage), oder die «Hölle», wenn wir den Anlaß unserer Suche verdrängen. Wir ersehnen uns, was wir nicht haben, aber wir wollen es nur, weil es uns fehlt. Hätten wir es, würden wir gar nicht merken, daß wir es wollen, und suchten nach anderem, von dem wir glaubten, daß es uns fehlte. Wir suchen das Suchen, um das Finden zu verdrängen, denn würden wir finden, dann wären wir am Ziel. Doch ähnlich dem Alkoholiker, der zum Arzt geht und vorgibt, mit dem Trinken aufhören zu wollen, aber aus der Therapie aussteigt, sobald ihn der Arzt zum Alkoholentzug in die Klinik schicken will, sehen wir, daß beim Suchenden der Frust gerade dann ausbricht, wenn er zu finden beginnt. Und da wird uns klar: Es geht weder ums Finden noch um die Wahrheit. Sondern ums Suchen. Und solange wir die Hintergründe nicht sehen, warum wir suchen, was wir suchen, sind wir nicht viel klüger als der sprichwörtliche Narr, der den verlorenen Schlüssel unter einer Laterne sucht, weil es ihm dort, wo er ihn tatsächlich verloren hat, zu dunkel ist. Wir suchen im Reich der Ideale, wo man etwas sieht, weil alles hell und klar ist – doch wie sollten wir da finden, was in der Dunkelheit verborgen ist?
Solange wir uns scheuen, im Dickicht der Gefühle und in den Tiefen unserer seelischen Niederungen zu suchen, dort, wo wir ihn verloren haben, solange finden wir den Schlüssel kaum. Möglicherweise finden wir unter der Laterne dafür das Paradies, das uns suggeriert, solange wir immer nur im Licht suchten, solange bräuchten wir auch den Schlüssel nicht. Tatsache ist: Nur aus der Position des Suchens kann ich das Finden manipulieren, nur dort kann ich es mit all meinen Sehnsüchten vollstopfen, die mir meine Masken einreden, und damit schon am Anfang die Wahrheit verdrängen, die für die Masken den Tod bedeuteten: daß nämlich diese Form der Suche schon wieder eine Lüge ist, hinter der sich keine Wahrheiten, sondern nur die Gaukelbilder dämonischer Sehnsüchte verbergen, die mich niemals mehr aus den Netzen ihrer Verstrickungen entlassen. Das aber ist gerade die Hölle, die uns bedroht, weil sie uns den Abstieg zu unseren eigenen Ängsten verwehrt. Denn die erlittenen Wunden und Verletzungen heilen nur durch das Erkennen der seelischen Zusammenhänge, und erst die geistige Einsicht katapultiert unseren Geist ins Licht. Denn, wie sagte ein alter Suchender, nachdem er Gott zeit seines Lebens vergeblich im Himmel suchte und ihn endlich am Ende seiner Tage an der Eingangspforte zur Hölle fand: «Ein ganzes Leben lang war ich auf der Suche nach Gott, und als ich ihn am Ende meiner Tage fand und ihm in die Augen blickte, entdeckte ich, daß er es war, der mich suchte.» (Bajezid Bastami)
DANTES WERK AUS MEINER PERSÖNLICHEN SICHT
Dantes Vorlage als apokryphes Modell
Kehren wir zu Dante zurück. Kaum einer hat wie er das gesamte Weltbild seiner Zeit in sich aufgenommen und es zu einem monumentalen Gebäude unvergänglicher Lettern vor der Geschichte aufgetürmt, keiner hat wie er das geschichtliche Geschehen seiner Zeit aktiv und passiv miterlebt, in seiner ganzen Tiefe durchlitten und es in ein glühendes Versmaß gestellt, das jahrhundertelang die Vorstellungen der Menschen bis an die Schwelle der Neuzeit prägte. An seiner Dichtung mißt sich die sprachliche Gestaltungskraft von Himmel und Hölle. Verglichen mit seinem Werk kann mein Bemühen natürlich nur der schwache Abglanz eines kreativen Zusammenmischens alten Weins in neuen Schläuchen sein. Um diesem Bemühen aber trotzdem einen kollektiven Sinn zu sichern, mußte ich mich dort, wo Dante in vierzehntausend Versen die ganze Schöpfung durchmaß, nach einem System umsehen, das mir Dantes komplettes Weltbild durch eine innere Struktur ersetzte, die es mir erlaubte, die verschiedenen Episoden wie die Perlen auf einer Gebetsschnur nebeneinander aufreihen zu können. Dafür erkor ich mir das astrologische Modell. Der Preis ist klar. Statt der großen Menschheitsbühne, der menschlichen Entwicklungsgalerie, auf der Dante sein monströses, sinnvolles und sinngebendes Opus vom Leben des «Homo sapiens» vollzieht, kann ich nur ein abstraktes Modell anbieten, das über die systemartigen Verknüpfungen in Zusammenhang mit meinen astrologischen Kenntnissen und Erfahrungen im besten Fall auf den Ansatz seelischer Vertiefungen in einem psychologischen Umfeld hinweist.
Trotzdem gab es keine bessere Lösung, weil ein Buch in Dantes epochalen Dimensionen einfach nicht anders möglich war. Deshalb war für mich das Ausweichen auf ein strukturierendes Modell ein letztlich doch befriedigender, weil unausweichlicher Kompromiß, und die Hinwendung an die Astrologie innerhalb ähnlicher Modelle für mich aufgrund meines Erfahrungspotentials interessant. Außerdem schien mir dieses System besonders geeignet zu sein, da es mir erlaubt, jede der Höllen mit einem astrologischen Inventar auszukleiden und mit den astrologischen Konfigurationen meiner LeserInnen in Verbindung zu bringen, die sich in der einen oder anderen Geschichte wiederfinden können.
Manche mögen es auch als eine Anmaßung empfinden, das vorliegende Buch Dante als eine esoterische Paraphrase zu unterstellen und es mit seinem Werk in Beziehung zu bringen. Ich kann sie verstehen. Wenn ich es nach reiflichem Überlegen trotzdem wage, meine Schilderungen im weitesten Sinne an Dantes «Inferno» anzulehnen, dann weniger in kulturpolitischer als mehr in persönlicher Weise. So wie der Dichter sich dem Höchsten in voller Selbsthingabe näherte, um sich im nächsten Augenblick mit den Widersprüchen christlicher Dogmen auseinanderzusetzen, oder wie er seiner großen Liebe Beatrice in der Jenseitswelt genauso wie im Leben verfiel, wobei er sie aber statt als erlösenden Engel bei ihrer Begegnung als unnahbare Madonna mit den moralischen Schuldzuweisungen theologischer Lehren im Mund charakterisierte, erkennen wir in ihm auch eine gebrochene, rückwärtsorientierte Gestalt. Diese kehrt nicht als Handelnde, sondern als Gehandelt-Werdende an den Schauplatz ihrer Erinnerungen zurück, um aus der psychotherapeutischen Sicht des Schauens die eigene Seelenlandschaft aufzuräumen. An diese nicht unwidersprüchliche, aber menschlich-ringende und letztlich sich selbst überwindende Seite von Dantes Wirken wollte ich mein persönliches «Inferno» herantragen: an das rückwärtsgerichtete Hinabsteigen in den dunklen Schacht, diesen abgespaltenen Teil der Seele, dessen schlummernde Erinnerungen erwachen und in visionären Träumen ins Bewußtsein eindringen, um es um diesen unerkannten Teil erweitern zu können.
Dantes Wurzeln
Wir können Dante Alighieri aber nicht verstehen, ohne uns nicht auch seinen Vorbildern zuzuwenden, den Grundlagen, auf denen er sein Werk aufbaut. Vor ihm ist in ähnlichem Sinne Vergils «Aeneis» entstanden, ein Werk, das sich an Homers «Ilias» anlehnt und seinen Schöpfer ebenfalls in die Unterwelt führt. Doch wo der antike Dichter als Person bescheiden im Hintergrund verbleibt und im Epos selbst nicht erscheint, manifestiert sich Dante selbst als der eigentliche Held seiner Geschichte, und damit bekommt die Kulturwelt ihren ersten menschlichen Sänger, der die ungeheuer gehäuften Handlungen der Menschen und ihre verstrickenden Beziehungen untereinander in sich hineinnimmt, in einem gewaltigen Epos zusammenrafft und wieder aus sich herauswirft. Diese selbstbezogene Dramatisierung ist Dantes spontane Fortsetzung griechischer Dichtung: die antike Vorlage aus persönlicher Sicht. Denn Dante ist «Wanderer» und «Weg». Er ist sein eigener Hauptdarsteller, und unter seiner Regie löst er sich aus der dramaturgischen Vorlage und gewinnt durch seine visionäre Präsenz die poetische Kraft, die selbst monströsestes Leiden virtuos und differenziert in Sprache packt. Die ganze menschliche Schöpfungsflamme steigt aus ihm empor, und im unerschöpflichen Ringen zwischen bewußtem Formulieren und unbewußtem Dahingetragenwerden entsteht hier allmählich ein Bewußtsein von Erkenntnis und göttlicher Besinnung, das sich durch die Höllen der Einsicht zu immer tieferem Erkennen vortastet. Es ist dies das Vermögen, in den menschlichen Abgründen die gesellschaftlichen Zusammenhänge zu sehen und sich damit über die kollektiven Muster und Verhaltensweisen hinwegzuheben. Es ist, als habe der unbewußte Dante hier Regie geführt, wenn er von seiner riesigen Gedankenfülle nicht erschlagen, sondern unter der kundigen Obhut seines Seelenbegleiters Vergil zur inneren Offenbarung und schließlich zu seinem eigentlichen Höheren Selbst getragen wird.
Dantes anderes Selbst
«Seelenbegleiter? Höheres Selbst?! Was für abgehobene Sichtweisen …», mögen sich die LeserInnen denken. Doch erinnern wir uns: Es ist dieses Ringen um das Höchste aus der Perspektive des kleinen, eigensinnigen Ich, dieses Vermischen von Persönlichem und Universalem, Emotionalem und Klerikalem, das Dantes Sicht diese epochale Bedeutung zuteil werden ließ, das den Künstler und Gelehrten neben seinem monumentalen Werk auch emotional und dadurch menschlich erscheinen läßt. Doch wie sollte Dantes kleines Ich die Unvergänglichkeit seines Werkes mit Atem füllen? Wie sollte das Numinose nicht das begrenzte Vorstellungsvermögen des Dichters sprengen? Dazu bedurfte es eines Größeren, denn Visionen dieses Ausmaßes stellen sich nicht ganz ohne unbewußten Beistand ein. Dante brauchte noch ein höheres Wesen, ein Medium, einen Brückenpfeiler zwischen den Welten, denn nicht nur die Reise scheint ein tiefer Abstieg in seelische Abgründe, sondern die Hölle selbst erscheint als eine im Vorgriff aufgerissene Seele. Wir können davon ausgehen, daß Dante genau spürte, daß die visionäre Verdichtung seiner Imaginationen auch aus Teilen seines Unbewußten strömte und er sich in seinen Gesichtern verstrickt hätte, wenn er sie in der Seele nicht hätte ausbrüten können. Deshalb bemühte er sich um einen mentalen Beschützer: Vergil, den er geistig ins Bild brachte und den er als seine eigene Schöpfung in visionärer Leibhaftigkeit durch die Jenseitswelt imaginierte. Die Wahl von Vergil lag – wie gesehen – auf der Hand: Vergil war wie Dante Dichter und begegnete in seinem Werk den Geistern der Abgeschiedenen in einer seelischen Rückschau. Außerdem ist er erdennah: Ähnlich wie Dante mit seiner Fiktion eines Gottesreiches auf Erden strebte er nach der aktiven Gestaltung des materiellen Bereichs durch die politische und visionäre Schöpfung des Römerreichs.
Der magische Pakt mit dem Seelenführer
Damit hatte Dante, wahrscheinlich ohne es zu wissen, den entscheidenden magischen Griff getan. Durch die Einbeziehung Vergils als seelischen Begleiter hatte er sich unbemerkt den Geist der Antike zum Verbündeten gemacht, als deren Vollender er sich sah, genauso wie ich mir durch die Einbeziehung von Akron den Geist des Unbewußten zu verpflichten suchte. Genauso, wie nur Dantes überbewußtem inneren Dialog zwischen Schüler und Lehrer ein so tiefes Eindringen in die seelischen Abgründe gelingen konnte, vermag nur ein widersprüchlicher, in sich gespaltener, seine eigenen Spaltungen reflektierender und die Reflexionen gleichzeitig wieder verarbeitender Geist wie Akron mich durch die Sümpfe unverarbeiteter Seelenschlacken und Geröllhalden unbewußter Gedankenmuster hindurchzuschleusen. Nur ein Geist, der seinem Scheitern ins Auge blicken kann und erst dadurch zu seiner wahren inneren Größe findet, indem er sich in seinen Banalitäten, in seiner Unwichtigkeit und der Relativität seines Erkennens überhaupt erkennt, hat wohl die Kühnheit, mich an ein Werk heranzuführen, das die Hölle nicht einfach nur beschreiben möchte, sondern gewissermaßen dantesk in den Geist der Unterwelt eindringen will. Deshalb fühle ich mich dem «Magier» Dante noch mehr als dem kulturhistorischen Gipfel seines Werks verpflichtet, auch wenn ich die Hölle im Gegensatz zu Dante nicht in der äußeren Welt erblicke, sondern als seelischen Raum empfinde, den ich durch meine inneren Bilder bereisen kann. Ich habe mir deshalb auch als Führer keine historische Figur, sondern ein Energiefeld in meinem Kopf erkürt, mit dem ich korrespondieren kann und das mich durch meine inneren Abgründe führt. Warum?
Das Denken ist dual, und die Dualität trennt, weil das ihre Natur ist. Wenn ich also irrational denke, dann erscheint mein Verstandeszensor und pfeift mich zurück. Die Wahrheit jedoch ist mehrdimensional und hat viele Gesichter. Denken und Sprache umschreiben zwar einzelne Teile, doch Wahrheit umfaßt alle Teile eines Ganzen und ist daher der Ratio nicht einsichtig. Deshalb bedarf ich zur Erfahrung des Unbewußten einer imaginierten Gestalt, die meine Seele begleitet und mir die irrationalen Erlebnisse filtert und reflektiert, und mein inneres Bild von Akron entspricht genau dieser Vorgabe. Er ist eine seelische Vertiefung, ein unfaßbarer Abgrund, der Unvorstellbares auf der Ebene des Verstehens in Bildern ausdrücken kann, ohne der Verstandeszensur verpflichtet zu sein. Wenn es mir emotional gelingt, mich ihm anzuvertrauen, also ein persönliches Vertrauen zu einer Kraft zu entwickeln, die jenseits meiner Verstandeskontrolle liegt, dann kann ich durch sie wie mit einer Tiefseeglocke in die seelischen Abgründe jenseits von Raum und Zeit eintauchen und mich im gelassenen Vertrauen auf meine künftige Auferstehung angstfrei dort unten bewegen. Denn ich weiß: Weder ich noch mein Seelenführer sind das Ganze: Er stützt mich, und ich manifestiere ihn. Die Realität, die ich im Bewußtsein zurücklasse, verschwindet, und die Zeit bleibt in dieser Subjektivität der Seele stehen – bis ich wieder in den Körper und den Intellekt zurückkehre und das erlebte Unfaßbare auf dieser Seite des Erlebens aus mir herausschaufeln kann.
Akron – der andere Seelenspiegel
«Wer aber ist Akron?» wird sich mancher wohl am Ende dieses Vorworts fragen. Um die Wahrheit zu sagen: Ich weiß es nicht. Oder genauer gesagt: Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mir über diese Frage aber auch schon Gedanken gemacht. Deshalb habe ich hier zwei mögliche Antworten vorbereitet, die aus ihren polaren Sichtweisen in einem übergeordneten Sinn wahrscheinlich das gleiche ausdrücken. Zuerst die esoterische:
Vor mehr als fünfzehn Jahren hatte ich nicht nur das Glück, meinem inneren Seelenführer und Geisteslehrer Akron zu begegnen, sondern ich hatte auch die Chance, in den Prozeß der Übermittlung seiner inneren Botschaften einbezogen zu werden und mich auf der inneren und äußeren Ebene gleichzeitig zu reflektieren. D.h., mir blieben nicht nur die Teile meines Bewußtseins offen, auf der mir seine inneren Botschaften zuflossen, sondern mir erschloß sich auch die Perspektive, aus der ich den Mechanismus dieser Übermittlungen beobachten konnte, und so konnte ich erkennen, wie diese Übermittlungen dank ihrer raffinierten symbolischen Verschlüsselungen meine «kritische Vernunft» umschifften. Dadurch, daß ich mir das Denken zum Verbündeten gewann, das sich mir in der Verkörperung von Akron bis zu den Grundlagen seiner eigenen Relativität offenbarte, konnte ich den Strukturen des Denkens außerhalb meiner eigenen Denkmuster begegnen und damit die «Botschaften aus dem Universum» relativieren, ohne ihnen aber ihr inneres Geheimnis zu stehlen.
Und nun die pragmatische Antwort:
Das, was ich hier im Buch als meinen Geistesführer bezeichne, ist ein Energieimpuls in meinem Hirn. Es ist die Zusammenfassung der Muster, wie sich das kollektive Wissen in meinem persönlichen Erleben reflektiert. Dieser Teil kann genauso eine höhere Wesenheit sein wie ein abgespaltener Teil in mir, vielleicht mein eigener geistiger Machtanspruch, der mir in dieser ausgelagerten Form viel besser behagt, weil ich mich mit ihm in dieser personifizierten Gestalt nicht restlos zu identifizieren brauche. Im Grunde interessieren mich aber alle Fragen nach Akron auch nur insofern, als daß der innere Dialog funktioniert und daraus etwas Kreatives entsteht.
Sollte mich also heute jemand fragen, ob ich ein «Kanal» für höhere Intelligenzen sei, dann würde ich das aus meiner Sichtweise wahrscheinlich eher verneinen, denn die transpersönliche Erscheinung von Akron scheint mir doch mehr der Odem zu sein, um den von meinem eigenen Selbstbild unterdrückten geistigen Teilen Leben einzuhauchen. Andererseits möchte ich auch nichts ausschließen, da meine persönlichen Ansichten meiner «kritischen Vernunft» genauso unterliegen wie meine überpersönlichen Botschaften meiner «unterdrückten kreativen Irrationalität», und manchmal scheint mir, daß das eine das andere bedinge und erst im gelassenen Zusammenspiel dieser beiden verschiedenen Bewußtseinsebenen sich etwas manifestieren könne, das sich mit den Worten Akrons als «erkennendes Erkennen in meinem Kopf» dann so ausdrückt: «Ich bin der Träumer und der Traum, das Bewußte und das Unbewußte. Ich bin der Zauberer, dessen Zauber die Sphäre des Bewußtseins schafft: Ich bin in allem – alles ist in mir!»
St. Gallen im Februar 2000
Charles F. Frey
(erste Fassung im Mai 1997)