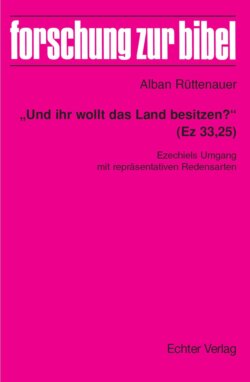Читать книгу "Und ihr wollt das Land besitzen?" (Ez 33,25) - Alban Rüttenauer - Страница 18
a) Nicht-Sehen als Folge.
ОглавлениеDie Beispiele für das Nicht-Sehen lassen erkennen wie der Prophet die Bedingungen für das natürliche Sehen auffaßt. Die Behinderungen des Sehens, die bis zum völligen Nichtsehen führen, können von äußerer Art sein, wie das Verdecken des Gesichtes oder die räumliche Entfernung, oder, wie im zuletzt aufgeführten Beispiel, an der geistigen Einstellung liegen.
Das in der Redewendung in Ez 8,12 voreilig angenommene NichtSehen Gottes hat seine unmittelbare Entsprechung in einem menschlichen Nicht-Sehen, von dem das 12. Kap. spricht. Wenn nämlich in Ez 12,6 der Prophet aufgefordert wird, in einer Symbolhandlung die zweite Deportation vorwegzunehmen, soll er zugleich das Gesicht verhüllen, damit er das Land nicht sieht. Damit entsteht eine ähnliche Verbindung zwischen „Nicht-Sehen“ und „Land“, wie in Ez 8,12. In 12,6 ist das Land direktes Objekt des NichtSehens, während in 8,12 das Nicht-Sehen Gottes die Menschen, die Sprecher, zum Objekt hat. Aber noch durch ein weiteres Stichwort ist 12,6 mit 8,12 verbunden. „In Finsternis“ soll der Prophet (und entsprechend der Fürst in 12,12) ausziehen. Das erinnert an das Treiben der Ältesten in der Dunkelheit und den geheimen Kammern in 8,12. Die Wortwahl ist freilich eine andere, - „in der Dunkelheit“ in 8,12, - „im Finstern“ in 12,6. Vielleicht soll damit die größere Unfreiwilligkeit der „Dunkelheit“ neben der selbstgesuchten in 8,12 hervorgehoben werden. Außerhalb des Ezechielbuches taucht - „und Finsternis“ nur noch in Gen 15,17 auf, bei der durch ein Opfer beschworenen Landverheißung. Liegt ein bewußtes Aufgreifen des Ausdrucks vor, dann erscheint es fast wie ein zynischer Vergleich zwischen Landverheißung und Deportation aus dem Land. Abraham wird sonst im Ezechielbuch nur in 33,24 innerhalb einer anderen Redensart erwähnt, durch die die Jerusalemer die Abrahamsverheißung für ihre eigenen privaten Ansprüche geltend machen. 12,6 könnte dann wie eine vorweggenommene Wiederlegung dieser Redensart verstanden werden.
Jüdischen Auslegern des Mittelalters war das Nichtsehen in Ez 12,6 Ausdruck von Scham.101 Greenberg erwägt auch die Möglichkeit, daß damit ein Nicht-Wieder-Sehen-Können des Landes, also die Endgültigkeit des Exils für den König ausgedrückt wurde.102 Welcher von diesen Interpretationsmöglichkeiten man auch immer den Vorzug geben möchte, unabhängig davon ist der Rückbezug zu Kap. 8, der in Kap. 12 das Nicht-sehen als eine Umkehrung der Verhältnisse erscheinen läßt. Diejenigen, die Gott ein NichtSehen wegen Abwesenheit im Land vorhalten, werden selber das Land nicht sehen (oder nicht wieder sehen können) und es verlassen müssen, mag für das Sehen nun Scham (jüdische mittelalterliche Ausleger) oder Trauer (Zimmerli) oder etwas anderes die Ursache sein. Auch das zeigt schon, wie wichtig das Sehen für den Propheten ist, daß es überhaupt ein eigener Bestandteil einer symbolischen Handlung ist.
Von einer Vernachlässigung des rechten Sehens ist in 13,3 bei der Kritik der falschen Propheten die Rede. Von ihnen gilt, sie sind Propheten, - „die ihrem eigenen Geist hinter her gehen und haben dabei nicht gesehen.“ Bei Propheten möchte man bei „Sehen“ am ehesten an Empfang von Visionen denken. Ezechiel hat aber wahrscheinlich ganz bewußt nicht die dafür zutreffende Wurzel genommen, sondern eben die andere , um so die anthropologische Komponente stärker zur Geltung zu bringen. Als Voraussetzung für das NichtSehen aufgefaßt, hätte das dem eigenen Geist Nachgehen die Folge, daß die Wahrnehmungsfähigkeit für Dinge, die über den eigenen Geist hinausgehen, entsprechend behindert wird. Insofern kein äußeres unabwendbares Hindernis vorliegt, ist diese Art des Nicht-Sehens zu einem großen Teil selbstverschuldet.