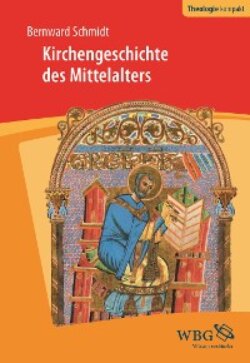Читать книгу Kirchengeschichte des Mittelalters - Bernward Schmidt - Страница 10
2. Kaisertum
ОглавлениеDem antiken Kaisertum kam stets eine besondere Verantwortung für die Religionsausübung zu, die sich seit Konstantin auf die christliche Kirche übertrug. Doch musste sich im Lauf des 4. Jahrhunderts auch die Position des Kaisers in der Kirche klären. Konstantin hatte sich noch als „Bischof für die äußeren Angelegenheiten“ der Kirche (ἐπίσκοπος τῶν ἐκτóς) verstanden und dies nicht zuletzt darin zum Ausdruck gebracht, dass er die Rahmenbedingungen für die Entscheidung dogmatischer und kirchenorganisatorischer Streitfragen schuf, die dann auf Versammlungen von Bischöfen (Synoden) in Angriff genommen wurden; am Konzil von Nizäa (325) nahm Konstantin sogar aktiv teil. Die Bischöfe wurden durch die religionspolitische Wende des 4. Jahrhunderts zu Personen von öffentlichem Rang und mit zivilrechtlichen Funktionen. Die Etablierung des Christentums als Staatsreligion (380) und das vollständige Verbot heidnischer Kulte (391/92) lagen zwar im Interesse christlicher Bischöfe, ließen nun aber die Frage nach dem Status des Kaisers in der Kirche drängender werden.
Kaiser als Laie
Die Auseinandersetzungen, die Ambrosius, Bischof in der kaiserlichen Residenzstadt Mailand, mit den Kaisern seiner Zeit führte, gewannen vor diesem Hintergrund grundsätzliche Bedeutung. Ambrosius sah den Kaiser innerhalb der Kirche als Laien ohne besondere Vorrechte, der notfalls vom Bischof auch zu einer Kirchenbuße verurteilt werden konnte. Indem Theodosius eine solche Kirchenbuße tatsächlich auf sich nahm, akzeptierte er seine von Ambrosius zugewiesene Rolle als Laie in der Kirche. Zugleich rückte der Bischof in eine Position, in der er nicht nur Seelsorger des Kaisers war, sondern aktiv in die (Religions-)Politik eingriff und ihr Richtlinien vorgab. Aufgabe des Kaisers war es in dieser Sichtweise, seine Macht zur Durchsetzung der christlichen Wahrheit einzusetzen.
Teilung des Römischen Reiches
Nach dem Tod des Theodosius (395) wurde das Römische Reich endgültig in zwei Herrschaftsbereiche geteilt, wobei man ideell an der Einheit des Reiches festhielt. Dies hatte zur Folge, dass der Ostteil des Reiches wirtschaftlich, politisch und militärisch deutlich potenter und gefestigter dastand als der Westen. So entstanden im Osten unter Theodosius II. (408–450) und Justinian (527–565) die für das Mittelalter und die Neuzeit äußerst einflussreichen Kodifikationen des antiken Rechts, insbesondere im Corpus Iuris Civilis. Von der kulturellen Blüte des oströmischen Reichs am Ausgang der Antike zeugen heute noch die Kirchenbauten in Ravenna, das noch im Mittelalter als Exarchat zum oströmischen Reich gehörte.
Stichwort
Exarchat
Ravenna war ab dem 6. Jh. Dienstsitz eines oströmischen Präfekten, der die zivile Verwaltung Italiens leitete und militärische Befehlsgewalt ausübte. Seit der weitgehenden Eroberung Nord- und Mittelitaliens durch die Langobarden war sein Machtbereich weitgehend auf Ravenna beschränkt, als Stellvertreter des Kaisers hatte er dennoch das Recht zur Bestätigung der Papstwahl. Sein Titel patricius (Schutzherr) wurde 751 vom Papst auf den fränkischen König übertragen.