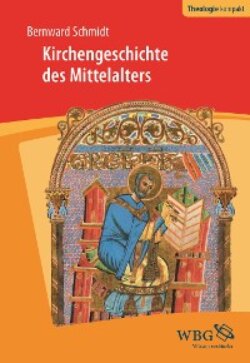Читать книгу Kirchengeschichte des Mittelalters - Bernward Schmidt - Страница 7
Das Mittelalter und das Mittelalterliche – eine Einführung
ОглавлениеEine historische Epoche „Mittelalter“ zu nennen, scheint auf den ersten Blick nicht allzu einfallsreich – aber mit dem Begriff ist doch mehr über diese Zeit ausgesagt, die wir der Einfachheit halber von ungefähr 500 bis ungefähr 1500 reichen lassen. Denn in einem gewissen Sinn haben mittelalterliche Denker ihre Lebenszeit aber selbst als media aetas (mittleres Zeitalter) verstanden, als die Zeit nämlich zwischen dem Wirken Jesu auf der Erde und seiner Wiederkunft zum Endgericht. Die Ausrichtung auf das persönliche wie auf das universale Endgericht ist ein wesentlicher Aspekt mittelalterlicher Frömmigkeit.
Periodisierung
Dennoch führte nicht ein solches geschichtstheologisches Verständnis zur aktuellen Einteilung der Geschichte in Epochen, sondern eher die Mittelalter-Begriffe von Humanisten und Reformatoren. Als erster grenzte der Hallenser Historiker Christoph Cellarius (1638–1707) eine Geschichte des Mittelalters von Antike und Neuzeit ab. Das Mittelalter reichte bei ihm vom römischen Kaiser Konstantin (reg. 312–337) bis zur Eroberung Konstantinopels durch die Türken 1453. Die moderne Geschichtsschreibung zieht Epochengrenzen weniger scharf, geht eher von Übergangsepochen aus und benennt Bündel von Faktoren für einen fundamentalen Wandel.
| Ende der Antike – Beginn des Mittelalters | |
| 375 | Vordringen der Hunnen als Beginn der „Völkerwanderung“ |
| 380 | Christentum wird Staatsreligion im römischen Reich |
| 476 | Ende des weströmischen Kaisertums |
| 498 | Taufe des Frankenkönigs Chlodwig |
| 529 | Gründung des Klosters Monte Cassino |
| 604 | Tod Papst Gregors I. des Großen |
| 622 | Hedschra, der Auszug Mohammeds von Mekka nach Medina |
| Ende des Mittelalters – Beginn der Neuzeit | |
| 1453 | Eroberung Konstantinopels durch die Türken und Ende des oströmischen Reichs |
| um 1450 | Erfindung des Buchdrucks |
| 1492 | Entdeckung Amerikas |
| 1517 | Beginn der Reformation |
| 1789 | Französische Revolution (Ende der Ständegesellschaft) |
| 1806 | Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation |
Abhängig von der jeweiligen Perspektive können so ganz unterschiedliche Abgrenzungen des Mittelalters vorgenommen werden – bis hin zur verfassungsgeschichtlichen Perspektive, in der das mittelalterliche König- und Kaisertum in Frankreich und Deutschland erst durch die Französische Revolution und ihre Folgen unterging. Ein einzelnes Ereignis reicht jedoch niemals aus, um einen Epochenwechsel zu konstatieren. Aus eher pragmatischen Gründen hat sich jedoch die zeitliche Definition des Mittelalters als Zeitraum von ungefähr 500 bis ungefähr 1500 etabliert. Diese 1000 Jahre werden üblicherweise in Früh-, Hoch- und Spätmittelalter eingeteilt, wobei die Grenzen ebenfalls je nach Fragestellung und Akzentsetzung variieren. Das Frühmittelalter wird insbesondere als Phase des Übergangs von der antiken Reichskirche zu den sich neu bildenden und festigenden Formen im Reich der Karolinger verstanden (bis ins frühe 10. Jahrhundert). Das Hochmittelalter als Zeitraum vom 10. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts als eine Phase stetiger Prozesse von Reform der Kirche, der allmählichen Etablierung und Verfeinerung kirchlicher Strukturen und fundamentaler intellektueller Auseinandersetzungen um das Christentum steht im Zentrum der Darstellung. Als Spätmittelalter gilt hier der Zeitraum von der Mitte des 13. bis zum frühen 16. Jahrhundert, eine Epoche der Krisenerfahrungen auf den Ebenen der obersten Kirchenleitung, der Frömmigkeit und der akademischen Theologie.
Das fremde Mittelalter
In der Neuzeit bezeichnete „Mittelalter“ häufig etwas Fremdes. Sowohl die humanistischen Philologen des 15./16. Jahrhunderts als auch die Reformatoren sahen das Mittelalter als eine Verfallszeit zwischen dem Höhepunkt von Sprache oder Christentum in der Antike an. „Finster“ wurde das Mittelalter im Licht der Aufklärung und es wurde der pauschale Vorwurf erhoben, Aberglaube und religiöse Vorurteile hätten zu äußerer und innerer Unfreiheit, Fanatismus und der Verfolgung Andersdenkender geführt. Die Romantiker des 19. Jahrhunderts stilisierten die fremde Welt des Mittelalters zu einer Art „goldenem Zeitalter“ und benutzten sie so als eine Gegenwelt zu ihrer eigenen Gegenwart. Eine andere Mittelalter-Glorifizierung findet sich bei Größen des Nationalsozialismus bzw. in von der NS-Ideologie beeinflussten Geschichtsschreibung: Hier meinte man im Mittelalter die Wurzeln des „Deutschen“ in Reinform zu finden. In unserer Gegenwart schließlich scheinen Mittelalterund Fantasy-Bilder oft genug ineinander zu fließen – womit das Mittelalter wahlweise Bilder des Unaufgeklärt-Rückständigen oder des freizeittauglichen Staunens und Gruselns zu liefern hat.
Religiöse Prägung der Welt
Charakteristisch für die Welt des Mittelalters ist ihre konsequente Prägung in allen Bereichen. Der Raum wurde in Einheiten gemessen, die auf den Menschen – Gottes Ebenbild – bezogen waren: Elle, Fuß, Schritt, Tagesreise. Darstellungen der Erde erfüllten keinen kartographischen Zweck, sondern sollten die Ordnung der Schöpfung vor Augen führen. Die eigene Lebenszeit wurde in die Heilsgeschichte eingeordnet und war auf das Gericht am Ende aller Zeit hingeordnet. Schließlich war jeder Mensch in die ständische Gesellschaft eingeordnet, die sich – einer klassischen Formulierung des Adalbero von Laon (um 947–1030) zufolge – in betenden Klerus, schützende Krieger und arbeitende Bauern und Handwerker einteilte (oratores, bellatores und laboratores). Der Klerus trug die Verantwortung für das Heil aller Menschen, die Krieger für ihren Schutz, und beide sollten von den Bauern ernährt werden, die dafür Anspruch auf Schutz und Seelsorge geltend machen konnten. Diese Ordnung war in den Rahmen des christlichen Glaubens gestellt und von Gott so gewollt, ihre Störung führte zu gravierenden Krisen, war gar Beleidigung Gottes. Was für die heutige historische Untersuchung also besonders spannend ist, war für die Menschen des Mittelalters Anlass zu ernster Sorge um das eigene Heil. Doch das Gericht am Ende der menschlichen Zeit gab auch und nicht zuletzt Grund zur Hoffnung, dass Gott für alle Mühsal und Plage eines irdischen Lebens reichlich entschädigen würde.