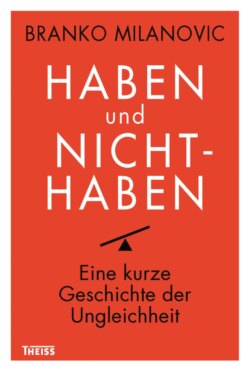Читать книгу Haben und Nichthaben - Branko Milanovic - Страница 12
Skizze 1.4 Wie groß war die Ungleichheit
im Römischen Reich?
ОглавлениеEs gibt eine unausgesprochene Theorie der Einkommensungleichheit in vorindustrieller Zeit. Die für die Erforschung der Ungleichheit grundlegende Kuznets-Hypothese (siehe Essay I und Skizze 1.10) besagt, dass man, wenn man die Entwicklung der Ungleichheit von einer Agrargesellschaft zur „modernen“ Industriegesellschaft graphisch darstellt, eine Kurve erhält, deren Verlauf dem eines umgedrehten U entspricht. Die Ungleichheit nimmt demnach nur zu, wenn eine Gesellschaft einen langwierigen Modernisierungsprozess durchläuft, was bedeutet, dass die Ungleichheit in vorindustriellen Gesellschaften – einschließlich der hoch entwickelten wie der römischen – gering sein sollte. Aber wir haben uns ein anderes Bild von den vorindustriellen Gesellschaften gemacht: Wir sehen Gesellschaften, in denen tiefstes Elend an der Basis der Gesellschaft mit ungeheurem Reichtum an der Spitze einherging. Besteht die Möglichkeit, dass beide Vorstellungen richtig sind? Wie wir im Folgenden sehen werden, ist es tatsächlich so, und dies ist eines der Schlüsselmerkmale, welche die Ungleichheit in vormoderner Zeit von der Ungleichheit in moderner Zeit unterscheidet.
Beginnen wir mit einer groben Darstellung der Sozialstruktur des frühen römischen Kaiserreiches. Gemeint sind die ersten beiden Jahrhunderte der christlichen Zeit, das heißt etwa vom Machtantritt Oktavians (des späteren Augustus) im Jahr 31 n. Chr. bis zur Herrschaft der „fünf guten Kaiser“, die mit dem Machtantritt des Commodus (des Sohns von Marcus Aurelius) im Jahr 180 beginnt. In dieser Phase beginnt auch der von Gibbon in seinem berühmten Werk beschriebene „Niedergang“ Roms.
An der Spitze des Staates stand im frühen Kaiserreich selbstverständlich der Kaiser – und zwar sowohl politisch als auch finanziell. Wie reich war der Kaiser, genauer gesagt: Wie reich war seine Familie? Das jährliche Einkommen des Haushalts von Augustus wird auf 15 Millionen Sesterzen geschätzt, was etwa 0,08 Prozent des Gesamteinkommens des Reichs entsprach (in dem zu jener Zeit zwischen 50 und 55 Millionen Menschen lebten).47 Das entspricht etwa dem Achtfachen des Einkommensanteils des englischen Königs Georg III. zu Beginn des 19. Jahrhunderts.48 (Georg III. war zufällig auch der König in der Zeit, in der Stolz und Vorurteil spielt; siehe Skizze 1.1.) Die posthumen Schenkungen von Augustus an das Volk, die aus privaten und öffentlichen Mitteln bezahlt wurden, bezifferte Tacitus auf 43,5 Millionen Sesterzen,49 das heißt etwa 0,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Reiches. Das ist etwa so, als hätte George W. Bush am Ende seiner Amtszeit 30 Milliarden Dollar aus seinem Privatvermögen gespendet, um sie unter den amerikanischen Bürgern zu verteilen.
Augustus’ Großzügigkeit war keineswegs einzigartig. Im Jahr 33 spendete sein Nachfolger Tiberius etwa 0,5 Prozent des BIP (gemessen am heutigen Einkommen der USA entspricht das 75 Milliarden Dollar), um eine Liquiditätskrise der Banken zu bewältigen – ganz ähnlich wie es das amerikanische Finanzministerium im Jahr 2009 gemeinsam mit der Federal Reserve tat. Die Schilderung von Tacitus wirkt verblüffend modern, wenn man davon absieht, dass hier nicht der Staat, sondern eine einzelne Person die Rettungsgelder zur Verfügung stellt:
Das aber, was man als Auskunftsmittel ergriffen hatte, Verkauf und Kauf, nahm eine entgegengesetzte Wendung, weil die Kapitalisten alles Geld zum Erhandeln von Ländereien zurückgelegt hatten. Da die vielfache Aufforderung zum Verkaufe Wohlfeilheit zur Folge hatte, so musste ein jeder, je verschuldeter er war, nur desto schlechter bei der Veräußerung fahren, und viele kamen ganz zum Falle; die Zerrüttung des Vermögens aber brachte auch um Ansehen und Ruf, bis der Cäsar Hilfe schaffte, indem er hundert Millionen Sesterze an die Wechselbänke verteilte und davon auf drei Jahre ohne Zinsen Darlehn zu nehmen erlaubte, wenn der Schuldner dem Volke für das Doppelte in Grundstücken Sicherheit leistete. So ward der Kredit wiederhergestellt, und es fanden sich allmählich auch wieder Privatleute als Gläubiger.50
Im Jahr 36 verteilte Tiberius genauso viel Geld, um die Bevölkerung für die Verluste zu entschädigen, die sie durch einen Großbrand in Rom erlitten hatte.51 In seinem früheren Werk Historiae schätzte Tacitus den Gesamtumfang der Schenkungen in Neros vierzehnjähriger Regierungszeit auf 2,32 Milliarden Sesterzen, was etwa 10 Prozent des jährlichen BIP entsprach. Woher kam all dieses Geld? Waren es private oder öffentliche Mittel? Unterschieden die Kaiser deutlich zwischen ihrem eigenen Geld und dem des Staates? Vermutlich nicht. Der griechisch-römische Historiker Cassius Dio beschreibt Oktavians Umgang mit öffentlichen und privaten Geldern so: „Denn dem Schein nach waren die Staatsgelder von den seinigen geschieden, im Grunde aber wurden auch diese nach seinem Willen verwendet.“52 Der Stanford-Historiker Walter Scheidel, einer der herausragenden Experten für Römische Geschichte, erklärt, das Verhalten der Kaiser sei am ehesten mit dem zu vergleichen, das die saudischen Herrscher der Gegenwart im Umgang mit privaten und öffentlichen Geldern an den Tag legen.53
Eines steht außer Zweifel: Die Kaiser waren extrem reich. Aber sie waren nicht die einzigen reichen Männer im Römischen Reich. Viele Leute verdienten ein Vermögen in der Verwaltung und mit der Plünderung der Provinzen: „Die Schätze wurden nicht mit der Schaufel, sondern mit dem Schwert ausgegraben“, wie es der englische Ökonom Alfred Marshall ausdrückte.54 Wir haben bereits gesehen (in Skizze 1.3), dass der reichste Mann in der römischen Kaiserzeit wahrscheinlich kein Kaiser war. In dieser plutokratischen Gesellschaft hing die Zugehörigkeit zu den herrschenden Klassen davon ab, dass man einen Titel geerbt hatte und über gewaltigen Reichtum verfügte. Um zu gewährleisten, dass beide Bedingungen erfüllt waren, gab es einen ausdrücklichen Zensus (eine Vermögenseinstufung) für die obersten drei Klassen: für die Senatoren, die Ritter und die Decurionen (Stadtratsmitglieder). Die ersten beiden Klassen lebten in Rom (oder im übrigen Italien), die dritte war, wie der Name verrät, über das Reich verteilt. Der erforderliche Mindestbetrag waren in der Frühzeit des Kaiserreichs 1 Million Sesterzen für Senatoren und 250.000 für Ritter. Um diese Zahlen einordnen zu können, müssen wir berücksichtigen, dass der durchschnittliche Senator wahrscheinlich ein Vermögen von 3 Millionen Sesterzen hatte, das bei einem herkömmlichen Zinssatz von 6 Prozent ein jährliches Einkommen von etwa 180.000 Sesterzen abwarf. Das war etwa das Fünfhundertfache des damaligen Durchschnittseinkommens im Römischen Reich. Wollte man das auf die Gegenwart übertragen, so würde das bedeuten, dass amerikanische Senatoren ein Einkommen (nicht ein Vermögen!) von etwa 21 Millionen Dollar im Jahr haben müssten.55 Diese sind vergleichsweise arm, liegt ihr Jahreseinkommen doch bei weniger als 200.000 Dollar und ihr geschätztes durchschnittliches Nettovermögen bei etwa 9 Millionen Dollar.56 Wenn man eine jährliche Rendite von 6 Prozent auf ihr Vermögen zugrundelegt und den Gehältern hinzurechnet, so läge ihr Durchschnittseinkommen immer noch unter 700.000 Dollar – ein Bruchteil des Einkommens der römischen Senatsmitglieder.
Die Zahl der römischen Senatoren war jedoch gering (es waren vielleicht 600), während es wahrscheinlich mehr als 40.000 Ritter gab. Sehr viel unsicherer sind die Daten zu den Decurionen, denn die Vermögenserfordernisse waren von Stadt zu Stadt unterschiedlich (sie hingen vom örtlichen Wohlstandsniveau ab), und für eine Berechnung, die sämtliche Stadtratsmitglieder im Römischen Reich beinhaltet, brauchen wir Schätzungen zur Zahl der Städte, zur Größe der Stadträte und so weiter. Aber um uns eine ungefähre Vorstellung zu machen, können wir festhalten, dass die Zahl der Decurionen auf 130.000 bis 360.000 geschätzt wird. Egal, welche Zahl aus dieser Bandbreite man verwendet, kommt man bei einer Addition der drei reichsten Klassen auf 200.000 bis 400.000 Menschen. In Anbetracht einer Gesamtbevölkerung von 50 bis 55 Millionen Menschen war die Spitze der Pyramide also eher klein. Die reichsten Klassen machten weniger als 1 Prozent der Gesamtbevölkerung aus.57
Es kann nicht überraschen, dass die große Mehrheit der Menschen von einem sehr geringen Einkommen lebte: Es lag auf dem Subsistenzniveau oder knapp darüber. Der Einkommensgradient, der Aufschluss darüber gibt, wie schnell sich das Einkommen zwischen den ärmeren und reicheren Klassen verändert, war damals sehr viel flacher als in modernen Gesellschaften. Die prozentualen Einkommensunterschiede innerhalb dieser Bevölkerungsmasse waren gering. Aber der Einkommensgradient war nur bis zu einem sehr hohen Punkt in der Verteilung flach. An diesem Punkt ganz in der Nähe der Spitze der Verteilung stieg der Gradient plötzlich sehr viel deutlicher an als in modernen Gesellschaften. So unterschied sich das Einkommen der Menschen in der Mitte der Verteilung in Rom nicht sehr vom Einkommen der Armen, anders als in einer modernen Gesellschaft, in der der Gradient stetig ansteigt. Die Zahl jener Menschen, die wir heute der „Mittelschicht“ zurechnen würden, war sehr gering.
Wir sehen also, warum beide Vorstellungen – sowohl die von allgemeiner Gleichheit als auch die von extremer Einkommensungleichheit zwischen den Bürgern des Römischen Reichs – richtig sind. Sie beziehen sich einfach auf verschiedene Teile der Einkommensverteilung. Die Vorstellung von gleichmäßig verteilter Armut wird bestätigt, wenn wir uns den Einkommensgradienten des Großteils der Verteilung ansehen oder die üblichen Maßstäbe der Einkommensungleichheit anlegen. Mit diesen summarischen Maßstäben wird das Einkommen sämtlicher Mitglieder einer Gesellschaft erfasst – und da sich die Einkommen der meisten römischen Bürger kaum voneinander unterschieden, kann auch das Maß der Ungleichheit nicht hoch ausfallen. Wenn wir den GiniKoeffizienten heranziehen, das bevorzugte Maß der Ungleichheit (siehe Essay I), so stellen wir fest, dass der Wert für die Ungleichheit im Römischen Reich bei etwa 41 bis 42 Punkten lag.58 Dieses Maß an Ungleichheit ist fast identisch mit dem der heutigen Vereinigten Staaten und der erweiterten Europäischen Union (siehe auch Skizze 3.3). Aber auch die zweite Vorstellung (gewaltiger Reichtum inmitten verbreiteter Armut) erweist sich als zutreffend, wenn wir uns die Extreme der Verteilung ansehen: Die Kluft zwischen den beiden Extremen war sehr viel tiefer als in einer modernen Gesellschaft vorstellbar.
Es gab auch räumliche Einkommensunterschiede. In der hier untersuchten Kaiserzeit erstreckte sich das Römische Reich, das von einem einzigen Zentrum aus regiert wurde, über ein gewaltiges Gebiet, das sich vom heutigen Marokko und Spanien im Westen bis zum heutigen Armenien im Osten und von England im Norden bis zum Persischen Golf im Süden erstreckte (obwohl das Reich diesen Punkt nur unter Trajan [98–117] erreichte und sich später wieder vom Golf zurückzog). Es erstreckte sich über 3,4 Millionen Quadratkilometer, was etwa drei Vierteln der kontinentalen Fläche der Vereinigten Staaten entspricht. Über diese riesige Fläche verteilt lebten etwa 50 bis 55 Millionen Menschen (womit die Bevölkerungsdichte nur ein Fünftel jener der heutigen Vereinigten Staaten erreichte), deren Gesellschaften sehr unterschiedliche Entwicklungs- und Einkommensniveaus erreicht hatten. Der Wirtschaftshistoriker Angus Maddison hat Schätzungen zur regionalen Spreizung der Einkommen angestellt:59 Am reichsten war die italienische Halbinsel, wo das Einkommen rund 50 Prozent höher war als im Durchschnitt des Reiches. Es folgte Ägypten (die Kornkammer des Römischen Reiches), das ebenfalls etwas wohlhabender war als der Durchschnitt des Reiches. Dann kamen Griechenland, Kleinasien, Teile Afrikas (Libyen und das heutige Tunesien), Südspanien (ein Gebiet, das sich etwa mit dem des heutigen Andalusien deckt) und der Süden Galliens (die heutige Provence). Die Unterschiede zwischen den noch ärmeren Regionen waren gering: Die Inseln (Sizilien, Sardinien und Korsika) waren möglicherweise ein wenig wohlhabender als Gallien, dann folgten Nordafrika (das heutige Algerien und Marokko) und das Schlusslicht bildeten die östlichen Provinzen an der unteren Donau. Das Einkommensverhältnis zwischen den reichsten und ärmsten Regionen war mit etwa 2 zu 1 relativ gering.60
Wenn man sich die heutigen Einkommen der Gebiete ansieht, die Teil des frühen römischen Kaiserreichs waren, fällt sofort auf, dass die regionalen Unterschiede heute sehr viel größer sind als damals. An der Spitze stehen heute die Schweiz, Österreich, Belgien und Frankreich mit einem kaufkraftparitätischen BIP pro Kopf von rund 35.000 Dollar.61 Am anderen Ende finden wir Tunesien und Algerien mit einem BIP pro Kopf zwischen 7000 und 8000 Dollar (nur unwesentlich besser stehen die Balkanländer da). Damit ist das Einkommensverhältnis zwischen den „römischen Provinzen“ auf 5 zu 1 gestiegen. Und auch die Hackordnung zwischen den „Provinzen“ hat sich geändert. Grob gesagt war der Süden damals reicher als der Norden; heute ist es umgekehrt. Aber der Vorteil Westeuropas gegenüber dem Osten besteht weiter.