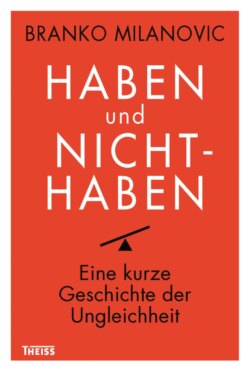Читать книгу Haben und Nichthaben - Branko Milanovic - Страница 8
ESSAY I Ungleiche Menschen Ungleichheit zwischen den Einwohnern eines Landes
ОглавлениеBis zum Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Einkommensungleichheit zwischen Personen als Bestandteil der funktionalen Verteilung des Nationaleinkommens betrachtet: Man sah sich an, wie das Gesamteinkommen zwischen den großen sozialen Schichten (Arbeiter und Kapitalisten) verteilt war.1 Viele Ökonomen betrachteten dies als das zentrale Thema ihres Forschungsgebiets. Im Kapitalismus des 19. Jahrhunderts schien die Gesellschaft normalerweise in mehrere klar voneinander abgegrenzte soziale Schichten unterteilt: Da waren die Arbeiter, die ihre Arbeitskraft verkauften, um sich einen Lohn zu verdienen, und normalerweise relativ arm waren. Sodann gab es die Kapitalisten, die das Kapital besaßen und Profit damit erzielten, weshalb sie relativ reich waren. Und es gab die Grundbesitzer, die mit dem Boden wirtschaftliche Renten erzielten, weshalb sie ebenfalls reich waren. Es wurde angenommen, dass die Verteilung der Einkommen unter diesen drei Klassen entscheidenden Einfluss auf die zukünftige Entwicklung einer Gesellschaft haben würde. Der englische Ökonom David Ricardo, der zu den Vätern der Disziplin der politischen Ökonomie zählt, glaubte, der Einkommensanteil der Grundbesitzer werde stetig steigen, da für die wachsende Bevölkerung mehr Nahrung gebraucht würde, weshalb auch weniger fruchtbarer Boden für den Ackerbau genutzt werden würde – folglich würden die Grundrenten steigen. Die Preise von „Lohngütern“ (Nahrungsmitteln) und die wirtschaftlichen Renten würden explosionsartig steigen. Als Endergebnis erwartete Ricardo einen stationären Zustand, in dem angesichts der steigenden Nahrungsmittelpreise und Grundrenten die Profite so gering ausfallen würden, dass es kaum Anreize zum Sparen und Investieren geben würde.2 Karl Marx sah eine größere Mechanisierung, die sich in einem steigenden Kapitalwert pro Arbeiter ausdrückte, was zu schrumpfenden Kapitalerträgen und zu einer langfristig gegen null sinkenden Profitrate führen würde – was die Investitionen ebenfalls abwürgen musste.
Die Betrachtung der Einkommensverteilung durch das Prisma der Gesellschaftsschichten änderte sich kaum, als die Wirtschaftstheoretiker um das Jahr 1870 einen Richtungswechsel vollzogen und die klassische politische Ökonomie in der „Marginalistischen Revolution“ durch die Grenznutzentheorie ersetzten: Von nun an galt das Augenmerk nicht mehr der allgemeinen wirtschaftlichen Evolution der verschiedenen Gesellschaftsschichten, sondern der Maximierung des individuellen Nutzens. Und an dieser Betrachtungsweise änderte sich auch nichts, als die beiden Denkschulen (die klassische und die Grenznutzenschule) unter der Bezeichnung „neoklassische marshallsche Ökonomie“ (benannt nach dem Cambridge-Ökonomen Alfred Marshall) zusammengeführt wurden: Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts weckte die Verteilung des Einkommens zwischen den Personen (nicht zwischen Klassen) das Interesse Vilfredo Paretos, eines französisch-italienischen Ökonomen, der an der Universität Lausanne unterrichtete. (Sein Beitrag ist Thema der Skizze 1.10.)
Etwa zur selben Zeit wurden auch erstmals Daten zur Verteilung der persönlichen Einkommen zugänglich. Die Bereitstellung dieser Daten ging Hand in Hand mit der wirtschaftlichen Entwicklung (mit dem wachsenden Wohlstand der Länder) und mit den zunehmenden steuerlichen Eingriffen des Staates. Die ersten statistischen Informationen über die Einkommensverteilung wurden gesammelt, weil die Staaten versuchten, die direkten Steuern „fairer“ – das heißt dem Einkommen entsprechend – einzuheben und die Steuereinnahmen insgesamt zu erhöhen, weil sie Geld für die öffentliche Bildung, für Arbeitsunfähigkeitsrenten und vor allem für den Krieg brauchten. Bedeutsam war auch die ideologische Umwälzung, die mit dem Grundsatz einherging, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sein mussten, was bedeutete, dass die Reichen aufgrund ihres größeren Wohlstands und Einkommens mehr beitragen mussten. Die Steuern mussten enger an das Einkommen gekoppelt werden, und um das zu bewerkstelligen, brauchten die staatlichen Behörden bessere Informationen über die Einkommen und deren Verteilung unter den Haushalten. Daher überrascht es nicht, dass die Daten, die Pareto auswertete, um sich ein Bild von der Verteilung der persönlichen Einkommen zu machen, allesamt aus europäischen Steuerakten aus dem späten 19. Jahrhundert stammten. Dies war die Geburtsstunde unseres Themas.
Die Ökonomen und Sozialwissenschaftler befassen sich mit drei Aspekten der Ungleichheit. Erstens fragen sie, wie die Ungleichheit zwischen den Menschen in einem Land entsteht. Gibt es regelmäßige Prozesse, die bewirken, dass sich die Ungleichheit auf eine bestimmte Art verhält, wenn sich eine Gesellschaft entwickelt? Nimmt die Ungleichheit zu, wenn die Wirtschaft wächst – ist sie pro- oder antizyklisch? Diese Fragen behandeln die Ungleichheit als etwas, das erklärt werden sollte. Sie ist eine abhängige Variable.
Bei der zweiten Art von Fragen ist die Ungleichheit eine Variable, die andere wirtschaftliche Phänomene erklärt: Wirkt sich ein hohes Maß an Ungleichheit vorteilhaft oder nachteilig auf das Wirtschaftswachstum aus? Trägt Ungleichheit zu einer besseren Governance bei, lockt sie ausländische Investitionen an, hilft sie dabei, die allgemeine Bildung auszuweiten? Hier wird die Ungleichheit ausschließlich instrumentell betrachtet: Wir interessieren uns für die Frage, ob sie uns einem bestimmten wünschenswerten wirtschaftlichen Ergebnis näherbringt oder nicht.
Drittens betrachten die Sozialwissenschaftler die Ungleichheit unter ethischen Gesichtspunkten. Sie beschäftigen sich mit der Frage, inwieweit durch ein unterschiedliches Maß an Ungleichheit gekennzeichnete gesellschaftliche Arrangements gerecht sind. Ist wachsende Ungleichheit nur akzeptabel, wenn sie die absoluten Einkommen der Armen erhöht? Sollte Ungleichheit, die auf der Herkunft beruht, anders behandelt werden als Ungleichheit, die auf besseren Arbeitsleistungen und größerer Anstrengung beruht?
Wie entwickelt sich die Ungleichheit abhängig vom Einkommensniveau einer Gesellschaft? Pareto, der sich in seiner Analyse auf eine begrenzte Auswahl von Steuerdaten aus europäischen Ländern und Städten des späten 19. Jahrhunderts stützte, glaubte an das „eherne Gesetz der Ungleichheit zwischen den Personen“, das seiner Meinung nach bewirkte, dass sich unterschiedliche soziale Ordnungssysteme (feudalistische, kapitalistische oder sozialistische Gesellschaft) nicht wesentlich auf die Verteilung der Einkommen auswirkten. Die Eliten konnten verschieden sein und verschiedene Methoden anwenden, um die Gesellschaft zu kontrollieren, aber auf die Verteilung des Einkommens – und damit das Maß an Ungleichheit – habe das keine wesentlichen Auswirkungen. Heute wird dies als „80-20-Regel“ bezeichnet, denn bei manchen Phänomenen können wir regelmäßig dieses Verhältnis beobachten: 20 Prozent der Menschen sind verantwortlich für 80 Prozent der Ergebnisse und umgekehrt (die übrigen 80 Prozent der Menschen erzeugen nur 20 Prozent der Ergebnisse). Auch in der Qualitätssicherung findet dieses Gesetz Anwendung (80 Prozent der Probleme werden durch 20 Prozent der Produkte verursacht), und es kann für das Marketing genutzt werden. Und wie wir sehen werden, gilt etwas Ähnliches sogar für die globale Einkommensverteilung (siehe Essay III). Was die Einkommensverteilung innerhalb der Länder anbelangt, so war Pareto unfähig, eine Theorie der Veränderung zu entwickeln, obwohl das Wort „unfähig“ nicht vollkommen zutreffend ist, weil Pareto glaubte (und überzeugt war, empirisch bewiesen zu haben), dass die Einkommensverteilung mehr oder weniger feststehen musste, weshalb es keine Gesetzmäßigkeiten ihrer „Veränderung“ infolge der wirtschaftlichen Entwicklung gab. Für Pareto gab es nur ein „Gesetz ihrer Unveränderlichkeit“.
Es dauerte bis zum Jahr 1955, bis der russisch-amerikanische Ökonom und Statistiker Simon Kuznets die erste Theorie zu den Ursachen für Veränderungen der Einkommensverteilung aufstellte. (Ein Profil von ihm und Pareto findet sich in der Skizze 1.10.) Kuznets, dessen Daten ähnlich beschränkt waren wie die Paretos (obwohl sie nicht aus Steuerarchiven, sondern aus Haushaltserhebungen stammten), gelangte zu dem Schluss, die Ungleichheit zwischen den Einwohnern eines Landes sei nicht dieselbe, gleich welche Form eine Gesellschaft habe, sondern verändere sich, wenn sich die Gesellschaft entwickle. Und er erklärte, diese Veränderung sei vorhersehbar: In sehr armen Ländern sei die Ungleichheit zwangsläufig gering, da das Einkommen der großen Mehrheit der Bevölkerung etwa auf dem Subsistenzniveau liege und kaum wirtschaftliche Unterschiede zwischen den Menschen bestünden. Wenn sich eine Volkswirtschaft entwickle und die Arbeitskräfte von der Landwirtschaft in die Industrie wechselten, drifteten die Durchschnittseinkommen der (wohlhabenderen) Industriearbeiter und der (ärmeren) Bauern auseinander. Und Kuznets zufolge bewegen sich die Einkommen der einzelnen Arbeitskräfte innerhalb des Industriesektors ebenfalls deutlicher auseinander als die Einkommen der Bauern, weil die Aufgaben in der modernen Industrie vielfältiger sind als in der Landwirtschaft. Die Einkommensungleichheit nimmt also sowohl infolge der wachsenden Kluft zwischen den Durchschnittseinkommen in Industrie und Landwirtschaft als auch infolge der Differenzierung zwischen den Industriearbeitern zu. Schließlich beginnt der Staat in hoch entwickelten Gesellschaften, die Einkommen umzuverteilen (siehe Skizze 1.7); die Bildung wird ausgeweitet und die Ungleichheit nimmt ab (siehe Skizzen 1.1 und 1.2). Hier haben wir die berühmte „Kuznets-Hypothese“, in der die Veränderung der Ungleichheit im Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung anhand einer auf dem Kopf stehenden U-Kurve beschrieben wird: Die Ungleichheit muss erst zunehmen, bevor sie abnehmen kann.
Diese Idee war jedoch nicht vollkommen neu. Sie war schon rund 120 Jahre früher von dem französischen Sozialwissenschaftler und Politiker Alexis de Tocqueville zu Papier gebracht worden:
Wenn man aufmerksam betrachtet, was seit Anbeginn der Gemeinschaften in der Welt geschieht, so erkennt man ohne große Mühe, daß Gleichheit nur am Anfangs- und am Endpunkt der Kulturentwicklung steht. Die Wilden sind untereinander gleich, weil sie alle gleichermaßen schwach und unwissend sind. Die Kulturmenschen können einander gleich werden, weil ihnen allen ähnliche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, Wohlstand und Glück zu erreichen. Zwischen diesen beiden Extremen stößt man auf die Ungleichheit der Lebensbedingungen, auf Reichtum, Wissen und Macht einiger sowie auf Armut, Unkenntnis und Schwäche aller anderen. (Mémoire sur le paupérisme, 1835)*
Natürlich sagte Tocqueville, der kein Ökonom war wie Kuznets, nichts über den Mechanismus, der diese umgekehrte U-Kurve hervorbringen würde.
Die Kuznets-Hypothese wurde von den Ökonomen wieder und wieder empirisch überprüft. Mittlerweile stehen umfangreiche nationale Haushaltserhebungen zu Einkommen und Konsum zur Verfügung, die uns aufschlussreiche Daten zur Einkommensverteilung liefern und die Untersuchung dieser Theorie erheblich erleichtert haben. Im Prinzip sollte die Hypothese am besten funktionieren, wenn wir die Entwicklung der Ungleichheit innerhalb eines Landes untersuchen, das eine umwälzende Transformation von einer Agrar- zu einer Industriegesellschaft und schließlich zu einer Dienstleistungsgesellschaft durchmacht. Aber in diesem Kontext sind die Ergebnisse durchmischt: In einigen Ländern ist (in einigen Zeiträumen) die umgekehrte U-Kurve zu beobachten, aber in anderen Ländern ist das nicht der Fall.
Die Unzufriedenheit mit den Ergebnissen und der Prognosetauglichkeit der Kuznets-Hypothese bewegte die Forscher dazu, sie durch neue Elemente zu ergänzen, die besser geeignet waren, die Entwicklung der Einkommensungleichheit zu erklären. So entstand die „verbesserte“ Kuznets-Hypothese. Nun wurden neben dem Einkommensniveau zusätzliche Variablen wie die „finanzielle Tiefe“ einer Volkswirtschaft, der Umfang der Staatsausgaben oder des öffentlichen Dienstes sowie die Offenheit einer Volkswirtschaft herangezogen, um die Entwicklung der Ungleichverteilung zu erklären. Viele Ökonomen glaubten, diese zusätzlichen Elemente könnten unser Verständnis der Ungleichheit verbessern. Beispielsweise nahmen sie an, ein effizienterer und ausgeweiteter Finanzsektor werde die Armen in die Lage versetzen, Kredite aufzunehmen, um ihre Bildung zu bezahlen, was die Ungleichheit verringern werde, da die Aussichten auf berufliches Fortkommen durch Bildung nicht mehr auf die Reichen beschränkt sein werde. Höhere Staatsausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) oder eine höhere Beschäftigtenzahl im öffentlichen Dienst gemessen an der Größe des nationalen Arbeitsmarkts verringern demnach die Ungleichheit, da sie den Armen zugutekommen und der Einkommensungleichverteilung entgegenwirken. Eine größere Offenheit für den Handel sollte in armen Ländern die Ungleichheit verringern, da sie die Nachfrage nach nicht qualifikationsintensiven Produkten wie Textilien erhöht, auf die sich diese Länder spezialisieren können; in der Folge werden die Löhne ungelernter Arbeiter verglichen mit denen qualifizierter Arbeitskräfte oder mit den Gewinnen der Kapitalisten steigen. In reichen Ländern sollte die Öffnung für den Welthandel das Gegenteil bewirken, da diese Länder zumeist technologisch anspruchsvolle Produkte exportieren, für deren Erzeugung hochqualifizierte Arbeitskräfte wie Informatiker und Ingenieure benötigt werden; folglich steigen die Einkommen von Hochschulabsolventen gegenüber den Einkommen von Arbeitskräften, die nur eine Grund- oder Sekundärschulausbildung haben. Die Ungleichheit nimmt zu. Um die Kuznets-Hypothese zu testen, würden die Ökonomen heute neben dem Einkommen auch all diese und einige andere Faktoren berücksichtigen, wobei sie vermutlich von Fall zu Fall Dinge wie die Altersstruktur der Bevölkerung oder die Verteilung des Grundbesitzes ergänzen würden. Tatsächlich sind die Ergebnisse besser, wenn wir uns nicht auf das Einkommensniveau beschränken – aber wirklich spektakulär sind sie auch nicht.
In jüngerer Zeit hat der französische Ökonom Thomas Piketty eine Reihe empirischer Studien vorgelegt, die er gemeinsam mit anderen Forschern (Emmanuel Saez, Anthony Atkinson, Abhijit Banerjee) durchgeführt hat. Die Ergebnisse widersprechen sowohl der Kuznets-Hypothese als auch ihren „verbesserten“ Varianten. Piketty zeigt, dass die Ungleichheit in den westlichen Ländern lange Zeit abnahm, im letzten Vierteljahrhundert jedoch wieder deutlich gestiegen ist. Diese Erkenntnis ist keineswegs neu, aber Piketty liefert eine „politische“ Erklärung dafür: Die Entwicklung der Ungleichheit hänge davon ab, ob der Staat die direkten Steuern auf laufende Einkommen und geerbtes Vermögen erhöhe oder senke, und werde von kriegerischen Konflikten beeinflusst (das heißt durch die Zerstörung von Sachkapital und die Verringerung der Einkommen der Kapitalisten). Dies kann man als eine politische Theorie der Einkommensverteilung betrachten, in der die gesellschaftliche Haltung (die Vorstellung davon, was gerecht und ungerecht ist) und die wirtschaftlichen Interessen, die sich im Wahlverhalten und in den Positionen der politischen Parteien niederschlagen, sowie die wirtschaftlichen Erfordernisse im Krieg über den Verlauf der Ungleichheitskurve entscheiden.
Um zu erklären, was die Entwicklung der Ungleichheit über einen langen Zeitraum (in diesem Fall das gesamte 20. Jahrhundert) hinweg antreibt, griff Piketty wieder auf eine alte Datenquelle zurück, die eigentlich aus der Mode gekommen war: die Steuerstatistiken. Diese Statistiken, die Pareto als erster verwendet hatte, wurden durch die Haushaltserhebungen ersetzt, weil die Steuerdaten nur einen Teil – das obere Ende – der Einkommensverteilung abdecken, denn in den meisten Ländern zahlen die Armen keine direkten Steuern. Die Haushaltserhebungen hingegen beinhalten die gesamte Bevölkerung. Die Verwendung von Steuerdaten ist problematisch, weil die daraus gezogenen Schlüsse nur gültig sind, wenn zwei Annahmen zutreffen: (1) Die zu versteuernden Einkommen entsprechen weitgehend den tatsächlichen Einkommen der Haushalte (und diejenigen, welche die höchsten Steuern zahlen, sind auch die reichsten Personen). (2) Man kann die allgemeine Entwicklung der Ungleichheit anhand der Veränderung des Einkommensanteils der reichsten Gruppen annähernd bestimmen (zum Beispiel des reichsten 1 Prozent der Steuerzahler, das auch das reichste 1 Prozent der Haushalte ist). Aber beide Annahmen sind anfechtbar. Das von Piketty und seinen Coautoren verwendete zu versteuernde Einkommen wird auch als Markteinkommen (oder Einkommen vor Steuern) bezeichnet. Es beinhaltet also weder die Steuerabzüge noch staatliche Transferleistungen.3 Aber normalerweise interessieren wir uns für die Ungleichheit der verfügbaren Einkommen, das heißt jener Einkommen, die den Haushalten und Personen gehören, nachdem sie ihre Steuern bezahlt und staatliche Transferleistungen bezogen haben. Wenn sich Steuern oder Sozialtransfers ändern, können sich die Ungleichheit der Markteinkommen und jene der verfügbaren Einkommen in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Das Problem bei der zweiten Annahme ist, dass die Statistiken zur Ungleichheit im Prinzip die Einkommen aller Menschen beinhalten sollten, nicht nur die der Wohlhabenden. Beispielsweise könnte es sein, dass nicht nur der Einkommensanteil der Reichsten, sondern auch jener der Armen steigt, während der der Mittelschicht schrumpft. In diesem Fall können wir nicht behaupten, dass die Ungleichheit insgesamt zugenommen hat – aber wir gelangen zwangsläufig zu diesem Schluss, wenn wir uns ausschließlich am wachsenden Einkommensanteil der Reichen orientieren. Da Studien wie die von Piketty auf dieser Annahme beruhen (die, wie wir wissen, nicht auf alle Orte und zu allen Zeiten zutrifft), wird die Interpretation der Resultate problematisch. Stünden uns Erhebungen zu Einkommen oder Konsum der Bevölkerung zur Verfügung, die weit genug in die Vergangenheit zurückreichen, so wäre das Problem natürlich gelöst. Wir müssten nicht auf die sehr viel weniger präzisen und bruchstückhaften Steuerdaten zurückgreifen. Wie wir sehen werden, liegen solche Daten in den reichen Ländern im Allgemeinen nur für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und für viele Entwicklungs- und Schwellenländer nur für die letzten zwanzig bis dreißig Jahre vor.
Dies ist die gegenwärtige Situation in der Ungleichheitsforschung. Es wäre unfair und ist vermutlich unmöglich zu sagen, welcher der verschiedenen Standpunkte überzeugender ist. Vermutlich keiner. Aber wir sehen, dass wir über eine einfache Messung der Ungleichheit oder ein Verständnis ihrer Entwicklung hinausgehen und uns der wesentlichen Frage zuwenden müssen, ob Ungleichheit eine notwendige Voraussetzung für das Wachstum einer Volkswirtschaft ist. Und wenn sie nötig ist: Wie groß sollte sie sein?
Wie wirkt sich die Ungleichheit auf die wirtschaftliche Effizienz aus? Die Ungleichheit beschäftigt uns, besser gesagt, sie beschäftigt uns vor allem, weil wir glauben, dass sie sich auf einige bedeutsame wirtschaftliche Phänomene auswirkt, insbesondere auf das Wirtschaftswachstum: Wachsen Länder mit größerer Ungleichheit schneller oder langsamer? Im Lauf der Jahre wurde die eindeutige Antwort, Ungleichheit sei gut für das Wachstum, durch eine sehr viel nuancenreichere Einschätzung ersetzt, die eher das Gegenteil besagt.
Woran liegt das? Zum besseren Verständnis können wir die Wirkung der Ungleichheit auf die wirtschaftliche Effizienz mit der Wirkung des Cholesterins vergleichen: So wie es das gute und das schlechte Cholesterin gibt, gibt es auch eine „gute“ und eine „schlechte“ Ungleichheit.4 Die „gute“ Ungleichheit ist nötig, um den Menschen Anreize zum Lernen, zu harter Arbeit oder zu unternehmerischen Wagnissen zu geben. Dazu bedarf es eines gewissen Maßes an Ungleichheit zwischen den Belohnungen (mehr zu den Auswirkungen einer „unvernünftigen“ Nivellierung der Einkommen in Skizze 1.5 über die Ungleichheit im Sozialismus). Aber an einem – schwer zu bestimmenden – Punkt, wo Ungleichheit keinen Ansporn zu herausragenden Leistungen mehr gibt, sondern lediglich dabei hilft, eine erworbene Position zu verteidigen, verwandelt sie sich in „schlechte“ Ungleichheit. Das geschieht, wenn ungleich verteilte Vermögen oder Einkommen genutzt werden, um eine wirtschaftlich wünschenswerte politische Veränderung zu verhindern (z.B. eine Landreform oder die Abschaffung der Sklaverei), den Zugang zur Bildung auf die Reichen zu beschränken oder dafür zu sorgen, dass die besten Jobs Personen aus wohlhabenden Familien vorbehalten bleiben. All das beeinträchtigt die wirtschaftliche Effizienz. Wenn die Aussicht auf eine gute Bildung vom Wohlstand der Eltern abhängt, kann die Gesellschaft die Fähigkeiten und das Wissen eines beträchtlichen Teils ihrer Mitglieder (der Armen) nicht nutzen. In diesem Sinn unterscheidet sich die Diskriminierung aufgrund fehlenden geerbten Vermögens oder Einkommens nicht von jeder anderen Form von Diskriminierung, etwa aufgrund von Geschlecht oder ethnischer Zugehörigkeit. In all diesen Fällen entscheidet die Gesellschaft, dass die Fähigkeiten eines Teils ihrer Mitglieder nicht genutzt werden. Es ist unwahrscheinlich, dass eine solche Gesellschaft wirtschaftlich erfolgreich sein wird. Abhängig davon, welche Art von Ungleichheit zu einer gegebenen Zeit in einem Land vorherrscht – „positive“, die nötig ist, um Anreize zu schaffen, oder „negative“, die ein Monopol der Reichen garantiert –, kann sie als vorteilhaft oder schädlich betrachtet werden.
Die Vorstellung, die Einkommensungleichheit sei vorteilhaft, weil sie den Menschen Anreize zu herausragenden Leistungen gibt, herrschte zu einer Zeit vor, als die Ökonomen glaubten, nur die sehr reichen Menschen sparten, weshalb es ohne sie keine Investitionen und kein Wachstum des Wohlstands geben könne. Von den Arbeitern (oder den Armen) wurde erwartet, dass sie alles ausgaben, was sie verdienten. Würden alle dasselbe (relativ) niedrige Einkommen haben, so würde nicht genug gespart und investiert – die Folge wäre wirtschaftliche Stagnation. Die Reichen an sich waren nicht wichtig, aber man brauchte sie, damit sie sparten, Kapital anhäuften und den Wirtschaftsmotor ankurbelten: Sie wurden als Behälter für die Individualisierung der Ersparnisse betrachtet. Sie würden nicht mehr konsumieren und sich nicht mehr Vergnügungen gönnen als alle anderen, sodass überschüssiges Einkommen gespart und investiert würde. Max Weber bezeichnete die asketische Haltung als zentralen Bestandteil des „kapitalistischen Geistes“: „[V]or allem ist das ‚summum bonum‘ dieser ‚Ethik‘, der Erwerb von Geld und immer mehr Geld, unter strengster Vermeidung alles unbefangenen Genießens, so gänzlich aller […] hedonistischen Gesichtspunkte entkleidet, so rein als Selbstzweck gedacht, dass es als etwas gegenüber dem ‚Glück‘ oder dem ‚Nutzen‘ des einzelnen Individuums jedenfalls gänzlich Transzendentes und schlechthin Irrationales erscheint.“5
Diese ein wenig rosige Begründung für die Notwendigkeit von Einkommensunterschieden unter der Bedingung, dass hohe Einkommen für Investitionen genutzt werden, findet ihren besten Ausdruck in einer Passage im Werk des berühmten englischen Ökonomen John Maynard Keynes, der als Begründer der modernen Makroökonomie gilt:
Trotzdem war die Gesellschaftsordnung [Europas vor 1914] so aufgebaut, daß ein großer Teil des erhöhten Einkommens in die Hände jener Klasse kam, bei welcher die Wahrscheinlichkeit am geringsten war, daß sie es gleich wieder verbrauchen würde. Die neuen Reichen des neunzehnten Jahrhunderts waren nicht an große Ausgaben gewöhnt und zogen die Macht, welche ihnen ihre Investitionen verliehen, den Freuden des unmittelbaren Konsums vor. Tatsächlich war es eben die Ungleichheit der Verteilung des Wohlstandes, die jene großen Akkumulationen von Vermögen und Kapitalanlagen möglich machte, welche dieses Zeitalter von allen anderen unterscheidet. Hierin lag in der Tat die hauptsächliche Berechtigung des kapitalistischen Systems. Hätten die Reichen ihren neuen Reichtum zum eigenen Vergnügen ausgegeben, hätte die Welt schon vor langer Zeit eine solche Ordnung unerträglich gefunden. Doch sie sparten und horteten wie die Bienen, was der gesamten Gesellschaft zugute kam – auch wenn sie selbst damit engere Ziele verfolgten.6
Dies war das Bild des Kapitalisten als „Sparmaschine“ und Entrepreneur.
Es gab jedoch auch zahlreiche Exemplare des kapitalistischen Rentiers, der wenig mehr tat als sich zurückzulehnen und entspannt zuzusehen, wie das Geld für ihn „die Arbeit machte“. Eine schöne Beschreibung des Rentiers finden wir in Stefan Zweigs wunderbarem Buch Die Welt von Gestern, in dem das Europa vor dem Ersten Weltkrieg beschrieben ist, eine Welt, in der das begehrteste Kompliment (Zweig zufolge) die Bezeichnung „solide“ für den respektablen Bürger war, eine Welt, in der alles darauf hindeutete, dass sich Vernunft und Fortschritt ewig fortsetzen würden. Die Reichen hatten ein leichtes Leben:
Dank diesem ständigen Zurücklegen der Gewinne bedeutete in jener Epoche steigender Prosperität, wo überdies der Staat nicht daran dachte, auch von den stattlichsten Einkommen mehr als ein paar Prozent an Steuern abzuknappen und andererseits die Staats- und Industriewerte hohe Verzinsung brachten, für den Vermögenden das Immer-reicher-Werden eigentlich nur eine passive Leistung.7
In dieser Perspektive wirken die Reichen weniger wie unverzichtbare „respektable“ Bürger, die sparen und investieren, sondern eher wie Parasiten, die gut davon leben, Dividendencoupons abzuschneiden. Aber die seit einigen Jahrzehnten vorherrschende Vorstellung, die Ungleichheit sei schädlich, beruht nicht auf dieser ethischen Sichtweise. Sonderbarerweise gehen die Verfechter dieser Vorstellung von demselben Grundgedanken aus wie jene, die in der Ungleichheit eine vorteilhafte Kraft sehen – es sollte Personen geben, die zu investieren bereit sind –, ziehen jedoch vollkommen andere Schlüsse daraus. Die Argumentation sieht so aus8: Die Menschen (sei es, dass sie reich sind, der Mittelschicht angehören oder arm sind) stimmen bei den Wahlen darüber ab, wie hoch ihre Steuern sein sollen, wobei sie berücksichtigen, dass die mit den Steuern finanzierten Staatsausgaben in erster Linie den Armen zugutekommen. Von einem hohen Maß an Ungleichheit geprägte Gesellschaften werden für hohe Steuern stimmen, weil in solchen Gesellschaften eine Mehrheit der Bürger von Sozialtransfers profitiert, keine oder nur geringe Steuern zahlt und die Reichen immer überstimmt (siehe Skizze 1.7). Nun verringern derart hohe Steuern die Anreize, zu investieren und hart zu arbeiten, weshalb das Wirtschaftswachstum erlahmt. Der Mechanismus hat Ähnlichkeit mit dem, der im 19. Jahrhundert befürchtet wurde: Wenn man den Besitzlosen die Chance zu wählen gab, würden sie die Besitzenden enteignen. Hier geschieht dasselbe, nur dass die Enteignung ein wenig sanfter verläuft: Sie wird nicht durch offene Verstaatlichung, sondern durch Besteuerung bewerkstelligt.9
Gleichgültig, ob man die wirtschaftliche Ungleichheit nun als vorteilhaft oder schädlich betrachtet: man braucht in jedem Fall Menschen, die bereit sind, ihr Geld zu investieren. Aber im ersten Fall braucht man ein hohes Maß an Ungleichheit, weil es sonst keine ausreichend reichen Investoren gibt. Im zweiten Fall macht die Einführung der Demokratie eine ausgeprägte Ungleichheit politisch untragbar. Selbst wenn die Reichen versprechen, dass sie ihr überschüssiges Einkommen nicht konsumieren, sondern investieren werden, und die Armen auf diese Art überzeugen, dass sie unverzichtbar für das Wachstum der Wirtschaft sind, können sie unmöglich gezwungen werden, dieses Versprechen auch zu halten. Es wäre auch nicht glaubwürdig. Daher muss das kapitalistische System die Einkommen vor Steuern so verteilen, dass die Gesellschaft keinen Anlass dazu sieht, den Reichen erpresserische Steuern aufzuerlegen. Um das zu erreichen, muss das Vermögen relativ gleichmäßig unter den Menschen verteilt werden. Die Verteilung des Finanzvermögens können wir kurz- oder mittelfristig nicht wesentlich beeinflussen, aber wir können die Verteilung der Bildung verändern (also das, was die Ökonomen als Zusammensetzung des „Humankapitals“ bezeichnen) – daher wird einem leichteren Zugang zur Bildung für alle so große Bedeutung beigemessen. Der Grund ist nicht einfach, dass die Bildung als an sich wertvoll betrachtet wird, und es geht auch nicht nur darum, dass ein höherer Bildungsstand das Wirtschaftswachstum direkt ankurbeln kann. Vielmehr würde eine breitere Verteilung dieses Vermögenswerts auch die Einkommen vor Steuern gleichmäßiger verteilen, weshalb es sich die relativ Armen zweimal überlegen würden, bevor sie für Steuererhöhungen stimmen.
Verändert eine Änderung der wirtschaftlichen Entwicklung auch unsere Einschätzung des Nutzens der Ungleichheit? Es ist wahrscheinlich.10 In der Frühphase der Entwicklung ist das Sachkapital knapp. Unter diesen Bedingungen werden reiche Personen gebraucht, die bereit sind, ihr Einkommen nicht zur Gänze für den Konsum aufzuwenden, sondern zu investieren, damit mehr Maschinen und Straßen gebaut werden können. Wenn sich die Wirtschaft entwickelt, wächst das Sachkapital, womit das Humankapital (die Bildung) im Verhältnis dazu wertvoller wird. Nun wird es wichtig, die Bildung auszuweiten. Aber wenn dies dadurch verhindert wird, dass begabte Kinder aus armen Haushalten die Bildung nicht bezahlen können, gerät das Wachstum ins Stocken. So gelangen wir sogar ohne die Einführung des universellen Wahlrechts und der Demokratie zu einem ähnlichen Schluss: Für ein schnelles Wachstum im fortgeschrittenen Stadium der wirtschaftlichen Entwicklung muss die Bildung ausgeweitet werden, und eine gute Bildung für breite Bevölkerungsgruppen ist eine unverzichtbare Voraussetzung für geringere Ungleichheit.
Die empirischen Belege für den Zusammenhang zwischen Ungleichheit und Wirtschaftswachstum sind widersprüchlich. Möglicherweise ist das unvermeidlich, denn zu bestimmten Zeiten kann die Ungleichheit an bestimmten Orten das Wachstum hemmen (weil sie die Entstehung von Monopolen begünstigt), während sie es in anderen Situationen anregt (weil sie Leistungsanreize schafft). Es genügt zu sagen, dass unsere Einschätzung der positiven und negativen Auswirkungen der Ungleichheit auf die wirtschaftliche Effizienz immer davon abhängen wird, ob wir dem einen oder dem anderen Bestandteil des grundlegenden Dilemmas größeres Gewicht beimessen: dem gesellschaftlichen Monopol oder den Anreizen. In den Fällen, in denen wir glauben, dass das von den Reichen ausgeübte Monopol auf Macht und Wohlstand die gesellschaftliche Stabilität und damit auch die wirtschaftliche Entwicklung und sogar die Lebensfähigkeit des Staates bedroht (wie es Platon vor 2400 Jahren tat), sind Einkommens- oder Vermögensungleichheit ein soziales Übel, das bekämpft werden muss. Auf die Frage, ob seine Forderung, der ideale Staat müsse sparsam sein, nicht die Gefahr einer Eroberung durch reiche Nachbarn heraufbeschwöre, antwortet Platons Sprachrohr Sokrates:
Einen großen Namen, antwortete [Sokrates], muss man den andern [Staaten] geben, denn jeder von ihnen bildet viele Staaten, nicht aber einen Staat […]. Denn zwei sind es auf jeden Fall, die einander feindlich gegenüber stehen, einer der Armen und einer der Reichen, in jedem von diesen aber sind sehr viele, wenn du nun gegen diese als gegen einen einzigen auftrittst, so scheiterst du völlig, wofern aber als gegen viele, so dass du das Eigentum der einen den andern gibst, Schätze und Vermögen oder auch sie selbst, so wirst du immer viele Bundesgenossen haben und wenige Feinde.11
Aber in den Fällen, in denen wir glauben, dass eine übertriebene Nivellierung der Einkommen – hier fehlt sowohl das Zuckerbrot des Erfolgs als auch die Peitsche des Scheiterns – dazu führt, dass sich die Menschen nicht mehr anstrengen werden, weil wir ihnen nicht erlauben, die Früchte ihrer Arbeit oder ihrer Investitionen zu ernten, sollten wir, so sonderbar das scheinen mag, für größere Ungleichheit sorgen.
Ungleichheit und wirtschaftliche Gerechtigkeit. Die Einkommensungleichheit ist auch deshalb ein wichtiges Thema, weil sie zwei Fragen betrifft, die oft beide im Interesse der Gesellschaft sind, aber manchmal nicht oder zumindest nicht leicht miteinander in Einklang gebracht werden können. Dies sind die wirtschaftliche Effizienz und die wirtschaftliche Gerechtigkeit. Bei der wirtschaftlichen Effizienz geht es um die Maximierung der Gesamtproduktion oder der Rate des wirtschaftlichen Fortschritts einer Gesellschaft. Bei der wirtschaftlichen Gerechtigkeit geht es um die Akzeptanz und Nachhaltigkeit einer gegebenen sozialen Ordnung. Hier spielt die wirtschaftliche Ungleichheit offenkundig ebenfalls eine Rolle. Auf geerbtem Vermögen, ethnischer Zugehörigkeit oder Geschlecht beruhende Ungleichheit kann selbst dann als ungerecht betrachtet werden, wenn sie der wirtschaftlichen Entwicklung nicht schadet, das heißt, wenn sie ihren rein instrumentellen Nutzen durchaus erfüllt. Wenn die meisten Menschen oder eine einflussreiche Minderheit eine gegebene soziale Ordnung als ungerecht betrachten, werden Zweifel an der Nachhaltigkeit dieser Ordnung wach.
Die Ökonomen verwenden bei der Auseinandersetzung mit der Frage, wie wünschenswert verschiedene soziale Arrangements sind, gerne die „soziale Wohlfahrtsfunktion“, ein Konstrukt, das im Prinzip die Wohlfahrt (den Nutzen) sämtlicher Mitglieder einer Gemeinschaft beinhaltet. Ziel ist es, das Wohlergehen aller Mitglieder der Gemeinschaft in einer sozialen Ordnung mit dem Wohlergehen aller Mitglieder in einer anderen Ordnung zu vergleichen, um festzustellen, welches der beiden Systeme besser ist. Das wird als „Welfarismus“ bezeichnet. Eine grobe Methode des Welfarismus besteht darin, einfach den Nutzen für die einzelnen Mitglieder der Gemeinschaft zu addieren, sodass in einer Gesellschaft, die aus Alan, Bob und Charlie besteht, der Gesamtnutzen für die Gesellschaft dem Nutzen für Alan plus dem Nutzen für Bob plus dem Nutzen für Charlie entspricht. Die individuellen Nutzenfunktionen von Alan, Bob und Charlie sehen so aus, dass jede einzelne positiv wird, obwohl der Nutzen jedes zusätzlichen Dollars an Einkommen sinkt. Dies ist eine vernünftige und empirisch belegte Annahme: Denken wir an die Tatsache, dass wir das erste Eis an einem heißen Tag vermutlich mehr genießen als das zweite und zweifellos mehr als das dritte Eis. Technisch wird dies als „sinkender Grenznutzen des Einkommens“ bezeichnet. Nehmen wir nun zusätzlich an, dass die Nutzenfunktionen von Alan, Bob und Charlie identisch sind. In diesem Fall wäre eine vollkommen gleiche Verteilung des Einkommens optimal. Hätten wir Alan ein wenig mehr Einkommen gegeben als Bob und Charlie, so würden wir feststellen, dass der reiche Alan das zusätzliche Einkommen weniger genießt als die ärmeren Bob und Charlie (da alle drei sinkende und identische Grenznutzenfunktionen haben). Der Gesamtnutzen würde also steigen, wenn wir Alans zusätzliches Einkommen weiterhin transferieren, bis schließlich alle drei denselben Betrag erhalten.
Von diesem Gedanken ging der englische Ökonom Anthony Atkinson aus, als er im Jahr 1970 einen Schlüsselbeitrag zum Welfarismus veröffentlichte. Atkinson stellte die Frage, wie die Ungleichheit so gemessen werden konnte, dass erkennbar würde, inwieweit verschiedene soziale Ordnungen wünschenswert waren.12 Atkinson berechnete die Ungleichheit in einer Gesellschaft anhand der Zeit, die unter dem Gesichtspunkt der Wohlfahrt „vergeudet“ wird, weil dieselbe Wohlfahrt auch mit einem kleineren, aber gleichmäßig unter den Mitgliedern der Gesellschaft verteilten Gesamteinkommen erreicht werden könnte. Die etwas sperrige Bezeichnung dafür lautet „gleichverteiltes Äquivalenzeinkommen“. Selbst wenn der Kuchen insgesamt kleiner wird, aber die Stücke alle gleich groß sind, wäre der Gesamtgenuss aus dem Verzehr des kleineren Kuchens derselbe wie der Gesamtgenuss aus einem größeren, aber ungleich verteilten Kuchen. Nehmen wir an, Kuba und die Dominikanische Republik erzeugen die gleiche Gesamtmenge an Wohlfahrt für ihre Bürger, obwohl das dominikanische Gesamteinkommen höher ist. Der „überschüssige“ Teil des dominikanischen Einkommens ist unter dem Gesichtspunkt des Nutzens vergeudet: Die Dominikaner können dieses Extraeinkommen einfach beseitigen, weniger hart arbeiten und ihr geringeres Einkommen wie die Kubaner gleichmäßiger verteilen. Letzten Endes gäbe es keinen Wohlfahrtsverlust. Wie viel Einkommen „vergeudet“ wird, ist also ein Maß der Ungleichheit.
Wäre es möglich, den Nutzen verschiedener Personen zu addieren, so wäre es natürlich einigermaßen einfach festzustellen, welches übergeordnete System (das kubanische oder das dominikanische) vorzuziehen ist. Das Problem ist, dass es keine allgemein anerkannte Methode gibt, den individuellen Nutzen verschiedener Individuen sinnvoll miteinander zu kombinieren. Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass der Grenznutzen eines Guts oder einer Dienstleistung im Allgemeinen für alle Personen sinkt, wenn sie mehr davon konsumieren. Aber wir können das Maß dieses Nutzens nicht vergleichen, denn eine Person kann ständig einen größeren Nutzen aus etwas ziehen als eine andere Person. Anders ausgedrückt: Während die Form der Nutzenfunktionen ähnlich sein kann (sinkendes Einkommen), kann ihr Niveau von Person zu Person unterschiedlich sein. Um auf unser Beispiel zurückzukommen: Selbst wenn uns Bob sagt, dass er in einem Zustand ständiger Glückseligkeit lebt, können wir nicht wissen, ob er wirklich glücklicher ist als der griesgrämige Charlie. Vielleicht messen sie einfach den Nutzen unterschiedlich.
Und selbst wenn wir genau bestimmen könnten, welchen Nutzen etwas für eine Person hat, und theoretisch in der Lage wären, ihre Wohlfahrt zu erhöhen, hätten wir immer noch ein ethisches Problem, weil jene Verteilung, die in der Summe das größte Wohlbefinden erzeugen würde, so aussähe, dass das Einkommen im Wesentlichen den Personen mit hohen Nutzenfunktionen zugeteilt würde, also jenen, die es am besten verstehen, ein gegebenes Einkommen in Nutzen umzuwandeln. Mit diesem Argument verteidigte der englische Ökonom Francis Edgeworth Ende des 19. Jahrhunderts die Ungleichheit: Er erklärte, reichere Personen mit einem „verfeinerten“ Geschmack verdienten ein höheres Einkommen, weil sie größeren Genuss an Dingen wie besserem Essen oder Wein hätten. Sollte eine Gesellschaft tatsächlich so geordnet sein, dass sie denen das meiste Einkommen zugesteht, die es am besten genießen können? Sollte die optimale Einkommensverteilung so aussehen, dass einige wenige Epikureer, die sich ein Leben ohne Champagner und Kaviar nicht vorstellen können, von Menschen finanziert werden müssen, die nur von Brot und Wasser leben?
Dies war der Ausgangspunkt für Amartya Sens einflussreiche Kritik, die als „Fähigkeiten-Ansatz“ bekannt geworden ist: Wenn ein Behinderter aus einem Fußballspiel nicht so viel Nutzen ziehen kann wie eine nicht behinderte Person, sollten wir dem nicht Behinderten dann mehr und mehr Chancen eröffnen und dem Behinderten immer weniger Möglichkeiten geben, weil dieser für sich selbst und damit letzten Endes auch für die Gesellschaft nicht so viel Nutzen erzeugt? Der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass dies eine abstoßende Schlussfolgerung ist. Sen erklärte, wir sollten stattdessen versuchen, die „Fähigkeit“ der Menschen zum Lebensgenuss zu nivellieren.13
Wenn es darum geht, verschiedene soziale Ordnungen danach zu beurteilen, wie sie die Wohlfahrt fördern, haben wir also drei Möglichkeiten. Erstens können wir annehmen, dass die Nutzenfunktionen aller Mitglieder identisch sind (wir wissen jedoch, dass es im wirklichen Leben nicht so ist). Dann würde die maximale gesamte Wohlfahrt an dem Punkt erreicht, an dem das Einkommen exakt gleich verteilt ist. Dies ist die Idee hinter Atkinsons „gleichverteiltem Äquivalenzeinkommen“. Zweitens können wir versuchen, jene Personen „auszuwählen“, die „effizienter“ in der Erzeugung von Nutzen sind, und ihnen höhere Einkommen zugestehen. Drittens können wir den umgekehrten Weg gehen und eben denen höhere Einkommen zugestehen, denen es schwerer fällt, gegebene Güter und Dienstleistungen zu genießen. Das könnte die gesamte Wohlfahrt, gemessen anhand einer einfachen Addition des individuellen Nutzens, verringern, und wir müssten uns bei unserem Urteil nicht länger auf den Welfarismus stützen.14
Ein anspruchsvollerer welfaristischer Ansatz besteht darin, eine Wohlfahrtsfunktion zu entwickeln, die den Nutzen sämtlicher Mitglieder beinhaltet, aber ohne eine Addition des individuellen Nutzens auskommt und sich auf die Darstellung der Wohlfahrtszustände der einzelnen Individuen beschränkt. In diesem Fall können wir nur die Zustände als wünschenswert betrachten, in denen sich die Situation mindestens einer Person verbessert, ohne dass irgendeine andere Person in eine schlechtere Lage gerät. Einen solchen Zustand erfüllt das sogenannte Pareto-Kriterium: Wenn wir ihn erreichen, können wir sicher sein, dass sich niemand beklagen wird. Das Problem ist, dass die Forderung nach einem solchen Zustand nicht nur ultrakonservativ, sondern in der realen Welt fast nie zu erfüllen ist. Stellen wir uns etwas vor, das das Pareto-Kriterium erfüllen würde: Wäre eine bessere medizinische Versorgung nicht gut für die meisten Menschen? Ja, aber einige müssten mehr für die Krankenversicherung zahlen und würden Einwände erheben. Wäre es nicht gut für viele Menschen, wenn sie wie durch ein Wunder plötzlich aufhören könnten, Drogen zu konsumieren? Ja, aber die Drogenproduzenten und -händler (die schließlich ebenfalls Personen sind) würden verlieren, weshalb sie Widerstand leisten würden. Würde es uns nicht gefallen, niedrigere Steuern zu zahlen? Ja, aber dann müssten die staatlichen Sozialleistungen gekürzt werden, und die Betroffenen würden sich zur Wehr setzen. Wir können die Liste unendlich fortsetzen. So sehr wir uns auch bemühen, eine pareto-optimale Politik ist unmöglich. Und nicht nur das: Eine solche Politik ist eine Garantie für Stillstand und Untätigkeit, vor allem aber für die Aufrechterhaltung der bestehenden Machtstrukturen und Privilegien.
Das bedeutet, dass ein höher entwickelter „Welfarismus“ genauso wenig funktioniert wie seine plumpere Form. Beide scheitern an der Unfähigkeit, den Nutzen für die einzelnen Personen zu vergleichen. Das Ergebnis ist, dass sie von sehr begrenztem Nutzen sind, wenn wir versuchen, alternative soziale Ordnungen miteinander zu vergleichen.15 Daher ist es schwierig, eine Theorie der Gerechtigkeit sozialer Ordnungen auf dem Utilitarismus oder dem Welfarismus aufzubauen. Jeremy Bentham und John Stuart Mill, die Väter des Utilitarismus, glaubten, eine „objektive“ Methode für den Vergleich verschiedener Gesellschaftsordnungen entdeckt zu haben. Aber dieses Vorhaben dürfte illusorisch sein.
Auf den Ruinen des utilitaristischen Traums wurde der anspruchsvollste neuere Versuch unternommen, wirtschaftliche Ungleichheit und Gerechtigkeit miteinander in Einklang zu bringen: John Rawls, der die politische Philosophie im 20. Jahrhundert prägte, formulierte in seinem 1971 erschienenen Buch A Theory of Justice* das gefeierte „Unterschiedsprinzip“ und erklärte, eine Abweichung von der Gleichheit sei nur zu rechtfertigen, wenn sie erforderlich sei, um das absolute Einkommen der Ärmsten zu erhöhen. Der Ausgangspunkt ist also die vollkommene wirtschaftliche Gleichheit aller Bürger. Jede Ungleichheit muss gerechtfertigt werden. Diese Theorie war eine radikale Abkehr vom Utilitarismus. Rawls erklärte unmissverständlich:
Ohne starke und beständige altruistische Motive würde kein vernünftiger Mensch eine Grundstruktur akzeptieren, nur weil sie die Summe der Annehmlichkeiten für alle zusammengenommen erhöht – ohne Rücksicht auf ihre dauernden Wirkungen auf seine eigenen Grundrechte und Interessen. Das Nutzenprinzip scheint also unvereinbar zu sein mit der Vorstellung gesellschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Gleichen zum gegenseitigen Vorteil, mit dem Gedanken der Gegenseitigkeit, der im Begriff einer wohlgeordneten Gesellschaft enthalten ist.16
Rawls verknüpfte Ungleichheit und Ungerechtigkeit in einem brillanten Satz: „Ungerechtigkeit besteht demnach einfach in Ungleichheiten, die nicht jedermann Nutzen bringen“, wobei er mit „jedermann“ insbesondere die Armen meinte, wie er einige Absätze später klarstellte.17 Obwohl Rawls Ungleichheit und Ungerechtigkeit untrennbar miteinander verknüpfte und erklärte, die Anwendung seines „Differenzprinzips“ werde zu einer relativ geringen Streuung der Einkommen führen, da viele Arrangements, welche die Reichen bevorzugen, keinen absoluten Vorteil für die Armen mit sich bringen, ist das Prinzip grundsätzlich mit breit gefächerten Varianten der Ungleichheit vereinbar. Es kann eine einigermaßen strikte Gleichheit bedingen, wenn das Einkommen der Reichen nicht steigen muss, um das Einkommen der Armen zu erhöhen. Aber es kann auch zu einer sehr ausgeprägten und wachsenden Ungleichheit führen, wobei den Reichen ein unverhältnismäßig hoher Anteil an den zusätzlichen Erträgen zugestanden wird, solange das Einkommen der Armen ebenfalls – wenn auch nur geringfügig – steigt.18
Messung der Ungleichheit. Die Faszination, die der Utilitarismus auf die Ökonomen ausgeübt hat, hat sich indirekt auch auf einen weiteren Bereich ausgewirkt, der mit der wirtschaftlichen Ungleichheit zu tun hat, nämlich auf ihre Messung. Ursprünglich war die Messung der wirtschaftlichen Ungleichheit auf die einfache axiomatische Aufgabe beschränkt, einen akzeptablen Maßstab zu finden, um die Ungleichverteilung mit einer einzigen Zahl auszudrücken. Die Schlüsselaxiome sind leicht verständlich. Findet beispielsweise ein Einkommenstransfer von einer reicheren zu einer ärmeren Person statt und bleiben alle anderen Variablen unverändert,19 so sollte das Maß der Ungleichheit sinken. Wenn zwei Personen die Positionen tauschen, sollte das Maß unverändert bleiben (das sogenannte Anonymitätsprinzip). Wenn alle Einkommen mit einer Konstante multipliziert werden, sollte sich das Maß nicht ändern, und so weiter.20 Die Messung war eine rein technische Angelegenheit, die sich nicht von der Messung der Temperatur unterschied. Aber die Verfechter des vorherrschenden welfaristischen Ansatzes zogen es vor, in diesen Maßen den Ausdruck einer tieferen, auf der Wohlfahrt beruhenden Idee zu sehen. Die Schwierigkeiten des Welfarismus werden offenkundig, wenn wir beispielsweise das richtig definierte und sehr vernünftige Anonymitätsprinzip betrachten. Um dieses einfache technische Erfordernis mit dem Welfarismus in Einklang zu bringen, muss man die vollkommen unrealistische Vorstellung akzeptieren, dass alle Personen dieselbe Nutzenfunktion haben. Ist dies nicht der Fall, so können unter dem Gesichtspunkt der Erzeugung von Nutzen keine zwei Personen gleich sein: Eine Person, die reichlich Nutzen erzeugt, kann nicht problemlos durch eine lethargischere Person ersetzt werden, der das schwerer fällt.
Die Spannung zwischen einer axiomatischen Messung der Ungleichheit und ihrer welfaristischen Interpretation war von Anfang an zu erkennen. Der italienische Ökonom und Statistiker Corrado Gini, der das am häufigsten verwendete Maß der Ungleichheit entwickelte (dazu später mehr), beschrieb dieses Dilemma schon im Jahr 1921:
Die Methoden der italienischen [anti-welfaristischen] Autoren […] sind nicht mit der von [dem für die welfaristische Argumentation bedeutsamen englischen Ökonom] Dalton zu vergleichen, […], da ihr Zweck darin besteht, nicht die Ungleichheit des wirtschaftlichen Wohlergehens, sondern die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen zu schätzen, unabhängig von allen Hypothesen zu den funktionalen Beziehungen zwischen den Mengen und dem wirtschaftlichen Wohlergehen oder zur Summierbarkeit des wirtschaftlichen Wohlergehens der Individuen.21
Die welfaristische Methode, die sich lange Zeit einiger Beliebtheit unter den Ökonomen erfreute, ist in jüngster Zeit in die Kritik geraten, weil sie keine klaren und anwendbaren Schlüsse ermöglicht (weil sie keine Antworten auf die Frage „Welcher Zustand ist vorzuziehen?“ gibt) und weil ihr Fundament – der Utilitarismus – philosophisch unsolide ist.
Eine zentrale Frage ist, wie wir bei der Messung der Ungleichheit vorgehen sollen. Um die Ungleichheit zu messen, brauchen wir repräsentative und randomisierte Haushaltserhebungen. Diese liefern detaillierte Einkommensdaten für alle in der Studie erfassten Haushalte, und da davon auszugehen ist, dass die Ergebnisse repräsentativ für die Situation einer großen Gemeinschaft (im Allgemeinen der gesamten Gesellschaft) sind, können sie auf das ganze Land extrapoliert werden. Wir können auch Steuerdaten verwenden, aber diese werden selbst in den hochentwickelten Ländern, in denen die meisten Leute direkte Steuern zahlen, nur eine unvollständige, weil abgeschnittene Verteilung liefern: Die Armen, die keine Steuern zahlen, werden in diesen Statistiken nicht erfasst. Die Volkszählungen, die im Prinzip die gesamte Bevölkerung eines Landes beinhalten, können wir nicht verwenden, weil sie zu umfassend sind, um sehr tief zu gehen: Sie erfassen nur grundlegende Informationen wie Alter, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Wohnort und dergleichen, verraten jedoch nichts über Einkommen oder Konsum.
Das Problem mit den Haushaltserhebungen ist jedoch, dass selbst für die meisten entwickelten Länder erst ab dem Zweiten Weltkrieg Daten vorliegen. Es gibt einige unvollständige englische Erhebungen aus dem 19. Jahrhundert sowie im frühen 20. Jahrhundert erhobene Statistiken aus den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion, aber von zuverlässigen und brauchbaren Daten können wir erst ab den frühen fünfziger Jahren sprechen. (Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass Paretos Spekulationen auf Steuerdaten beruhten und dass sich Kuznets auf ein knappes Dutzend Erhebungen stützen musste – und das noch im Jahr 1955.)
Noch schlechter ist die Datenlage in den Entwicklungsländern. Oft gibt es für die Zeit vor den siebziger oder sogar achtziger Jahren überhaupt keine Daten. Das gilt insbesondere für die afrikanischen Länder, wo Haushaltserhebungen erst in den achtziger Jahren eingeführt wurden (oft mit Unterstützung internationaler Organisationen).22 Und wie sieht es in den beiden bevölkerungsreichsten Ländern der Welt aus? Indien begann im Jahr 1952 mit umfassenden Erhebungen und geht bis heute weitgehend nach demselben Muster vor. In China wurde die erste Erhebung nach der Kulturrevolution im Jahr 1978 durchgeführt, aber die ersten brauchbaren Daten stammen aus dem Jahr 1980. Dazu kommt, dass nicht alle Länder jährlich Erhebungen durchführen: Einige sammeln nur alle zwei Jahre, manche sogar nur alle fünf Jahre Daten. Was bedeutet das alles? Erstens: Sieht man von der Gruppe der hochentwickelten und reichen Länder ab, so würde es uns sehr schwer fallen, auf der Grundlage der Haushaltserhebungen eine jährliche Datenreihe zur Ungleichheit zusammenzustellen. Zweitens: In den meisten Ländern können wir erst ab den sechziger, siebziger oder achtziger Jahren etwas über die Entwicklung der Ungleichheit sagen, und auch dann nur mit lückenhaften Datenreihen.
In den Haushaltserhebungen werden zahlreiche Informationen gesammelt, aber uns interessieren hier nur die Daten zu Einkommen und Konsum. Jeder Haushalt wird als „Einkommenseinheit“ oder „Konsumeinheit“ betrachtet, und Einkommen und Konsum werden allen Mitgliedern eines Haushalts zu gleichen Teilen zugerechnet. Wie können wir das Einkommen der einzelnen Haushaltsmitglieder bestimmen? Wir nehmen das jährliche Gesamteinkommen des Haushalts (indem wir die Beiträge der einzelnen Mitglieder addieren) und teilen es durch die Zahl der Personen, die in diesem Jahr in dem Haushalt lebten. So erhalten wir das Pro-Kopf-Haushaltseinkommen, das ein Schlüsselkonzept ist, weil uns sein Betrag erlaubt, die Haushalte und ihre einzelnen Mitglieder abhängig von ihrem Einkommen einzustufen und zu entscheiden, welche von ihnen als arm und welche als reich zu betrachten sind.23
Warum wollen wir das Pro-Kopf-Einkommen messen? Es gibt ein philosophisches und ein praktisches Argument für diese Vorgehensweise. Das philosophische lautet, dass wir alle Individuen gleich behandeln sollten. Würden wir alle Haushalte gleich behandeln, so würden Personen in sehr großen Haushalten individuell sehr viel weniger zählen als Personen in kleinen Haushalten. Wenn das Gewicht – die Bedeutung in einer Rechnung – jedes Haushalts 1 ist, dann hat jedes Mitglied eines vierköpfigen Haushalts ein implizites individuelles Gewicht von ¼, während ein Mitglied eines Zwei-Personen-Haushalts ein Gewicht von ½ hat. Das praktische Argument lautet, dass Ungleichheitsmaße, die nicht auf dem Pro-Kopf-Einkommen, sondern auf dem Gesamteinkommen der Haushalte beruhten, irreführend wären. Der Grund dafür ist einfach. Nehmen wir an, wir hätten zwei Haushalte mit dem gleichen Einkommen, einen mit zwei und einen mit zehn Mitgliedern. Welcher der beiden ist wirtschaftlich besser gestellt? Die Antwort liegt auf der Hand.
Der Einfachheit halber sprechen wir im Allgemeinen von Einkommensverteilungen, selbst wenn sich die Daten auf den Konsum beziehen. Aber die beiden sind nicht gleichwertig. Einkommensdaten werden fast immer eine größere Ungleichheit zwischen den Haushalten in einer gegebenen Gruppe zeigen als Konsumdaten. Dafür gibt es zwei einfache Gründe: Erstens gibt es viele Personen mit einem Jahreseinkommen von null, die ihre laufenden Ausgaben beispielsweise aus in der Vergangenheit angehäuften Ersparnissen finanzieren. (Man denke an Studenten, die ihre Studienjahre mit Geld finanzieren, das sie in einer Berufstätigkeit verdient haben.) Offenkundig gibt es keine Personen mit einem jährlichen Konsum von null. Die Folge ist, dass die Verteilung entsprechend dem Einkommen am Boden „in die Länge gezogen“ und damit ungleicher wird (die Konsumverteilung wird bei einem für das Überleben notwendigen Mindestbetrag „abgeschnitten“). Es gibt viele einkommensstarke Person, die einen Teil des verdienten Geldes zurücklegen. Ihr Einkommen ist also höher als ihr Konsum. Beim Einkommen wäre das obere Ende der Verteilung ebenfalls weiter in die Länge gezogen. Wenn wir das Einkommen als Maßstab verwenden, fällt die Ungleichheit also größer aus als wenn wir den Konsum verwenden.
Wie können wir nun anhand der Daten zum Haushaltseinkommen die Ungleichheit messen? Das ist keineswegs eine einfache Frage. Stellen wir die Messung der Ungleichheit der Messung des Nationaleinkommens oder des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gegenüber. Das BIP ist eine einfache Summe der Einkommen aller Einwohner eines Landes in einem Jahr: Wir addieren alle Arbeitseinkommen, alle Profite, alle Zinserträge usw. Schließlich erhalten wir eine Gesamtzahl. Wenn wir diese Zahl durch die Gesamtzahl der Einwohner des Landes teilen, erhalten wir das BIP pro Kopf.
Aber die Einkommensverteilung setzt sich aus den Einkommen vieler Personen zusammen, die wir nicht einfach zusammenzählen, sondern miteinander vergleichen wollen – und diese zahlreichen Vergleiche wollen wir in einer einzigen Zahl ausdrücken, welche die Vielfalt der Verteilung richtig widerspiegeln soll. Und hier beginnen die Schwierigkeiten. Eine einzelne Zahl, welche die Verschiedenheit von Einkommen wie 1, 5, 15, 2009 und 34 564 darstellen soll, wird zwangsläufig willkürlich sein. Beispielsweise können wir einfach das Verhältnis zwischen dem höchsten und niedrigsten Wert verwenden (34 564 geteilt durch 1), um die Ungleichheit darzustellen, aber das würde alles unberücksichtigt lassen, was dazwischen liegt. Würde nicht eine Verteilung zum Beispiel von 1, 400, 620, 1009 und 34 564 als ausgewogener betrachtet? Wir können die Ungleichheit messen, indem wir uns nur den Einkommensanteil der Reichsten ansehen: In diesem Fall würden wir 34 564 durch die Summe aller Einkommen (1 + 5 + 15 + 2009 + 34 564 oder 1 + 400 + 620 + 1009 + 34 564) dividieren.24 Tatsächlich wird das bei einem Maß der Ungleichheit getan, nämlich beim Einkommensanteil der Reichsten. Die Zahl der Optionen ist praktisch unbegrenzt.
Eine Möglichkeit, die Zahl der Optionen zu verringern, besteht darin, als wünschenswerte Eigenschaft festzulegen, dass das Maß der Ungleichheit Informationen über sämtliche Individuen beinhalten sollte, die Bestandteil einer gegebenen Verteilung sind. Das bedeutet, dass Information über ein Einkommen von 1 sowie über ein Einkommen von 5 bis hinauf zum höchsten Einkommen von 34 564 berücksichtigt werden sollte. Ein solches Maß der Ungleichheit – das obendrein das beliebte ist – ist der sogenannte Gini-Koeffizient, benannt nach dem italienischen Statistiker und Ökonomen Corrado Gini, der ihn im Jahr 1914 entwickelte (und dessen Leben sich teilweise mit dem von Pareto überschnitt).25 Um den Gini-Koeffizienten zu ermitteln, wird das Einkommen jeder einzelnen Person mit dem aller anderen Personen verglichen, und die Summe all dieser bilateralen Einkommensunterschiede wird dann wieder durch die Zahl der Personen, deren Einkommen in die Berechnung einfließt, sowie durch das Durchschnittseinkommen der Gruppe geteilt. Das Endresultat ist ein Koeffizient zwischen 0 (alle Personen in einer Gruppe haben dasselbe Einkommen, womit völlige Gleichheit herrscht) und 1 (das gesamte Einkommen einer Gruppe fließt einer einzigen Person zu). Dies ist ein sehr angenehmes Merkmal: Der Koeffizient ist „nach oben begrenzt“, denn 1 ist die maximal mögliche Ungleichheit. Hier haben wir eine zuverlässige Methode, verschiedene Niveaus der Ungleichheit miteinander zu vergleichen.
Sowohl ein Gini-Koeffizient von 0 als auch einer von 1 ist natürlich vollkommen unrealistisch: Es gibt kein Land auf der Erde, in dem alle Menschen dasselbe Einkommen beziehen, und es gibt kein Land, in dem eine einzige Person das gesamte Einkommen des Landes bezieht (womit alle anderen Einwohner dieses Landes verhungern würden). Im wirklichen Leben liegt der Gini-Koeffizient in den egalitärsten Ländern – Beispiele sind die skandinavischen Länder, Tschechien und die Slowakei – zwischen 0,25 und 0,3 und erreicht in Ländern mit besonders ausgeprägter Ungleichheit – so etwa in Brasilien und Südafrika – Werte um 0,6. Manchmal wird der Gini-Koeffizient in Prozentpunkten ausgedrückt: Anstatt zu sagen, das Land X habe einen Gini-Koeffizienten von 0,43, können wir auch sagen, dass die Ungleichheit bei 43 Gini-Punkten liegt. Diese Maßeinheit verwende ich auch in diesem Buch.
Wo können wir die Vereinigten Staaten einordnen? Nun, sie zählen zu den entwickelten Ländern mit der höchsten Ungleichheit. Während die meisten Länder der Europäischen Union für sich genommen einen Gini-Koeffizienten von 30 bis 35 Punkten haben (in Skizze 3.3 werden wir sehen, dass es für die Gemeinschaft als ganze etwas anders aussieht), kommen wir für die Vereinigten Staaten auf mehr als 40 Gini-Punkte. Das ist nicht immer so gewesen. Ende der siebziger Jahre sank die Ungleichheit in den USA auf einen Tiefstwert von etwa 35 Gini-Punkten.26 Von da an nahm sie in den vier Präsidentschaften vor Obama (unter Reagan, Bush senior, Clinton und Bush junior) stetig zu. Die Ungleichheit in den Vereinigten Staaten wurde in dieser Zeit deutlich größer, wie jeder weiß, der in dieser Zeit dort gelebt hat. Da der GiniKoeffizient ein träger Maßstab ist, sind sogar Anstiege von ein bis zwei Punkten pro Jahr bedeutsam. Normalerweise, das heißt ohne nachhaltige Zu- oder Abnahme der Ungleichheit, bewegen sich die jährlichen Bewegungen innerhalb eines Gini-Punkts.
Wie sieht es in anderen Ländern aus? Schweden, das als Inbegriff eines egalitären Landes gilt, hat einen Gini-Koeffizienten von etwa 30, während der Wert für Russland, das sich noch nicht vom Kommunismus erholt hat und von Oligarchen beherrscht wird, über 40 liegt. Dasselbe gilt für China. Sowohl in Russland als auch in China hat die Ungleichheit – wie in den Vereinigten Staaten – in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich zugenommen. In Lateinamerika und Afrika kommen die wenigsten Länder auf weniger als 50 Gini-Punkte. In den asiatischen Gesellschaften ist der Reichtum im Allgemeinen ungleich verteilt, aber es gibt einige Ausnahmen. Japan, Südkorea und Taiwan scheinen ein wenig egalitärer zu sein, während die Gini-Koeffizienten für Malaysia und die Philippinen ähnlich hoch sind wie für die lateinamerikanischen Länder. Wenn wir uns die Weltregionen ansehen, stellen wir fest, dass die Ungleichheit in Lateinamerika besonders ausgeprägt ist, gefolgt von Afrika und Asien. Am geringsten ist die Ungleichheit in den reichen und in den postkommunistischen Ländern, wenn man von den beiden Ausnahmen der Vereinigten Staaten und Russlands absieht, in denen ein relativ hohes Maß an Ungleichheit herrscht.
Wenn wir einen anderen Blickwinkel wählen, stellen wir fest, dass vier große ökonomisch-politische Räume – die Vereinigten Staaten, die Europäische Union, Russland und China – alle etwa dasselbe Maß an Ungleichheit aufweisen: Es wirkt fast unheimlich, dass sie alle einen Gini-Koeffizienten von etwas über 40 haben. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind Gegenstand der Skizze 3.3, mit den Besonderheiten der russischen Einkommensverteilung beschäftigen wir uns in den Skizzen 1.4, 1.5 und 1.8, und China und seine Zukunft sind Thema der Skizze 1.9.
Wir können die Gini-Werte zerlegen, um festzustellen, inwieweit die Ungleichheit auf Unterschiede zwischen den Durchschnittseinkommen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in einem Gebiet (dies ist die „Zwischen-Komponente“) zurückzuführen ist und inwieweit sie mit der Veränderung der persönlichen Einkommen innerhalb der einzelnen Bevölkerungsgruppen (der „Innerhalb-Komponente“) zu erklären ist. Nehmen wir zum Beispiel die Europäische Union oder die Vereinigten Staaten und ihre jeweiligen Bestandteile, das heißt Länder wie Spanien und Frankreich oder Staaten wie Maine und Oregon. Oder nehmen wir ein Land wie China und seine Provinzen Sichuan, Yunnan, Hunan und so weiter, oder ein kleineres Land wie Italien und seine Regionen Lombardei, Ligurien und Sizilien. Die Interpretation der Zwischen-Komponente ist einfach: Ist sie groß, so ist der Großteil der Ungleichheit auf die Tatsache zurückzuführen, dass das untersuchte Gebiet arme und reiche Teile hat. Ist der Anteil der „Innerhalb-Komponente“ groß, so muss die geographische Ungleichheit zwischen den verschiedenen Teilen des Gebiets gering sein, aber jeder Teil muss aus sehr unterschiedlichen, das heißt aus reichen und armen Personen bestehen. Sehen wir uns an, was passiert, wenn wir diese Betrachtungsweise auf die globale Ungleichheit anwenden: Die Zwischen-Komponente würde sich auf die Ungleichheit aufgrund der unterschiedlichen Durchschnittseinkommen in verschiedenen Ländern beziehen, die Innerhalb-Komponente auf die Ungleichheit zwischen den Einkommen der Bewohner der einzelnen Länder. Wir werden die Komponenten immer wieder trennen (zum Beispiel in den Skizzen 1.8, 1.9, 3.2 und 3.3), weil diese Aufgliederung sehr gut geeignet ist, um einen Blick auf die Ursachen der gemessenen Ungleichheit zu werfen. Das ist wichtig, weil die unterschiedlichen Arten von Ungleichheit sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Politik haben.
* Deutsch als Das Elend der Armut: Über den Pauperismus (2007).
* Deutsch als Eine Theorie der Gerechtigkeit (1975).