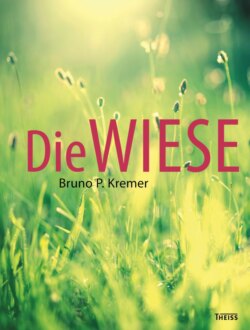Читать книгу Die Wiese - Бруно П. Кремер - Страница 11
Оглавление|16|2 Wald im Wechsel und Wandel
|17|In allem, was die Natur hervorbringt, ist etwas Bewundernswertes.
Aristoteles (384 – 322 v. Chr.)
In den heutigen Debatten zum Klimawandel, die um so hitziger geführt werden, je weniger die Diskutanten von den beteiligten komplexen Sachverhalten verstehen, übersieht man leicht und ziemlich regelmäßig, dass ein stetiger und wie auch immer bedingter Wandel der wichtigsten Klimaeckdaten während aller Phasen der Erdgeschichte ein völlig normales, bis heute keineswegs prognostizierbares und schon gar nicht vom Menschen (ausschließlich) verursachtes Geschehen war. Allein die Darstellung der Jahresdurchschnittstemperaturen für die jüngsten Abschnitte der Erdgeschichte, in denen von anthropogenen Effekten wie etwa dem (zusätzlichen) Treibhauseffekt überhaupt noch keine Rede sein kann, erinnert durchweg an die ziemlich erratischen Schwankungen aktueller Börsennotierungen. Es trifft nach derzeitiger gesicherter Erkenntnis auch keineswegs vorbehaltlos zu, dass sich klimatische Veränderungen früher langsam und fast unmerklich ankündigten, heute dagegen eher mit kurzfristigen Effekten überraschen. Schon mit den bekannten Dansgard-Oeschger-Zyklen vor etwa 22.000 – 32.000 Jahren sind bemerkenswert kurzzeitig einsetzende bzw. geradezu abrupte und erhebliche Temperaturschwankungen mit Perioden zwischen 500 und 2000 Jahren dokumentiert, ohne dass dafür bislang ein einigermaßen befriedigendes, geschweige denn vollständiges Erklärungsmodell verfügbar wäre. Benannt sind diese Ereignisfolgen nach zwei bedeutenden Klimaforschern, dem Dänen Willi Dansgard (1922 – 2011) und dem Schweizer Hans Oeschger (1927 – 1998). Der Wandel des Klimas ist in der Natur etwas durchaus Beständiges und gar nichts Ungewöhnliches. Panikmache ist überhaupt nicht angesagt.
Szenen aus der Nacheiszeit
Nach geochronologischen Kriterien leben wir gegenwärtig im jüngsten Abschnitt des Quartärs, nämlich im Holozän bzw. in der Nacheiszeit, die fallweise auch Postglazial oder Alluvium genannt wird (vgl. Abb. 2.1). Ihr ging mit Beginn vor etwas mehr als 2 Mio. Jahren das phasenreiche Eiszeitalter (Pleistozän, früher Diluvium genannt) voraus. Tatsächlich lässt sich die gesamte quartärzeitliche Klimageschichte in eine bemerkenswert etappenreiche Folge von einzelnen Eiszeiten (Glazialen) gliedern, deren einzelne Abschnitte jedoch umso unschärfer abzugrenzen oder zu parallelisieren sind, je weiter sie zurückliegen. |18|Innerhalb der Eiszeiten unterscheidet man üblicherweise Stadiale (= Zeiten besonders harscher Temperaturbedingungen mit sinkenden Durchschnittswerten) und Interstadiale (= Phasen mit deutlichem Temperaturanstieg). Grundsätzlich davon zu trennen sind die Interglaziale, wie man die gewöhnlich eingeschalteten längeren Warmzeiten zwischen den einzelnen Eiszeiten nennt. Unsere geologische Gegenwart stellt eine solche Warmzeit dar. Ob sie irgendwann wieder in ein neues Glazial einmünden wird, ist im Blick auf die zurückliegenden Ereignisse durchaus nicht nur des frühen Quartärs sehr wahrscheinlich, wenngleich nicht mit genauem Eintrittsdatum vorhersagbar.
2.1 Vereinfachte geologische Übersicht zur Gliederung der Nacheiszeit: Mit B. P. bezeichnet man die Jahre vor der Gegenwart (before present).
2.2 Angeschwemmtes eemzeitliches Torfstück an einer nordfriesischen Insel
Für unsere Zwecke erscheint es gleichermaßen sinnvoll und ausreichend, lediglich die jüngeren Abschnitte des Holozäns etwas eingehender zu betrachten, weil sie für die Entstehung von Weiden und Wiesen von besonderem Belang sind. Die (vorerst) letzte Eiszeit bezeichnet man nach ihren charakteristischen Ablagerungen in den Sedimentschüttungen zweier ausgewählter Flüsse aus dem räumlichen Umfeld je eines der beiden europäischen Vereisungszentren als Würm-/Weichsel-Glazial. Ihr ging die bisher vorletzte Warmzeit, das Riß-/Würm-Interglazial, voraus, das man nach einem niederländischen Fluss bei Amersfoort auch als Eem-Warmzeit oder einfach als Eem bezeichnet. Sie dauerte etwa von 130.000 – 115.000 vor der Gegenwart und umfasst mit ihren rund 15.000 Jahren Dauer damit einen in etwa genauso langen Zeitraum, wie er uns heute von der letzten Eis- oder Kaltzeit trennt.
Anhand von zahlreichen Pollenprofilen aus eemzeitlichen Mooren (am Boden der südlichen Nordsee lagern beispielsweise Torfe aus Mooren dieser Zeitstellung und werden nach Stürmen nicht selten als bröselige Massen auf den Strand geworfen) sowie von subfossilen Makroresten wie Samen, Früchten, |19|Blättern oder anderen Großresten lässt sich die Vegetation dieser vorletzten Warmzeit erstaunlich genau rekonstruieren. Ein in Sachen Wildpflanzen mit einer gewissen Formenkenntnis ausgestatteter Mensch aus dem 21. Jahrhundert hätte beispielsweise mit den Artdiagnosen der Gehölze in den eemzeitlichen Wäldern des damaligen Mitteleuropas bestimmt keine großen Probleme gehabt: Vertraute Gestalten wie Birken und Hainbuchen sowie Wald-Kiefern hätte er zu Beginn des Eems wahrnehmen können, später gefolgt von Eichen, Ulmen, Hasel, Erle und Eibe. Auch wären ihm Weiden und Wacholder aufgefallen, dazu Sanddorn sowie Stechpalme, hier und da auch Rotbuche, Sommer-Linde und Tataren-Ahorn. Lediglich die damalige Säugetierfauna wäre ihm doch recht ungewohnt erschienen: In zuverlässig eemzeitlich datierbaren Ablagerungen, darunter auch in Höhlensedimenten, finden sich mengenweise Knochen, die eine für die damalige Zeit äußerst typische Waldfauna zeigen: Recht häufig waren etwa Waldelefant, Braunbär, Merck’sches Nashorn, Elch und Riesenhirsch. Überaus erwähnenswert erscheint übrigens das betont wärmebedürftige und im Eem in unseren Breiten sogar bis zu den Britischen Inseln verbreitete Flusspferd. Die damals schon vorkommenden Arten Rothirsch, Damhirsch, Reh und Wildschwein sind dagegen auch in unserer heutigen Landschaft (noch oder wieder) vertreten. Einer der für Nordwesteuropa wichtigsten eemzeitlichen Fundhorizonte befindet sich interessanterweise direkt unter dem Trafalgar Square in London.
2.3 Ähnlich wie die heutigen küstennahen Zwergstrauchheiden muss man sich die von Zwergsträuchern geprägten eiszeitlichen Tundrengebiete in Mitteleuropa vorstellen.
Die fossilen Dokumente zeichnen mithin für das Eem-Interglazial mit seinem durchaus freundlichen Klima ein von den gegenwärtig erlebbaren Wäldern, zumindest hinsichtlich der Gehölzarten, nicht grundverschiedenes Bild. Dieser Landschaftsgesamteindruck änderte sich indessen radikal mit dem Beginn der letzten Eiszeit. Im Gebiet der alpinen Vereisung nennt man sie Würm-Glazial, im Wirkbereich der nordischen Glaziation Weichsel-Eiszeit. In Nordamerika kam es zeitgleich ebenfalls zu ausgedehnten Vergletscherungen; hier heißt die entsprechende Epoche Wisconsin-Glazial. Fachleute untergliedern dieses letzte Glazial in zahlreiche und zeitlich recht gut aufgelöste Stadiale und Interstadiale, deren überregionale zeitliche Verknüpfung dagegen immer noch nicht zufriedenstellend gelungen ist und insofern zum Verdruss aller fortbesteht, die klar strukturierte Tabellen schätzen. Die Aufgabe der Korrelation bleibt somit vorerst eine dringliche Herausforderung an die Quartärgeologie. Für den Alpenraum meinte man übrigens zu Beginn der Eiszeitenforschung gar vier Glaziale und drei Interglaziale erkannt zu haben, in Norddeutschland dagegen nur drei Glaziale mit zwei Interglazialen, was das Verständnis anfänglich zugegebenermaßen arg strapazierte. Dieses allzu |20|einfache Schema ist längst einer reichlich komplexen bis unübersichtlichen Folge von Kalt- und Warmzeiten gewichen. Ein gewisser Konsens besteht indessen heute darüber, dass die Würm-/Weichsel-Eiszeit vor rund 112.000 Jahren einsetzte und rund 100.000 Jahre lang andauerte.
Radikaler Einschnitt
Die Stadiale der Würm-/Weichsel-Eiszeit veränderten das Vegetationsbild (nicht nur) in Mitteleuropa grundlegend: Die im Vergleich zu heute deutlich niedrigeren Jahresdurchschnittstemperaturen, im Verbund mit der nordischen und alpinen Vereisung, verdrängten in unseren Gebieten weitflächig die gesamte Gehölzvegetation. Der eemzeitlich noch so artenreiche und kaum aufgelichtete Wald war jetzt schlicht dahin. Seine Wuchsplätze nahm nunmehr eine baumlose Pflanzendecke ein, die in ihrem Aussehen den heutigen arktischen Tundren bzw. kontinentalen Kältesteppen ähnelte. Weil in diesem Zeitraum bei deutlich gefallenem Meeresspiegel (etwas mehr als 100 m im Vergleich zu heute) die Wassertemperaturen in den europäischen Randmeeren recht tief lagen, konnte nicht so viel Wasser verdunsten wie zuvor – das Klima im gesamten Europa wurde daher zunehmend trockener. Bislang wenig berücksichtigt und noch weniger bekannt, aber enorm folgenreich ist die stark abweichende Luftdruckverteilung während des letzten Glazials: Die Hochdruckgebiete befanden sich damals regulär über dem skandinavischen, zuletzt bis etwa 3000 m mächtigen Eisschild. Sie führten zu andauernden kalten Fallwinden aus nordöstlicher Richtung, die in den überstrichenen Gebieten ebenfalls anhaltende Trockenheit mit sich brachten. Kein Wunder also, dass sich die vorher (nämlich eemzeitlich) in bemerkenswerter Üppigkeit bestehende Zone der laubwerfenden Wälder fast überall komplett auflöste. Im eisfreien Bereich zwischen der nordischen und der alpinen Vereisung – in Deutschland ungefähr zu umreißen mit dem etwa 400 km breiten Mittelgebirgsgürtel zwischen Donau und Ruhr – sah es damals etwa so aus wie in der heutigen nordischen Tundra: Nur eine niedrigwüchsige Vegetation mit Zwergsträuchern vor allem aus der Familie der Heidekrautgewächse konnte neben wenigen anderen Verwandtschaftsgruppen bestehen, wobei zwischen den ostmitteleuropäischen Gebieten und dem Westen bzw. Nordwesten deutliche Unterschiede bestanden.
Zur maximalen Vereisung in der Würm-/Weichsel-Eiszeit kam es interessanterweise erst in ihrem Endabschnitt um etwa 20.000 Jahre vor der Gegenwart. |21|Die Durchschnittstemperaturen lagen in dieser Phase um ca. 12 °C tiefer als heute, und in den Alpen war die Schneegrenze gar um 1400 m gesunken. Dennoch war die Ausdehnung des Eises dieser Glaziation deutlich geringer als in der vorangegangenen Riß-/Mindel-Eiszeit, wie man beispielsweise an der charakteristischen Moränenverteilung in Norddeutschland (mit erheblichen geomorphologischen bzw. landschaftlichen Unterschieden zwischen Jung- und Altmoränenland) ablesen kann.
Gegen Ende der Würm-/Weichsel-Eiszeit setzt nun recht unvermittelt, und in seinen letztlich auslösenden Ursachen immer noch weitgehend unverstanden, ein ziemlich rascher Anstieg der jährlichen bzw. monatlichen Durchschnittstemperaturen ein. Innerhalb von nur etwa 3000 Jahren zerfiel daher unaufhaltsam das weite Netzwerk der nach Norden gerichteten Gletschereisströme aus den großen Alpentälern. Die Gletscher zogen sich dabei nicht einfach zurück, wie man in manchen Schilderungen mitunter lesen kann, sondern sie schmolzen kontinuierlich weg, denn es unterblieb nach und nach die Nachlieferung des abfließenden Eises aus den Höhengebieten, die man in der Glaziologie auch Nährgebiete nennt. Die Eisrandlagen wurden unter dem Zwang der nunmehr höheren Durchschnittstemperaturen immer mehr zu Zehrgebieten. Hier und da blieben einzelne größere Gletscherfragmente als isolierte Toteisblöcke zurück – ihr Schmelzwasser sammelte sich in zuvor per kräftig nagendem Eisschurf ausgehobelten Becken und Senken zu den malerisch anmutenden Seenplatten inmitten der heute angenehm gewellten Hügellandschaft im Küstenhinterland von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bzw. in das lebhaft glaziogen überprägte Voralpenland zwischen Bodensee und Wiener Becken, wo sich ebenfalls zahlreiche und letztlich aus der Eiszeit herrührende Stillgewässer finden (Abb. 2.4).
Das Abschmelzen der ungleich massiveren nordischen Inlandeismasse dauerte übrigens ungleich länger als das Schrumpfen der alpinen Vereisung und kam hier erst vor etwa 9000 Jahren vor der Gegenwart zum vorläufigen Abschluss, was erhebliche Auswirkungen auf die überaus spannende jüngere Entwicklung von Ost- und Nordsee hatte. Von Wiesen und/oder Weiden konnte in diesen Frühphasen des Postglazials indessen überhaupt noch keine Rede sein.
Ihr spezifischer Beitrag zur Landschaftsgestaltung und zu den kalenderblattreifen Ferienlandschaftsbildern konnte erst deutlich später stattfinden.
2.4 In den europäischen Hochgebirgen regiert ab einer gewissen Höhe immer noch die Eiszeit. Im Voralpenland beherrschen dagegen landschaftstypische Grünlandbereiche das Bild.