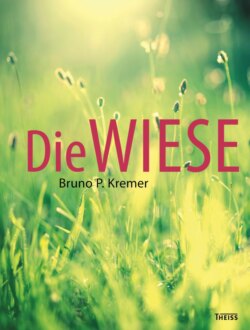Читать книгу Die Wiese - Бруно П. Кремер - Страница 14
|25|Verräterischer Pollen
ОглавлениеDer Ablauf der nach dem Würm-/Weichsel-Glazial spätestens vor etwa 12.000 Jahren einsetzenden Wiederbewaldung Mitteleuropas ist erstaunlicherweise ziemlich genau und sogar mit diversen regionalen Abweichungen detailliert bekannt, obwohl es aus diesem Zeitraum natürlich überhaupt keine schriftlichen Quellen gibt. Als ungewöhnlich ergiebiges Hilfsmittel zur Klärung solcher Fragen erwiesen sich die Pollenkörner der Blütenpflanzen, wie unter anderem der verdienstvolle Göttinger Botaniker Franz Firbas (1902 – 1964) schon um 1950 erkannte und darauf in einer umfassenden zweibändigen Monografie eine bis heute weithin anerkannte erste Gliederung der nacheiszeitlichen Vegetationsentwicklung in Mitteleuropa gründete.
Pollenkörner, bürgerlich auch Blütenstaub oder vereinfacht (der) Pollen genannt, überraschen immer wieder mit ihrer außerordentlich verschiedenartigen und zudem ungemein ansprechenden Form- und Gestaltgebung (Abb. 3.3). Schon den eifrigen Mikroskopikern des frühen 19. Jahrhunderts, die sich erstmals auch im Bereich der Blüten genauer umsahen, blieb dieser bemerkenswerte Sachverhalt natürlich nicht lange verborgen. Auf der Basis dieser enormen Formverschiedenheit entwickelten sich mit der Pollenkornforschung (Palynologie) schon bald besonders ergiebige, weil bemerkenswert aussagestarke Arbeits- und Beobachtungsfelder mit bedeutenden und damals noch kaum abschätzbaren praktischen Anwendungsmöglichkeiten. Der in Bologna wirkende italienische Arzt und bemerkenswert eifrige Naturforscher Marcello Malpighi (1628 – 1694) war nach der Erfindung des zusammengesetzten Mikroskops offenbar der Erste, der bereits um 1675 Blütenpollen als besonders ergiebige pflanzliche Strukturen bzw. Funktionsträger entdeckte und detailliert beschrieb. Schon bald nach ihm regte der ungewöhnliche Formenreichtum von Pollen viele Bearbeiter zu vertiefenden Untersuchungen an. Bereits im frühen 19. Jahrhundert galt es als gesichert, dass die besondere und fast immer spezifische Form der Pollenkörner als außerordentlich hilfreiches und kennzeichnendes Merkmal der Pflanzenbeschreibung zu verwenden ist. Pollenkörner sind sozusagen die spezifischen Ausweise der verschiedenen Pflanzenarten oder zumindest der betreffenden Gattungen. Deren praktische Bedeutung reicht heute von der Lebensmittelanalytik bis zur Forensik. In der immer noch eifrig betriebenen vegetationshistorischen Forschung sind sie gleichsam die Kronzeugen der verschiedenen Pflanzenkleider, die (Mittel-)Europa in der Nacheiszeit bedeckten.
3.3 Die Pollenkörner verschiedener Pflanzenarten unterscheiden sich in Größe und Feinmorphologie erheblich.
3.4 Subfossiles Pollenkorn eines Nadelholzes in einer rund 7000 Jahre alten Torfprobe aus Norddeutschland
Bei den windblütigen Pflanzen verbreitet der abiotische Vektor Wind die Pollenkörner weithin per Luftroute. Zu dieser speziellen blütenökologischen Fraktion gehört glücklicherweise die Mehrzahl der heimischen Waldbäume – Nadelhölzer ebenso wie Laubbäume. Diese produzieren bezeichnenderweise allesamt wesentlich mehr Pollen als die zur Bestäubung von Tieren besuchten Pflanzenarten. So setzt eine einzige ausgewachsene Fichte jährlich tatsächlich etwa 50 Milliarden (!) Pollenkörner an bzw. in die Luft. Würde man die Pollenproduktion nur der mitteleuropäischen Nadelbäume gleichmäßig auf die Fläche Deutschlands verteilen, so kämen immerhin |26|etwa 200 Mio. Pollenkörner auf jeden Quadratmeter. Der Pollen der windblütigen Arten ist daher so gut wie überall gegenwärtig – übrigens auch unverkennbar und zuverlässig ablesbar am gelblichen Pollenniederschlag auf dunklen Autokarosserien, die gerade im Frühjahr allesamt hellgelbe Nuancen annehmen. Superleichter Pollen wird nun über die Luftroute zuverlässig über weite bis sehr weite Strecken verfrachtet. Auf den alpinen Firnfeldern lässt sich sogar der Pollenniederschlag aus den afrikanischen Savannen nachweisen. Der Pollen landet also nicht nur biologischplanmäßig zur Bestäubung auf einer anderen Blüte der gleichen Art, sondern gerät eher unplanmäßig auch auf See- oder Mooroberflächen. Der jährliche Pollenniederschlag auf einem solchen Depot-Ort spiegelt dann also in gewissen Grenzen jeweils den Mengenanteil der im weiteren oder näheren Umfeld vorhandenen windblütigen Arten wider. Der darauf gegründeten Pollenanalyse für die historische Vegetationskunde kommt ein weiterer glücklicher Umstand entgegen: Pollenkörner sind mikrobiell praktisch unzerstörbar: Die überraschend hübsch und variantenreich strukturierte Pollenkornwand besteht nämlich aus dem überaus bemerkenswerten Naturstoff Sporopollenin, und der ist, im Gegensatz zu allen anderen Pflanzenbestandteilen, gegen alle möglichen Zerstörungsattacken fast völlig resistent. Ein Pollenkorn ist trotz seiner Kleinheit nahezu unverwüstlich und überdauert daher unter günstigen Umständen eventuell sogar geologische Zeiträume von mehreren Jahrzehntausenden. Der jeweilige Mengenanteil in natürlichen Pollenfallen wie Stillgewässern oder Mooren dokumentiert somit strikt epochenabhängig die wechselnde Pollenanlieferung über die Luftroute und schreibt damit buchstäblich Vegetationsgeschichte, die man gegebenenfalls viel später nachlesen kann. So ist jede organogene Sedimentfolge letztlich ein äußerst wertvolles Pollenarchiv und eine aufschlussreiche Zeitleiste, die man mit geeigneter Methodik nur zu entschlüsseln braucht.
3.5 Auf Pflanzenorganen landen nicht nur willkommene Bestandteile des Luftplanktons: Auf dem Laubblatt eines Labkrautes fanden sich auch die Sporen eines parasitischen Pilzes ein.
3.6 Das Pollenkorn einer Sternmiere ist auf der bemerkenswert reich strukturierten Narbe einer anderen Pflanzenart gelandet.
Die als eigene Fachwissenschaft innerhalb der Archäobotanik längst etablierte Pollenanalyse etwa von Torfproben ist folglich von enormer Bedeutung einerseits für die Archäologie, aber eben auch für die Rekonstruktion der in die allmähliche Wiederbewaldung einmündenden nacheiszeitlichen Vegetationsentwicklung. Torfmoore und andere schichtenreiche |27|Pollendepots hat man daher zutreffend als Archive der Vegetationsgeschichte bezeichnet, denn die übereinander lagernden Torflagen haben mit ihren wechselnden Pollenspektren die postglaziale Vegetationsentwicklung geradezu minutiös und mitunter sogar jahrgenau festgehalten. Je nach Lage einer Torfprobe im erbohrten oder ergrabenen Profil ist nämlich mit erheblich unterschiedlichen Prozentanteilen der Pollen bestimmter Baumarten zu rechnen.
Während etwa vor 10.000 – 7000 Jahren überwiegend Birke und Kiefer das seinerzeitige Waldbild Mitteleuropas beherrschten und diese beiden Arten folglich mit einem entsprechend hohen Pollenanteil vertreten sind, tritt erst etwa 3000 Jahre vor der Gegenwart die Rotbuche stärker in Erscheinung, die heute unser Waldbild beherrscht. In jüngeren Pollenspektren bilden sich mit den Nichtbaumpollen von Gräsern und Kräutern erwartungsgemäß die großen Rodungsperioden der Römerzeit und des Mittelalters ebenso ab wie der Beginn großer Offenlandkulturen mit Grünlandwirtschaft und Getreideanbau oder die forstliche Verwendung von Nadelhölzern außerhalb von deren natürlichen Verbreitungsgebieten.
Umgekehrt kann man eine Torfprobe allein anhand ihres Pollengehaltes zeitlich relativ genau einordnen. Wenn man in einer bestimmten Torfschicht ein archäologisch relevantes Fundstück findet, kann man fast jahrzehnt- und oft sogar jahrgenau bestimmen, ob es beispielsweise aus der Hasel-Kiefer-Zeit (Mittelsteinzeit), aus der Eichenmischwald-Phase (Jungsteinzeit) oder gar aus frühhistorischer Zeit stammt (vgl. Abb. 3.8). Zusammen mit der Radiokarbon-Methode (14C-Methode), mit der man in organischem Material die Restmengen an radioaktivem und nur zu Lebzeiten des betreffenden Objektes eingebautem Kohlenstoff (14C) bestimmt, oder mit den bewundernswert exakten dendrochronologischen Analysen, welche die Jahrringfolgen von Hölzern minutiös auswerten, kann man anhand der Pollenspektren eine bestimmte Torfprobe (Torfschicht) und damit das Mooralter bzw. einen Fundhorizont erstaunlich genau datieren. Eine wichtige Zeitmarke dazu liefert außerdem der recht genau datierbare, vor rund 13.000 Jahren stattgefundene Ausbruch des berühmten Laacher-See-Vulkans in der Osteifel, denn dessen gewaltige, aus feinsten Ascheteilchen bestehenden Auswurfmassen haben sich damals windbedingt als Fallout-Fächer über große Teile Europas verbreitet und in allen entstehenden Sedimenten eine für die Wissenschaft eindeutige, weil verlässliche isochrone Zeitmarke hinterlassen.
3.7 Der Pollen windbestäubter Pflanzen ist ein Massenwurfgut: Angeschwemmte Pollenmengen an einem Gewässerzufluss.