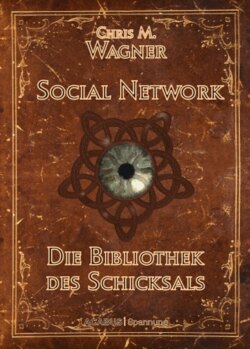Читать книгу Social Network. Die Bibliothek des Schicksals - Chris M. Wagner - Страница 7
KAPITEL 1 – DAS GARN ROLLT
Оглавление1
Die Glocke spielte eine Melodie auf drei unterschiedlich hohen Tönen. Ein uniformiertes Mädchen – schwarzes Kleid, weiße Schürze, weiße Haube – öffnete. „Oh, hallo“, grüßte sie.
Der Besucher – ein älterer Herr, ordentlich gekleidet und mit auffällig grauen Schläfen im dunklen Haar – zwinkerte neckisch. „Leni, hallo.“
Da rief die Haushaltshilfe ins Treppenhaus: „Du hattest recht, Daniel.“
„Er ist also hier.“ Der Besucher verzog abschätzig das Gesicht.
„Rein mit Ihnen, alter Herr.“
„Etwas mehr Respekt, junge Dame“, schäkerte er und deutete mit breitem Grinsen und hochgezogenen Brauen nach draußen. In der Auffahrt parkte ein schwarzer Kombi, die Heckklappe stand offen.
Leni schmunzelte. „Schon unterwegs.“
Eine Mädchenstimme rief: „Daniel hat dich am Gang erkannt, Paps.“ Der ältere Herr nahm die Treppe in den ersten Stock. Ihn empfing eine Unmenge von Kleidern in allen Farben, Formen und Größen. Sie hingen an Schränken, Stühlen und selbst an der Vorhangstange. Es roch nach gebratenem Speck. An einem Tisch in der Mitte des Raumes kämpfte Rosemarie von Wards mit ihrer Nähmaschine.
„Hallo meine Süße“, sagte der Mann.
Rosemarie zog mit jeder Hand an einem Faden, der Dritte hing seitlich aus einem glänzenden Kleid. In Gedanken versunken kaute sie auf der Lippe.
„Wo ist dein legendäres Lächeln?“
Und Rosemarie strahlte.
Typisch Vater. Er konnte ihr in jeder Situation ein Lachen entlocken, auch wenn sie dazu überhaupt nicht in der Stimmung war. Dieses Kleid raubte ihr schon den ganzen Vormittag und nichts ging voran.
Er lachte: „So kenn ich dich.“
„Heute ist nicht ihr Tag“, schmatzte irgendwo eine Männerstimme.
„Jeder Tag ist Rosemaries Tag“, setzte Vater leise dagegen.
Die Haushälterin schnaufte die Treppe hinauf. „Du wirst dich wundern, Rosi.“
„Paps, was hast du wieder mitgebracht?“
„Er sorgt dafür, dass dir die Arbeit nicht ausgeht“, rief die Männerstimme.
Vater verzog mürrisch das Gesicht. „Und er könnte sich mal nützlich machen.“
„Vater“, fiel sie ihm ins Wort. „Das ist meine Sache.“
Rose wusste, so lieb Daniel war – wenn man ihm einen Faden in die Hand gab, bekam man einen Knoten zurück.
Ein sprechender Kleiderberg betrat den Raum. „Schau dir das an.“
Rosemarie schnaufte angestrengt. „Ich hoffe, du findest noch irgendwo Platz.“
Vater ließ sich jedoch nicht abbringen: „Sitzt nur rum und zieht dir das Geld aus der Tasche. Hättest …“
Ein dunkelhaariger Mann, Mitte zwanzig, ausgewaschene Jeans, die Ärmel seines Hemdes knittrig hochgeschoben, betrat den Raum. Er leckte sich die Finger.
„Daniel. Könntest du Leni zur Hand gehen, bitte?“ Rose schenkte ihm ein bezauberndes Lächeln.
Vater griff ihn direkt an: „Glück für dich, dass sie dich gefunden hat.“
Daniel fasste nach den Kleidern. „Ja, Glück.“ In seinen Worten klang es völlig anders – sanft und zufrieden.
„Schicksal, mein Schatz“, widersprach Rosemarie.
„Dann meint’s das Schicksal nicht gut mit dir“, sagte Vater.
Rose verstand es, seine abschätzigen Bemerkungen zu überhören. Er konnte sich nicht damit abfinden, dass sie mit dem gewöhnlichen Jungen von der Straße zusammen sein wollte.
Endlich hatte sie die Fäden entwirrt.
„Das Schicksal ist nicht aufzuhalten“, sagte sie. „Es rollt dahin wie diese beiden Garnrollen.“ Sie warf die Rolle mit dem beigefarbenen Oberfaden auf den Tisch. Das kleine Holzrad drehte sich. Der Faden wickelte sich ab. Dann warf sie die Spule mit dem schwarzen Faden hinterher.
„Es bringt uns hin, wo immer es will.“
Flink drehten sich die beiden Holzrädchen auf das Ende der Arbeitsplatte zu.
2
Ich bin ein guter Mensch. Gerold sagte sich das unentwegt vor. Die letzte Nacht war grausam gewesen. Eine dieser Nächte, die mit der Frage endeten, ob man überhaupt ein Auge zugemacht hatte? Natürlich hat man. Wo sonst waren die Stunden geblieben? Nur die Erholung, die blieb aus.
Er quälte sich vom Blümchensofa und spürte jedes seiner weit über fünfzig Lebensjahre schmerzhaft in den Knochen. Ein Porzellanpüppchen fiel auf den Boden. Die Kleine sah unbeschädigt aus. Sie lächelte noch immer. Natürlich tat sie das. Er war ja auch ein guter Mensch. Auch wenn Kirstin etwas anderes behauptet hatte. Was weiß sie schon, was ich für ein Mensch bin?, dachte er. Im letzten Jahr habe ich selbst Mutter öfter gesehen. Ich hätte auf meine Freunde hören sollen. Liebe zieht einen Grauschleier über die Wahrheit, bis die Erkenntnis zuschlägt. Dann ist man 58 und mit einer 20 Jahre jüngeren Frau verheiratet, die ihre Kreditkarten mehr liebt, als den Mann, der die Konten füttert.
„Ist alles in Ordnung?“, krächzte eine Stimme aus dem Nebenzimmer.
„Ja, Mutter.“
„Ich dachte, ich hätte etwas pumpern gehört?“
„Schlaf weiter.“
Eigentlich wollte er die Wohnung längst verlassen haben, bevor sie aus dem Bett kam. Er hatte keine Lust sich ihre Ratschläge anzuhören. Und ,Das hab ich dir schon immer gesagt‘ wollte er erst recht nicht hören. Gerold war dankbar, dass er gestern Abend bei ihr untergekommen war. Jetzt aber wollte er die Ausnahmesituation beenden und in einen gewöhnlichen Arbeitstag starten. So konnte er sich auf andere Dinge konzentrieren. Und er würde allen zeigen, was für ein guter Mensch er war.
Im Bad roch es nach Frühlingsbrise – oder so, wie die Chemiker eines billigen Aromakonzerns sich den Frühling vorstellten. Er hasste es, unrasiert auf der Station zu erscheinen.
Es klopfte an die Badtür. „Bist du da drin, Gerold?“
Wer sonst pinkelt in dein Klo?
„Bin gleich weg.“
Er strich sich die strähnigen Haare nach hinten und blickte in den Spiegel. Sonst sah er dort noch immer den Draufgänger der 10. Klasse. Doch heute erschienen ihm das Deckhaar besonders licht und die Gesichtshaut fahl und fleckig.
Als er auf leisen Sohlen zur Wohnungstür schlich, wartete die alte Dame mit einem Apfel in der Hand.
„Wir haben eine Kantine“, maulte er.
„Ohne etwas im Bauch geht man nicht aus dem Haus.“
„Mutter. Ich …“ Er zögerte.
Sie presste die Lippen verständnislos aufeinander und atmete laut durch die Nase aus. Er kannte diesen Blick. Darum fügte er sich. Schließlich war sie seine Mutter. Und er war ein guter Mensch.
Als er gestern Abend seinen Wagen direkt vor dem Imbiss geparkt hatte, hatte er nicht damit gerechnet, dass sich sämtliche Handwerker aus der Gegend morgens exakt an dieser Stelle zur Neunuhr-Brotzeit trafen. Vier standen um einen Tisch herum und grölten.
„Entschuldigen Sie. Wissen Sie, wem der Wagen gehört?“ Gerold deutete auf einen windschiefen Kleinlaster, der in zweiter Reihe seinen BMW behinderte.
„Nö“, bekam er zur Antwort. Die anderen drei blickten ausdruckslos drein.
Gerold schaute auf die Uhr. Seit neun erwartete man ihn. Und er saß hier fest. Ein Taxi rollte durch die Straße. Er winkte dem Fahrer zu. Der winkte zurück und fuhr weiter. Verdammt! Am Imbissstand lachte jemand.
Jetzt war’s genug. Er setzte sich in sein Fahrzeug, startete den Motor und trat ausgekuppelt ins Gaspedal. Der Motor heulte auf. Dann drückte er auf die Hupe. Einmal, zweimal, dreimal. Passanten blieben stehen, einer tippte sich an die Stirn. Eine junge Frau klopfte gegen die Seitenscheibe. Er ließ von der Hupe ab.
„Spinner“, sagte sie ihm ins Gesicht.
Es reichte.
Jetzt hämmerte er auf das Lenkrad und ließ nicht mehr von der Hupe ab.
„Was ist denn los?“, rief eine krächzende Stimme von oben. Mutter. Sie soll nur sehen, in was für einer beschissenen Gegend sie wohnt.
Die Handwerker hatten aufgegessen und liefen um Gerolds Wagen herum. Ein breitschultriger Kerl klatschte mit der flachen Hand auf die Motorhaube. „’s ja gut“, brummte er und stieg in den Lieferwagen, die anderen hinterher. Diese Bastarde. Er drückte noch einmal penetrant auf die Hupe. Das haben sie jetzt davon. Warum SIND Leute nur so? Ich bin doch ein guter Mensch!
Jetzt rauschte er durch die kleinsten Gassen. Das war der kürzeste Weg. Es durfte ihm nur niemand vor den Wagen laufen. Wird schon gut gehen.
Beinahe wäre er in einen Motorroller gekracht, der auf seinem Stellplatz geparkt war. „Welches Arschloch …?“, brüllte er und donnerte mit der Faust aufs Lenkrad. Mit quietschenden Reifen setzte er rückwärts auf einen Besucherparkplatz.
Er lief auf die automatische Tür zu, über welcher der Schriftzug: „Klinikum Nord-West“ leuchtete.
„Herr Doktor“, rief eine Stimme, als er auf Station 2b aus dem Aufzug hastete.
Margit, pfff. Was will die denn?, dachte er und tat so, als hätte er nichts gehört. Er verschwand hinter einer Tür.
Das Büro war beengend. Sein breiter Schreibtisch war mit Ordnern und Büchern überladen und rund um den Drehstuhl lagerten Kisten, gefüllte Akten und Papierberge. Als Stationsleiter musste man selbst nicht mehr Hand anlegen. Damals erschien ihm das als Vorteil. Patienten können unangenehm sein. Doch irgendwann kam er zu der Erkenntnis, dass Dienstpläne stärker an den Nerven zerrten, als Patienten es je getan hätten.
Es klopfte zweimal und schon war die Tür offen. Schwester Margit. Kann die nicht warten, bis ich rufe?
„Herr Doktor Altmann, gut, dass ich Sie erwische.“
Ansichtssache.
„Was ist?“
Die Krankenschwester wirkte gehetzt. Sie zupfte die Uniform zurecht. Vor vielen Jahren hatte ihr Körper noch ausreichend Platz in der Arbeitskleidung gehabt. Doch heute spannte sich der ausgeblichene Stoff über die Rundungen ihres Körpers.
„Lars hat heute seinen letzten Tag.“
„Hmm“, knurrte er. Der Arzt erinnerte sich – die Beurteilung. Seit Tagen schob er das lästige Papier vor sich her. Es war schwer, neutral zu bleiben, wenn man denjenigen nicht ausstehen konnte.
„Meine Aufgabe“, sagte er. „Noch was?“ Er machte sich keine Mühe, seine schlechte Laune zu verbergen.
Die Krankenschwester verschwand wortlos.
Zuerst trödelt der Kerl ein paar Wochen auf meiner Station herum und dann erwartet er von mir nette Worte für seine Zukunft. Der hat sie doch nicht alle. Schickt die alte Margit vor. Ich werd ihm zeigen, was für ein guter Mensch ich bin. So wie ich’s Kirstin gestern gezeigt hab. Geheult hat sie. Aber ich hab mich nicht kleinkriegen lassen. Weil’s mir egal ist. Ich bin ein viel zu guter Mensch, um mich mit IHR rumzuärgern. Und diesem Lars verpass ich eine Abreibung.
Und so rollte die Spule immer näher auf die Kante der Arbeitsplatte zu. Wie ein Fingerzeig deutete der Faden in eine vorbestimmte Zukunft – das Schicksal war vorhersehbar.
3
Ein knallroter Mini-Lkw tuckerte wackelig in die Einfahrt. Der Motor summte hell wie ein Rasenmäher. Die Fahrerkabine stand nur auf einem Rad. Als der Wagen zum Stehen kam, wankte die Ladefläche hin und her. Kurioserweise fielen weder Spaten, Besen, Rechen noch die elektrische Heckenschere oder das Laubgebläse vom Transporter. Die Fahrertür schnappte auf und ein Mann schlüpfte durch die viel zu kleine Öffnung.
Sergio zog den überdimensionalen Schlüsselbund aus der Hose. Er wusste sofort, welcher Schlüssel sperrte. Schließlich gehörte der Rundgang zu seinen täglichen Aufgaben, egal ob das Objekt derzeit bewohnt war oder nicht.
„Madame … Sergio hier“, rief er. Keine Antwort. Trotzdem klopfte er an die Toilettentür, bevor er öffnete. Geübt huschte sein Blick durch den Raum – Rohre, Boden, alles trocken. Dann schloss er die Tür sorgsam. Wie wichtig es war, alle Türen geschlossen zu halten, hatte er vor kurzem in der Tageszeitung gelesen: Drei Kinder und die Mutter – verbrannt. Hätte nicht passieren müssen, wären alle Türen geschlossen gewesen. Brandschutz.
Die Küche mit dem zentralen Kochbereich, das weitläufige Wohnzimmer und die Räume im ersten Stock: Schlafzimmer, Büro und das Zimmer mit den vielen Stoffen – überall dasselbe Muster: Klopfen, Tür auf, Kontrolle und Tür wieder zu.
Zuletzt betrat er den Durchgang zu den Kellerräumen. Sergios Kunden hatten großes Vertrauen in den Hausmeister. Aus dieser Zuversicht entsprangen die Empfehlungen, die seinen Lebensunterhalt sicherten. Das war ihm durchaus bewusst. Und so ging er seiner Arbeit äußerst gewissenhaft nach.
Sergio wunderte sich nicht über die unverschlossene Kellertür. Schließlich lag es in seiner Verantwortung abzuschließen. Darauf konnten sich seine Kunden verlassen – und so überließen viele das Abschließen am Abreisetag vertrauensvoll Herrn Garcia-Álvarez.
Er wunderte sich auch nicht, dass das Kellerlicht brannte. Die jährliche Stromrechnung lag in seinem Aufgabenbereich. Ein paar Euro hin oder her interessierten die Kunden nicht. Wichtig war, dass das Licht funktionierte, wenn es draußen dunkel war. Ausschalten konnte es Herr Garcia-Álvarez.
Schritt für Schritt stieg er die Betonstufen hinab. Sie waren ihm schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Rutschig und viel zu schmal konnten sie leicht zur Gefahr werden. Er kam nur langsam voran. Irgendwann würde er auf den Stiegen ausrutschen und hilflos in Frau von Wards Keller liegen. Tagelang würde ihn niemand finden. Das Anwesen lag einsam; das Nachbarhaus war zwei Kilometer entfernt. Und der Einzige, der regelmäßig nach dem Rechten sah, war Herr Garcia-Álvarez.
Der Elektroraum. Ein kurzer Blick auf die Sicherungen – alles in Ordnung.
Was er nicht bemerkte, war der Lichtstrahl, der unter der Tür des Heizungskellers hindurch schien, nachdem er abgesperrt hatte. Frau von Wards nutzte die Wärme der Warmwasserrohre, um Stoffe zu trocknen, die sie frisch gewaschen für ihre Arbeit benötigte. Darum kümmerte sie sich selbst.
Es kann sein, dass er ihre zarte Stimme hätte hören müssen, als er den Keller bereits verlassen und sorgfältig abgeschlossen hatte.
„Herr Garcia, sind Sie das?“
Später würde man sich wundern, wieso der Hausmeister an den Folgetagen das Anwesen nicht betreten hatte. Und er würde eine aufregende Geschichte zu erzählen haben: Wie die Polizei ihn hinter Schloss und Riegel brachte, weil ein Kunde aufgrund von Indizien Herrn Garcia-Álvarez des Kunstdiebstahls verdächtigte; nur er kannte den Code zur Alarmanlage.
Es würde zwei Jahre dauern, bis Sergio seinen Beruf aufgeben müsste, da sein kurzer Aufenthalt in der Untersuchungshaft für seine Kunden langfristig gesehen nicht mehr tragbar wäre. Dann würde man ihn an der Costa del Sol wiederfinden – abends, wenn die Menschen verschwunden waren und die Schirme verrückt werden mussten.
Und so fiel die Garnspindel über die Tischkante und riss am schwarzen Faden, noch bevor das zweite Holzrädchen seinen Weg vollendet hatte.
4
Eine Tür knallte. Jemand murmelte: „Arschloch.“
Mit festen Schritten stampfte der Pfleger durch Station 2b. Zwei lange Monate hatte er sich mit jedem gut gestellt, zu keiner Schicht NEIN gesagt, ist Personal und Patienten in den Arsch gekrochen und das alles in der Überzeugung, er würde mit einer ordentlichen Beurteilung hier rausgehen. Mehr wollte er nicht. Kein Geld, kein Schulterklopfen – nur respektable Zeilen auf einem bescheuerten Blatt Papier. Schließlich muss er damit hausieren gehen. Doch wer wird ihn schon einstellen, wenn er sich FÜR ALLES ZU VIEL ZEIT nimmt?
Lars irrte durch den Flur. Seine Gedanken spielten verrückt. Er war ein sorgfältiger Mensch. Und das hatte er auch zu lesen erwartet: SORGFÄLTIG und nicht FÜR ALLES ZU VIEL ZEIT. Sein Magen rebellierte.
Die große Schwingtür öffnete sich und ein leeres Krankenbett rumpelte hindurch, Schwester Margit hinten nach.
„Klar nehme ich mir Zeit“, brüllte er sie an. „Bin doch kein Pfuscher.“
Die Oberschwester riss entsetzt die Augen auf.
„Ihr könnt mich mal, der ganze Scheißladen.“ Er stampfte über den Flur. „Bin froh, wenn ich keinen von euch mehr sehen muss.“
Margit löste sich aus der Schreckstarre. „Lars. Was ist?“
Eine Tür schlug ins Schloss und der Pfleger war ins nächste Patientenzimmer verschwunden.
Hier lag eine junge Dame. EXSIKKOSE stand auf dem Schildchen am Krankenbett. Aber das interessierte Lars nicht mehr. Warum war er überhaupt noch hier? Für ihn war die Sache erledigt.
AKUTE DEHYDRATION konnte man lesen, wenn man genauer hinsah. Aber Lars sah nicht hin. Wozu auch? Er würde sich keine Zeit mehr nehmen – nicht in diesem Scheißladen.
An einem normalen Arbeitstag wäre ihm sofort aufgefallen, dass die Infusionsnadel aus der Vene der bewusstlosen Patientin gerutscht war. Nicht heute.
So rollte auch die zweite Spule über die Tischkante und zog ihren Faden hinten nach. Das Schicksal hatte entschieden.
Ein geheimnisvoller Besucher trottete am Krankenzimmer vorbei. Er war wie ein Priester mit einem Kollarhemd, dunkler Hose und einem schwarzen Kollarkragen gekleidet. Er blieb stehen. Lächelnd. Beinahe könnte man annehmen, er wüsste, was in Zimmer 2011 vor sich ging. Als hätte er es schon vorher gewusst – gewusst, wann die Spulen fallen.
5
Ein junger Mann stolperte aus dem Aufzug. Schneeflocken hingen in seinen Haaren. Trotz der dichten Verwehungen draußen kam nicht oft jemand bis in die chirurgische Abteilung, der aussah, als herrschte das Unwetter auch im Fahrstuhl. Schwester Margit schüttelte den Kopf. Es war ihr Boden, auf den das Wasser von seinen Haaren tropfte. Im Geiste sah sie sich schon gestürzte Patienten versorgen und mit dem Wischmob retten, was zu retten war.
„Nein“, rief sie in einem Tonfall, der jedes Lebewesen im Umkreis von 50 Metern innehalten ließ – zu Recht. Mittlerweile war sie die herrschende Kraft auf 2b. Und das hatte jeder hinzunehmen, der die Station betrat; egal ob Mitarbeiter, Patient oder Besucher.
Verunsichert zog der junge Mann einen Papierfetzen aus der Hosentasche. „2011. Bin ich da richtig?“ Er machte einen verstörten Eindruck.
„Ich sag Ihnen was. Da ist die Toilette. Sie trocknen sich ab und dann reden wir weiter.“ Erwartungsvoll betrachtete sie den Besucher. Er rührte sich nicht. Seine Augen waren glasig, die Unterlippe zitterte.
„Frau von Wards. Geht’s ihr gut?“, flüsterte er.
Jetzt packte sie der Stolz.
„Auf meiner Station bekommt jeder Patient die Behandlung die er …“
„Wo liegt sie?“, schrie er. Offensichtlich war er einem Nervenzusammenbruch nahe. Der Schnee war geschmolzen und das Wasser lief aus den langen Haarsträhnen in kleinen Rinnsalen über Kopf und Hals des Besuchers.
Irgendwo öffnete sich eine Tür – 2011. Ein hochgewachsener Mann mit grauen Schläfen trat auf den Flur, verfolgt von mehreren geröteten Augenpaaren. Sein Kopf war hochrot.
„Diese Stimme kenne ich“, zischte er und ging geradewegs auf den Besucher zu.
„Wie geht’s ihr?“ Hoffnung klang in seiner Stimme mit.
Da kehrte ihm der Mann aus 2011 den Rücken. „Frau Oberschwester, lassen Sie diesen Kerl entfernen … bitte. Er belästigt uns.“
„Aber … Vater?“
Es war offensichtlich, dass sich die beiden nicht zum ersten Mal begegneten. Routiniert nahm sich Margit die Zeit, ihre Gedanken zu ordnen. Verschiedene Gesichter lugten abwechselnd aus 2011. Sie erinnerte sich an einen Satzfetzen des heutigen Übergabeprotokolls:
2011 räumen. Der Blinddarm möchte ein Einzelzimmer.
Da der junge Mann offensichtlich nicht zur Familie gehörte, war die Entscheidung prompt gefällt.
„Sie hören es. Verlassen Sie die Station.“ Es war ihr nur recht, den tropfnassen Kerl zurück in den Aufzug zu befördern.
„Sag mir doch wenigstens, was los ist!“, sagte er mit zittriger Stimme.
Stumm drehte sich der Mann aus 2011 um. Schwester Margit baute sich neben ihm auf, die Arme verschränkt.
Die beiden Männer sahen sich in die Augen. In 2011 schluchzte jemand. Niemand sprach ein Wort.
Da sackte der Körper des jungen Kerls in sich zusammen; er fiel auf die Knie und brach in Tränen aus.