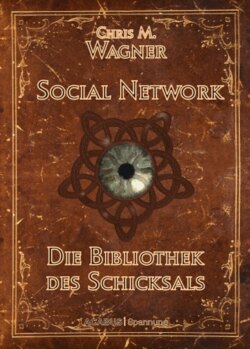Читать книгу Social Network. Die Bibliothek des Schicksals - Chris M. Wagner - Страница 8
KAPITEL 2 – NEBEN DEM SYSTEM
Оглавление1
Jeder Umzugskarton, der im Hänger verschwand, war ein eigener Abschied. Je mehr sich der Anhänger füllte, umso schwerer fiel es dem jungen Mann, weitere Kartons aus dem Wohnhaus zu holen. Schließlich konnte er nicht mehr hinsehen – der Rest seines Lebens, gestapelt in einem einzelnen Anhänger.
Bye-bye Costa del Luz.
Beim Einräumen in München hielten sich die unguten Gefühle zurück. Oder Daniel verstand es, sie zu verdrängen. Er hatte sich keinen Plan zurechtgelegt; alles rein in die Wohnung, egal wie. Ein Zimmer mit Kochnische und Bad – das sollte reichen. Auch sonst hatte er keine großen Ansprüche an sein Umfeld gestellt. Hauptsache er fand einen Platz für den Rechner: Strom, Internet, fertig.
Er schleppte den Bücherkarton zum Treppenhaus. Wie konnte er nur so bescheuert sein und in den 4. Stock ziehen – ohne Aufzug? Das Wohnhaus sah aus, als hätte es sich nachträglich zwischen die beiden Reihenhäuser gezwängt. Der lebenserweckende Narzissenduft aus dem Nachbarsgarten spornte ihn an. Er saugte die Luft in seine Lungenflügel und stapfte die Stufen hinauf.
Oben knallte er die Kiste auf den Boden und wischte mit dem Ärmel den Schweiß aus den Augen. Der Ausblick war angenehm. Viel Zukunft, keine Vergangenheit. Was hält die Stadt für Geheimnisse bereit?, grübelte er, den Blick auf die Straße gerichtet.
Das Namensschild war schon angebracht. Telefon gab es keins. Wozu auch? Egal wie lange er an einem Ort gelebt hatte, er war stets ein Fremder geblieben.
Daniel hob die nächste Kiste aus dem Anhänger. Da plärrte ihm eine Stimme ins Ohr: „Tun Sie doch nicht so.“ Erschrocken drehte er sich um.
Vor ihm stand ein Mädchen, so um die 20, die Hände in die Hüften gestemmt, Brust rausgestreckt. Daniel hatte keine Lust, sich mit irgendwem zu unterhalten, ob er irgendein Halteverbotsschild gesehen hatte oder ob er den Keil in der Wohnungstür lassen durfte. Wortlos ging er an ihr vorbei.
Er betrat das Treppenhaus. Sie folgte ihm.
„Sagen Sie den Männern, von mir gibt’s kein Geld, dass das klar ist.“
Herrgott, was will die?, dachte er. Eine Verwechslung? Er drehte sich um.
„Mein Name ist Lang. 4. Stock. Ab heute.“ Er schob den Karton unter einen Arm und streckte ihr die Hand entgegen.
Sie kippte den Kopf, zog die Lippe hoch und wickelte das schulterlange, blonde Haar um den Zeigefinger. Auf Daniel wirkte sie wie ein trotziges Schulmädchen, das ihn beschuldigte, ihren Füller versteckt zu haben.
„Sie wollen mir also weismachen, in der Kiste sind keine Steuerbescheide?“
„Ganz sicher nicht“, sagte er und wollte schon weitergehen, als das Mädchen mit einer weiteren Behauptung nach ihm schoss: „Ich habe den schwarzen Mann gesehen. Sie können das Versteckspiel sein lassen … Sie sind durchschaut.“
Genug. Er machte eine abfällige Handbewegung und lief kopfschüttelnd die Treppe hinauf.
Kurioserweise blieb es still hinter ihm. Keine Schritte, keine Stimme. Und als er aus dem Fenster sah, war das Mädchen verschwunden.
Am folgenden Morgen wird sich Daniel Lang mit dem Taxi auf den Weg zum Vorstellungsgespräch machen. Doch das Fahrzeug wird niemals ankommen.
2
TODESFALLE KRANKENHAUS
Pannenserie reißt nicht ab. Vater setzte all seine Hoffnungen auf eine deutsche Klinik und musste dafür mit dem Leben seiner Tochter bezahlen.
MÜNCHEN Für das Klinikum Nord-West hat der Tod einer 26-jährigen Patientin ein unangenehmes Nachspiel. Nach Aussage eines Pflegers, wurde die Frau in einem lebensbedrohlichen Zustand eingeliefert, dann aber nur unzureichend überwacht. Nun verklagt ihr Vater die behandelnden Ärzte.
Rosemarie W. (26) war für drei Nächte in einem Heizungskeller in ihrem Haus in Spanien eingeschlossen. Als ihr Vater sie fand, lag sie bewusstlos zwischen Stofflaken und Wäschekörben. Sofort wurde sie auf dem Luftweg in das Münchner Klinikum ausgeflogen und schon auf dem Flug ärztlich versorgt. „Ich dachte, die deutschen Ärzte seien die besten“, sagte der Vater hinterher.
In den letzten beiden Monaten waren bereits 6 Patienten in deutschen Krankenhäusern unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. „Ob man hierfür die Ärzte allein verantwortlich machen kann, oder ob ein Einfluss von außen den Regelbetrieb stört, kann nach dem momentanen Stand der Ermittlungen nicht eindeutig gesagt werden“, erklärte ein Pressesprecher der hiesigen Polizei.
„Die Versicherte ist in einem stabilen Zustand“, heißt es im Einlieferungsprotokoll. Rosemarie W. musste Flüssigkeit zugeführt werden. Alle anderen Werte waren stabil.
Die Patientin wurde auf ein Zimmer gebracht. Laut Angabe des Pflegers wurde sie dort allein gelassen. „Sie nehmen sich nicht genug Zeit für ihre Patienten“, behauptet Pfleger Lars. Zwei Stunden lag die Patientin auf ihrem Zimmer, ohne dass jemandem die lose Infusion aufgefallen wäre. Die lebensnotwendige Flüssigkeit lief auf den Boden. Rosemarie W. starb, ohne ihr Bewusstsein wiedererlangt zu haben.
Rechtsanwalt Adolf Robrov, der die Familie seit Jahren vertritt, wird die Klinikärzte wegen Behandlungsfehlern verklagen. Ob die Staatsanwaltschaft auch Strafanzeige wegen fahrlässiger Tötung stellt, ist noch offen.
Bernd Reismann
3
Die Zeitung wurde geschlossen.
Der Mann schaute wieder auf das Datum. Unmöglich. Heute Morgen wäre er beinahe über den Bollerwagen des Zeitungsjungen gefallen, hätte der das Gefährt nicht in letzter Sekunde unter Richards Füßen weggezogen. Dann griff der Bub in den Stapel und drückte ihm einen Abdruck in die Hand. Und jetzt lag die Februarausgabe vor ihm. Wie kann es einer Druckerei passieren, eine veraltete Zeitung auszuliefern? Wurde sie frisch gedruckt? Oder lagern dort alte Exemplare stapelweise?
Das Boot schaukelte. Irgendwer lief über den Anlegesteg.
Er griff nach seinem Mobiltelefon und wählte eine Nummer. „Vater, hallo … ja, Richard hier.“
Dann kniff er stirnrunzelnd die Augen zusammen und nahm einen Schluck aus der Kaffeetasse.
„Ich wollte dir etwas … tatsächlich?“ Jetzt lauschte er aufmerksam.
Eine junge Frau kletterte die Stufen in die Kajüte hinab. Sie steckte in Matrosenkleidung und trug ein weißes Hütchen in Form eines Papierbootes auf dem Kopf. Auf der Kopfbedeckung konnte man WARDS AM SEE … YACHTRESTAURANT lesen. Sie positionierte sich neben Richard und nahm die Hände hinter den Rücken.
Er riss die Augen auf. „Nicht wahr! Wie bei mir! Das kann kein Zufall sein. Hast du ihn gelesen?“
Am anderen Ende der Leitung wurde gesprochen. Richard konnte es kaum fassen. Auch sein Vater hatte heute diese falsche Ausgabe in der Tagespost.
„Das ist kein Zufall. Jemand möchte uns etwas mitteilen.“
Während sein Vater ihm erzählte, dass er wegen des Artikels heute schon verstört durch die Straße gelaufen war … die Nachbarn haben alle diese Ausgabe bekommen! … zog Richard einen Notizblock aus der Brusttasche seines Hemdes und schrieb ein paar Anweisungen auf:
- einkaufen, was nicht da ist
- Servietten?
- Anruf Weinhändler / GROSSE Flasche!
- Tisch decken
- dass alles fertig ist, wenn der Koch kommt
Er drückte dem Mädchen den Abriss in die Hand und flüsterte ihr „Muss dringend weg“ ins Ohr.
Richard von Wards hatte sein Hobby zum Beruf gemacht. Schon als junger Kerl war er mit Vaters Segelyacht über den Chiemsee geglitten, mit seinen Kumpels und ihren Freundinnen im Schlepptau. Eines Tages kam ihm die Idee, Menschen für Rundfahrten auf seinem Boot inklusive Bewirtung bezahlen zu lassen. Auch Vater war der Idee nicht abgeneigt. Auf diese Weise konnte man Kontakte zur gehobenen Gesellschaftsschicht knüpfen und dabei noch ein Zubrot verdienen. Die „Wards am See“ schrieb zwar bisher nur rote Zahlen, aber das war Vater egal. Hauptsache der Junge hatte eine Beschäftigung.
Soeben sprach Vater davon, wie sehr er seine Tochter vermisste und dass Daniel … er nannte ihn Scheißkerl … zum wiederholten Male angerufen hatte. „Er hat noch Sachen, die er der Familie zukommen lassen will.“
„Vater, ich schau mir das jetzt an“, sagte er. „Ich meld mich bei dir.“ Er steckte das Handy weg.
4
„Ein Herr Richard von Wards möchte mit Ihnen sprechen.“
Die Krankenschwester hatte Herrn Doktor Altmann am Telefon. Richard wartete neben ihr. Er hatte seinen Wagen auf direktem Weg zum Klinikum gelenkt, weil ihn der Verdacht nicht mehr losließ, dass bei der Sache um Rosi noch etliche Leichen mehr im Keller waren, als bisher vermutet.
„Ja, verstehe … mache ich.“ Sie hängte ein. Dann schnaufte sie einmal tief durch.
„Er spricht nicht mit mir?“, riet Richard ins Blaue und traf ins Schwarze.
„Wissen Sie …“
„Mein Name ist in diesem Haus nicht willkommen. Damit habe ich gerechnet.“
Sie nickte.
„Warum ich hier bin … ich brauche Informationen.“
„Es tut mir leid. Ich habe viel zu tun.“
Richard sah sich um. Er war nicht dabei gewesen, als die Familie sich um den Leichnam versammelt hatte. Trotzdem fühlte er Unbehagen. Seine Schwester war in diesen Räumen gestorben. Sie hätte ebenso weiterleben können. Der Gedanke machte ihn wütend. Was stimmte hier bloß nicht?
„Zeigen Sie mir bitte, wo …“ Er suchte nach den richtigen Worten. GESTORBEN drückte ihm einen Kloß in den Hals. „… wo es passierte.“
Schwester Margit warf einen prüfenden Blick zur Tür des Ärztezimmers.
„Bitte“, sagte er.
„Das da.“ Sie deutete auf ein Zimmer. Nummer 2011.
Da war sie also gestorben. Es trieb ihm die Tränen in die Augen. Er wollte auf den Raum zugehen. Doch etwas hielt ihn davon ab. Es war, als erwartete er, seine tote Schwester hinter der Tür vorzufinden; Angst, als wartete der Tod persönlich auf ihn.
Überraschung. Hier ist dein Schwesterlein. Schau sie dir genau an. Vertrocknet wie ein alter Apfel, die Arme.
„Sie dürfen da nicht rein“, sagte die Krankenschwester. „Ist ein Patient drin.“
Einerseits war er erleichtert, das Zimmer nicht betreten zu können – zu müssen. Andererseits machte ihn das Verbot noch wütender. Seine Schwester war an diesem Ort gestorben. Doch für das Krankenhaus nahm alles seinen gewohnten Lauf. Als sei es völlig normal.
Etwas brüllte in seinem Geist: Rosi ist tot. Dann kehrt mal jemand bitte den Boden, und schon ist der nächste Patient im Zimmer – zack und fertig.
Nur schwer konnte er seinen Zorn verbergen.
„Irgendwelche Unterlagen?“, fragte er.
Wieder zögerte sie.
„Aber Doktor Altmann …“ Sie sah ihn an.
Offensichtlich war sie in einem Zwiespalt. Richard erwartete, im nächsten Moment rausgeworfen zu werden. Hatte die Klinik etwas zu verbergen?
Dann plötzlich: „Kommen Sie.“
Er folgte ihr ins Schwesternzimmer – eine kleine Kammer vollgestopft mit Unterlagen, einem PC und einer Kaffeemaschine.
Am Computer drückte sie ein paar Tasten. „Die Patientenakte. Ist alles elektronisch.“
Richard las Fachbegriffe und verstand kein Wort. Nur eine Sache stach ihm ins Auge: Am Ende der Bildschirmmaske war ein Feld mit der Bezeichnung BESUCHER aufgeführt. Dort las er nur einen Namen: Daniel Lang. Es schoss ihm heiß und kalt durch den Körper. Er biss die Zähne zusammen. Die Wangenmuskulatur arbeitete.
„Mehr kann ich nicht für Sie tun“, sagte die Krankenschwester.
„Sie haben genug für mich getan.“
Sofort stampfte er ins Treppenhaus und schlug die Schwingtür hinter sich zu. Die Schwester sah ihm verwundert nach.
Im Fahrzeug angekommen, stieß Richard einen ungezügelten Schrei aus. Er brüllte wie ein wild gewordenes Tier, schlug mit den Armen um sich und trat mit den Füßen gegen den Fahrzeugboden. Doch die Wut wollte nicht raus – sie wollte verdammt noch mal einfach nicht aus seinem beschissenen Körper raus.
5
Rauch stieg über dem Herd auf. In der Pfanne brutzelte und knackte es laut. Der Duft von gebratenen Eiern erfüllte die Luft. Grace wedelte mit den Armen durch den würzigen Dampf. Das Küchenradio spielte ausgefallene Hits der 80er.
„Some people get …“, sang eine tiefe Männerstimme zu harten Gitarrenriffs.
Ihre Hand griff nach dem Schalter des Dunstabzugs. Sie zögerte.
„Nein, lass es“, sprach die Stimme.
Die Stimme war mittlerweile zu einem alten Bekannten, ja, fast zu einem guten Freund geworden. Sie begleitete das Mädchen seit langem überall hin. Und sie gab ihr gute Ratschläge in jeder Situation.
„Man kann die Abluft riechen. Möchtest du, dass jeder im Umkreis von einem Kilometer weiß, dass Grace Owen sich in ihrer Küche aufhält? Möchtest du das?“
Natürlich wollte sie das nicht. Nicht auffallen, das war vorrangig. Da hatte die Stimme schon recht. So wie sie immer recht hatte. Grace nahm den Finger vom Schalter und wedelte mit einem alten Tagesboten über dem heißen Fett herum.
Sie erinnerte sich an den Tag, als sie die Stimme zum ersten Mal gehört hatte. Sie hatte den Schulranzen auf den Rücken geschnallt und war am zweiten Schultag stolz in die kanadische Einheitsschule marschiert. Endlich war sie ein großes Mädchen. Man muss mich nicht mehr bringen, dachte sie mit hochgestreckter Nasenspitze. Auch wenn mich der Ranzen nach hinten zieht, ich kann das. Mein Rücken ist kräftig. Ich trage die Bücher bis zur Schule, nehme den Weg, den Mama mir gestern gezeigt hat, dann wird sie stolz auf mich sein.
Vor dem Schulhaus wuselten hunderte Kinder in alle Richtungen, schrien herum und warfen mit Papierbällen oder schossen Spuckepapierfetzen durch zweckentfremdete Filzstiftrohre. Die kleine Gracie marschierte zielstrebig auf den Kinderhaufen zu – nur noch vorbei an der stämmigen Eiche – als sie angesprochen wurde: „Grace, magst du einen Lolli?“
Das Mädchen sah sich um. Ein größeres Mädel mit pinken Glitzerschuhen rannte an ihr vorbei, drei weitere hinterher; die Schulranzen sprangen ausgelassen auf den Kinderrücken.
„Oder magst du so schöne Schuhe wie die da vorne?“, fragte die Stimme. Sie klang warm und angenehm.
„Wo bist du?“, fragte Grace, lief um den verwitterten Eichenstamm herum und erwartete, dahinter einen Lehrer oder den netten Herrn Hausmeister anzutreffen. Aber da war niemand.
Sanft umwarb die Stimme ihre Gedanken. „Was hättest du denn gern? Dann sag ich dir, wo ich bin.“
„Weiß nicht?“, sagte sie. Sie stellte sich stramm, die Nase hoch. „Kuck mal, was ich hab. Einen Schulranzen. Da sind ganz viele Bücher drin.“ Sie dachte sich nichts dabei, mit einem Unsichtbaren zu sprechen. Endlich war da jemand, der zuhörte. Und sie hatte doch so viel zu erzählen.
Und die Stimme sprach voller Bewunderung: „Na, das ist aber ein schöner Schulranzen.“
Ihr Herz machte Luftsprünge. Ein netter Mensch. „Sag mal, hast du denn solche Schuhe für mich?“
Keine Antwort.
Noch einmal umrundete sie den Stamm der Eiche. Der Schulgong gab sein Zeichen. Wenn der Gong schlägt, dann geht man in die Schule. Und wenn er noch mal schlägt, dann sitzen alle braven Kinder auf ihren Plätzen, die Hände auf dem Tisch. Das hatte sie gestern gelernt. Na logisch war sie ein braves Mädchen. Obwohl diese rosafarbenen Schuhe gut zu dem Schulranzen passen würden.
„Hörst du, wo bist du? Ich will schon solche Schuhe haben“, sagte sie. Sie stellte sich vor, wie sie morgen mit ihrem tollen Schulranzen zur Schule lief und dabei ihre Füße betrachtete; und da waren die neuen Schuhe, rosa und glitzernd. Jeder würde ihre Schuhe bewundern. So wie Gracie das andere Mädchen mit den Glitzerschuhen bewundert hatte.
„MAN NIMMT NICHTS VON FREMDEN AN. NIEMALS!“ Da war die Stimme wieder. Doch auf einmal klang sie gar nicht mehr so freundlich. Und was sie da sagte, passte überhaupt nicht in Gracies wundervollen Tagtraum.
„Aber du hast doch gesagt …?“
„Beweg deinen Arsch in die Schule, SOFORT! Und dass du mir mit niemandem sprichst. Ich weiß, wie das sonst mit dir endet. Kaum spricht man dich an, schon säufst du Rattengift. Wird Zeit, dass sich jemand um dich kümmert. Schließlich kann man ein Mädchen wie dich nicht unbeaufsichtigt herumspazieren lassen. Gerade noch rechtzeitig … sei froh, meine Kleine. Jetzt aber los, bevor du zu spät kommst. Oder möchtest du, dass die Lehrerin dich ins Lehrerzimmer mitnimmt und dir eine Tracht Prügel verpasst? Das passiert nämlich mit Kindern, die nicht folgen. Der Lehrer nimmt sie mit. Und hinterher können sie nicht mehr richtig sprechen. Möchte nicht wissen, was da mit ihnen passiert. Also los.“
Der Mann im Radio sang gerade: „D’you get scared …?“
Grace aß gern am Beistelltisch in der Küche. Hier konnte sie es sich schmecken lassen und musste keine Angst haben, beobachtet zu werden. Der Raum hatte kein Fenster. Die Lampe blieb trotzdem aus, denn Licht verbreitet sich in der ganzen Wohnung. Und dann sah man, wenn sie anwesend war.
Das sagte die Stimme.
„Oder sollen die Leute von der Finanzbehörde dich finden?“ Unzählige Male hatte die Stimme ihr diese Frage bereits gestellt. Es war ihre Entscheidung gewesen, das Land zu verlassen. Im Internet hatte sie einen Artikel über Kanada gefunden. Der beschrieb die Nation als das Land mit den offenen Haustüren. Zu diesem Zeitpunkt wurde ihr bewusst: Es ist nicht überall so. Woanders sperrten die Menschen ihre Türen ab. Sie lebten zwar gemeinsam in einem Haus, sprachen aber kein Wort miteinander. Nachbarn wohnten viele Jahre Wand an Wand, ohne sich überhaupt beim Namen zu kennen. Eine wunderbare Vorstellung. Graces Vater war in Deutschland geboren – ihr Sprungbrett in eine versperrte Welt.
Die Stimme fand die Idee gut. Auch wenn sie Einwände hatte. Trotzdem war es Graces Entscheidung. Dieser Punkt war ihr wichtig.
In ihrer neuen Heimat fühlte sie sich wohl. Endlich konnte sie ein Leben beginnen, ohne die schleichende Angst, jemand könnte ihr Glitzerschuhe schenken wollen – oder einen Lolli.
Sie nahm ihren ganzen Mut zusammen und fragte gerade heraus: „Was hältst du von dem neuen Mieter im Vierten?“
Die Stimme schwieg – kein gutes Zeichen. Normalerweise folgte einer Frage entweder eine schlagfertige Antwort oder ein klares NEIN. Stille hatte meist einen donnernden Ausbruch zur Folge – wie damals, als sie nach den Schuhen fragte.
Und wahrhaftig. „DU HURE! Du gottverdammte Hure. Möchtest dich dem Scheißkerl hingeben, nur weil du ihm einmal in die Augen gesehen hast?“
Ihr Magen krampfte.
„… siehst du das denn nicht? Er ist einer von denen. Was habe ich dir erklärt? Sie wollen dein Geld. Wie konntest du nur das Land verlassen? Ich sagte dir: Es wird Folgen haben. Da hast du’s.“
Obwohl sie den Ausbruch erwartet hatte, stand ihr Körper im ersten Moment unter Strom. Dann löste sich die Spannung und ihre Schultern senkten sich. Die Mundwinkel sackten ab. Die Stimme hatte recht. Das kanadische Finanzamt war ihr auf den Versen. Unverzeihbar, das Land einfach so zu verlassen. Der Fiskus will seine Gelder – egal, wo man sich aufhält. Die Stimme hatte sie gewarnt. Aber dass die Beamten so findig vorgehen würden, einen Spion ins Haus einzuschleusen, das hätte sie nicht erwartet.
Der junge Mann machte so einen netten Eindruck. Sie seufzte. Sie wollte nur mal schauen. Seine Wohnung lag direkt über ihrer. Nur das Namensschild betrachten und lauschen, ob jemand zu Hause war. Mehr nicht.
Sie stieg die Stufen hinauf.
„Lass es sein, Grace. Vertrau mir. Sie haben ihn auf dich angesetzt. Du wirst in eine Falle tappen.“
Sie beachtete die Stimme nicht. Im Laufe der Jahre hatte sie gelernt, die Stimme hin und wieder zu ignorieren. Und je intensiver man sie missachtete, desto ruhiger wurde sie. Sie verstummte zwar niemals ganz, aber es wurde erträglicher.
Schon oft spielte sie mit dem Gedanken: Was, wenn die Stimme sich irrt? Als kleines Mädchen ist das Wort eines Erwachsenen Wahrheit. Dann wird man selbst groß und erkennt, dass auch Erwachsene lügen – mehr noch, als die meisten Kinder. Und Erwachsene irren. Aber irren sich Stimmen möglicherweise auch?
Sanft fuhr sie mit Zeige- und Mittelfinger über das Namensschild: DANIEL LANG. Klingt nicht wie der Name eines kanadischen Finanzbeamten.
Da schnappte ein Schloss.
Fix huschte sie die Stufen hinab.
Sie rumpelte gegen die Wohnungstür. Verschlossen. Zuvor war sie offen. Bestimmt!
„Sie war offen. Jetzt ist sie zu“, sprach die Stimme, schon etwas lauter. Der hässliche Unterton war nicht zu überhören. Grace riss die Augen auf.
Wie ein kleines Kind an Vaters Hemdzipfel wimmerte sie: „Was jetzt?“ Doch niemand bot ihr Schutz. Sie war allein; und sie fürchtete sich.
„Ich hab dir gesagt, du sollst in der Wohnung bleiben. Hab ich dir das nicht gesagt? Tausend Mal schon? Aber das Mädchen hört ja nicht auf mich. Sie sind in deiner Wohnung. Was wirst du jetzt machen?“
Er fragt mich, was ich machen soll? Wieso mich? Sie fühlte sich im Stich gelassen. Als ob die Stimme es darauf anlegte, die Leine loszulassen und zuzusehen, wie Grace in den Abgrund stürzte. Schließlich würde sie Grace auffangen und in Zukunft würden die Fesseln noch enger gezogen. Das konnte sie nicht zulassen. Sie steckte den Schlüssel ins Schloss und drehte ihn herum.
In der Wohnung war es dunkel. Es roch nach Fett. Und es war still. Sie ließ die Tür offen stehen und ging leise durch den Flur. Ein kalter Luftzug schickte Gänsehaut über ihren Körper. Sie vermied jedes Geräusch. Die Badtür stand offen. War schon offen. Todsicher. Ein Blick hinein – leer. Weiter den Flur hinunter. Ihre Nerven spielten verrückt.
Die Stimme flüsterte: „Er ist hier irgendwo. Du tapst in seine Falle. Das Radio ist aus.“
Das Radio ist aus.
Ihr Atem zitterte.
Rechts, der Durchgang zur Küche. Für jeden weiteren Schritt fehlte ihr der Mut.
„GRACE OWEN.“
Es war eine tiefe Grabesstimme, ähnlich dem Geräusch einer Marmorplatte, die über den Boden geschleift wurde. Grace war nicht mehr fähig, auch nur einen einzigen Schritt zu tun. So konnte sie nur dabei zusehen, wie ein restlos in Schwarz gekleideter Mann vor ihr aus der Dunkelheit trat. Ein Priester? Er war einen ganzen Kopf größer als sie. Ihre Augen bissen sich an seinem Kragen fest. Priester tragen weiße Kragen. Seiner ist schwarz – schwarz wie der Tod.
Ihre innere Stimme rief: „Er hat dich, Grace.“
Ja, er hat mich, dachte sie und fühlte sich dabei unendlich hilflos.
„Du bist ein Problem für uns … Grace“, sprach der schwarze Mann. Seine Lippen bewegten sich nicht.
Sie suchte etwas in seinen Augen, woran sie sich festhalten konnte. Was sie sah, war endlose Leblosigkeit.
Die Stimme befahl: „Gib ihm die Unterlagen.“
Und ihr Verstand sagte: Renn so schnell du kannst.
Sie wollte sprechen, formte die Worte „Was wollen Sie?“, brachte jedoch keinen Ton heraus.
Da spürte sie die Stimme des Priesters in ihrem Brustkorb. „Du bist neben dem System.“ Und sie vernahm mit einem Mal einen intensiven Rußgeruch, als wäre der Speck in der Pfanne zu Kohle verbrannt.
„Gib’s ihm schon. Jetzt, Grace! Dann lässt er dich in Ruhe.“
Sie wusste nicht mehr, was sie tun sollte. Hilflos warf sie den Kopf hin und her und ballte die Hände. Dann handelte sie. Sie schlug die Faust gegen seine Brust, schubste ihn weg, drehte sich um und rannte.
„Flucht ist sinnlos“, sagte die Grabesstimme, und obwohl der Priester die Worte kühl und kaum hörbar von sich gab, verstand Grace jede Silbe klar und deutlich.
„Bleib stehen“, befahl ihre innere Stimme.
Doch Grace rannte. Durchs Treppenhaus, durch die Wohnungstür, schrammte sich am Briefkasten, lief den Weg hinunter, atemlos. Und je weiter sie rannte, desto leiser wurde die innere Stimme. Nur der Rußgestank blieb fest und intensiv in der Nase haften, als ob er etwas zu bedeuten hätte.
„Bleib stehen, verdammt noch mal, stehen bleiben sollst du, du Miststück …“
Er konnte ihr nichts mehr versprechen. Glitzernde Schuhe, Lollis – alles uninteressant. Jetzt war sie ein großes Mädchen. Nur kleine Mädchen glauben jedes Wort.
Aber glauben große Mädchen an den schwarzen Mann?