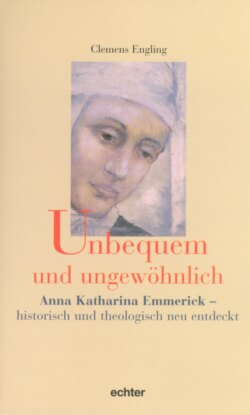Читать книгу Unbequem und ungewöhnlich - Clemens Engling - Страница 11
5. Zum Stand der Verehrung
ОглавлениеNach sieben- bis achtjähriger Erfahrung als Pfarrer der Hl.-Kreuz- und Grabeskirche Anna Katharina Emmericks konnte ich am 8. September 1988 feststellen: »Immer wieder neu bin ich erstaunt über die Zeichen der Verehrung am Emmerickgrab in der Krypta der Hl.-Kreuz-Kirche: immer neu entzündete Lichter, sehr oft Blumen und Blumensträuße, die am Grab niedergelegt werden, spontan auftauchende Gläubige, nicht nur aus Dülmen, nicht nur aus Deutschland, sondern sehr oft auch aus Holland, Belgien, der Schweiz, ja aus aller Welt.«64
In der Reihe »Landesspiegel Ortserkundung« strahlte das Fernsehen WDR III am 6. 5. 1983 einen von Dieter Koch redigierten Film aus: »Eine Rose ist … eine Rose«, der mit folgendem Satz eingeleitet wurde: »Es gibt Orte, die uns im Bewusstsein sind aus dem Erleben einzelner Menschen. Bei Weimar denken wir an Goethe, bei Wittenberg an Luther. Das im Münsterland gelegene Städtchen Dülmen ist in der Welt bekannt geworden durch eine Nonne, die stigmatisierte Anna Katharina Emmerick. Durch die Erinnerung an sie hat sich der Filmemacher Dieter Koch nach Dülmen führen lassen.«65
Trotz der eben aufgezeigten Erfahrungen darf die realistisch-kritische Frage nach dem heutigen Stand der Verehrung gestellt werden. Wird die bevorstehende Seligsprechung der inneren Verehrung, auf die es vor allem ankommt, förderlich sein? Der äußere Bekanntheitsgrad wird sicher gefördert: »Anna Katharina Emmerick könnte bald wieder Aktualität in Dülmen erlangen und Dülmen in Europa erneut bekannt machen.«66
Der heute eher vergessene Dichter Werner Bergengruen bringt in seinem Reise-Bericht über Deutschland die beiden Phänomene, die Dülmen in der Welt bekannt gemacht haben, in einen sehr tiefen und nachdenkenswerten Zusammenhang. Er schreibt in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts: »Mittelpunkt des Croyschen Besitzes ist das alte Städtchen Dülmen, in welchem gesponnen und gewebt wird. Hier steht am Park das herzogliche Schloß.67 Allein das Zeichen, das dieser Stadt gebietet, ist nicht der Croysche Herzogshut. Es sind die Wundmale Christi, erschienen am armseligen, leidenden, abgezehrten Körper der Augustinernonne Anna Katharina Emmerick.68
Eine große Zäsur in der Verehrung A. K. Emmericks scheinen der zweite Weltkrieg und die erschreckende Zerstörung Dülmens bis über 90 % der vorhandenen Baumasse, darunter auch der erst 1938 konsekrierten Hl.-Kreuz-Kirche ausgemacht zu haben. Pfarrer Heinrich Schleiner, langjähriger »Promotor« der Emmericksache (1974–1989), berichtet aus eigener Anschauung und Erfahrung: »Viele Dülmener erhofften sich von der Fürbitte der Emmerick die Bewahrung ihrer Stadt vor dem Schicksal völliger Zerstörung, das damals schon so viele Städte getroffen hatte. Eindringlich hatte darum Dechant Knepper immer wieder seine Gläubigen vor einem falschen, vermessentlichen Vertrauen auf die Fürbitte der Emmerick gewarnt, weil nirgendwo in ihren Visionen zu lesen sei, dass sie ihre Heimatstadt vor dem Schicksal der Zerstörung bewahren werde.« Die dann eingetretene »Katastrophe führte manche Dülmener Bürger trotz der berechtigten Warnung des Dechanten in ihrem Verhältnis zur bisher so hochverehrten Emmerick in eine Krise – unverdientermaßen muss man sagen.«69
Die Initiative Bischof Heinrich Tenhumbergs in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts kam für viele überraschend. Die Zeiten hatten sich gewandelt. Zwischen 1945 und 1974, fast eine Generation lang, war das Ansehen der Anna Katharina Emmerick, geschweige denn die Verehrung, nicht sonderlich gepflegt worden in der Nachkriegsgeneration, die ganz andere Sorgen hatte. Außerdem begegnete Anna Katharina in einem Gewand des 19. Jahrhunderts, das den allermeisten Zeitgenossen kaum noch verständlich sein konnte. Schon ihre Bezeichnungen drücken z. T. Antiquiertheit, z. T. Hilflosigkeit aus: Leidensbraut, Dulderin, Visionärin, Nonne aus Dülmen, Seherin. Bischof Tenhumberg, der allzu früh im Herbst 1979 starb, hatte im Jubiläumsjahr zwar selbst durch Predigten in Coesfeld und Dülmen einen starken Anstoß zur erneuten Verehrung gegeben70; hinzu kamen die weiteren Bemühungen, von denen berichtet wurde. Aber dadurch war Anna Katharina noch keineswegs anerkannt. Es gab sogar deutliche Stimmen gegen eine Seligsprechung, die mich privat erreichten.
Mehrere Mitglieder in den Gremien: Bischöfliche Emmerick-Kommission, Emmerick-Bund und -Verein erkannten das Defizit: einen großen Zwiespalt zwischen dem Verständnis der Anna Katharina Emmerick im 19. Jahrhundert, noch in den zwanziger und dreißiger Jahren des zwanzigsten und dem möglichen Verstehen in dessen letztem Viertel, in dem wir uns damals befanden. Es galt, dieses Defizit im Verständnis der Mystikerin aufzuarbeiten, bevor eine Seligsprechung wirklich Anerkennung finden konnte. Es zeichnet die Weitsicht jener Mitglieder der »ersten Stunde« im neuen Seligsprechungsverfahren aus, wenn sie um die genannten Schwierigkeiten in der »Verheutigung« der Emmerick wussten und sich um ein neues Verständnis mühten. Zunächst war nur eine Ahnung wirkmächtig, dass die Mystikerin gerade heute unserer Zeit viel zu sagen hat.71 Jean Guitton, der A. K. Emmericks Aktualität überaus positiv kennzeichnet (›unerklärlicher Diamant‹), sagt dessenungeachtet: »Katharina Emmerick gibt der Wissenschaft dieses Jahrhunderts viele Probleme auf: physiologische, pathologische, medizinische, die keineswegs gelöst sind. Das Schweigen, das man über diese Probleme breitet, ist kein Beweis für ihr Nichtvorhandensein.«72 Mit dieser Feststellung und mit der Selbsterkenntnis des vorhin gekennzeichneten Defizits war für die Verantwortlichen der Ausgangspunkt für weitere Forschungen in der Brentano-Emmerick-Beziehung und in vielen weiteren Fragen gegeben.