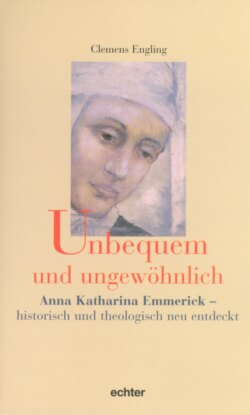Читать книгу Unbequem und ungewöhnlich - Clemens Engling - Страница 9
3. Der verspätete Prozessbeginn in Münster
ОглавлениеAnna Katharina Emmerick, geboren am 8. September 1774 in Flamschen bei Coesfeld, starb am 9. Februar 1824 in Dülmen an einem Montagabend. »Am Freitag um 9 Uhr morgens wurde sie begraben. Es war eine so zahlreiche Beteiligung dabei, wie man sich nicht erinnert, sie in Dülmen gesehen zu haben. Alle Priester, Bürger, alle Schulkinder und Arme zogen mit.«25 Nur einer fehlte: Dechant Rensing, der Ortspfarrer, der inzwischen mit Anna Katharina zerfallen war. Brentano berichtet: »Bei ihrer Beerdigung, wo alles gerührt war, soll er ganz heiter mit anderen vor der Türe geschwätzt haben, und nachmals in einem Hause gesagt, sie hat wie ein Mensch gelebt und ist wie ein Mensch gestorben.« Brentano fügt hinzu: »Er wurde durch nichts aus seiner eigentümlichen Nüchternheit gebracht.«26 Brentano stand wohl zu Recht sehr kritisch zu Dechant Rensing, worauf später einzugehen ist. Wir stellen hier nur die Frage: Was bedeutete die skeptische Haltung des Ortspfarrers für die damaligen Pfarrangehörigen, vielleicht gerade für die wie der Dechant einer aufklärerischen Haltung Zugeneigten? – Für die Beantwortung der Frage liegen uns keine historischen Anhaltspunkte vor. Pater Thomas Wegener, der Begründer, besser Koordinator, der Emmerickverehrung in Dülmen, verschweigt die Haltung des Ortspfarrers und berichtet auf den letzten fünfzig Seiten seiner sehr volkstümlichen, allerdings auch wunderbezogenen Emmerick-Biographie aber umso eindrucksvoller von der beginnenden Emmerickverehrung in Dülmen und der Macht der Fürbitte Anna Katharinas: »Trotz des unkirchlichen Geistes der größten Zahl der sogenannten Gebildeten und Gelehrten, die sich um eine Person, wie die Gottselige war, sowohl damals als auch jetzt gar nicht kümmern und ihren Namen einfach totschwiegen, und obwohl viele dem Glaubensleben entfremdet waren, empfing Anna Katharina doch in Dülmen bei allen Klassen der Bevölkerung und in vielen Familien des Münsterlandes vor und nach ihrem Tod besondere Verehrung. Die allgemeine Volksstimme nannte sie eine Heilige, und sie, die man schon zu ihren Lebzeiten so viel um Hilfe angefleht hatte, wurde auch von Anfang an am Grab besucht, um ihre himmlische Fürbitte zu erlangen.«27
Das, was P. Wegener vom «unkirchlichen Geist« der Gebildeten nach der Aufklärung und Säkularisation schreibt, dürfte sehr zutreffend sein und auch erklären, warum der Emmerick-Prozess auf der Diözesanebene so spät in Gang kam. Pater Adam: Ein Prozess soll normalerweise nicht später als dreißig Jahre nach dem Tod der verehrten Person beginnen. »Bei A. K. Emmerick tat sich der Prozess recht schwer, überhaupt in Gang zu kommen. Sie starb am 9. Februar 1824, und die erste Sitzung fand statt am 14. November 1892, also fast 70 Jahre später…Zu erklären ist diese Zurückhaltung nur vor dem religions- und zeitgeschichtlichen Hintergrund.«28 Die Aufklärung war noch keineswegs überwunden; die deutsche Kirche litt noch unter der Zerschlagung ihrer äußeren Strukturen. Lange Jahre der Lebenszeit Anna Katharinas in Dülmen gab es bekanntlich in Münster keinen Diözesanbischof. Das Münsterland war an das protestantische Preußen gefallen. Die katholische Bevölkerung fühlte sich benachteiligt. Die Entwicklung gipfelte im Kölner Ereignis 1837, der Gefangensetzung des Kölner Erzbischofs Clemens August Droste zu Vischering, der als Generalvikar von Münster die kirchliche Untersuchung Emmericks eingeleitet und sie »als Freundin Gottes« bezeichnet hatte. Nachdem sich die Lage längst beruhigt hatte, brach in den siebziger Jahren der Kulturkampf aus. »Verantwortlich für die Verzögerung des Informativprozesses (in Münster) ist auch die katholikenfeindliche Haltung eines Teiles der Presse in dieser Zeit.«29 Vor diesem Hintergrund sind auch die Ängste und die Zurückhaltung des Klerus verständlich, obwohl es dafür auch noch weitere Gründe gibt, wie wir weiter unten sehen werden.
Domdechant Dr. C. F. Krabbe, ein der Emmerick Wohlgesonnener, stellt im »Vorwort« zu seiner kleinen Schrift »Erinnerung an die selige Anna Katharina Emmerich. Augustinerin des Klosters Agnetenberg in Dülmen« sechsunddreißig Jahre nach ihrem Tode fest: »Die selige A. K. Emmerich ist in Westfalen leider zu sehr in Vergessenheit geraten.« Anlass der Schrift ist die erneute Öffnung des Grabes, über die das »Westfälische Kirchenblatt« berichtet habe mit dem Zusatz: »In wie hohem Ansehen die Verblichene außerhalb Westfalen steht, davon kann man sich leicht auf Reisen überzeugen.« Ein amerikanischer Pfarrer habe beim Betreten des Geburtshauses berichtet, »Catharina Emmerich … sei in Amerika bekannter als Napoleon«30.
Mag man auch die letzte Äußerung als evtl. Übertreibung eines amerikanischen Emmerick-Verehrers werten, so wird der eine oder andere Leser doch an eigene Erlebnisse von Besuchen im Ausland oder Besuchern von weither in Dülmen erinnert, spätestens durch die Erfahrungen mit Mel Gibsons Passionsfilm. Wie kommt der oft verblüffende Bekanntheitsgrad Anna Katharinas zustande? Kurz gesagt: durch die Schriften Brentanos, die in süddeutschen Verlagen erschienen waren, noch zu dessen Lebzeiten: »Das Bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi« – 1833, posthum: »Das Leben der heiligen Jungfrau Maria« – 1852 und: »Das Leben unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi« – 1858 und 1860; die ersten beiden Schriften mit dem Zusatz: »Nach den Betrachtungen der gottseligen Anna Katharina Emmerich«, die dritte Schrift: »Nach den Gesichten der gottseligen Anna Katharina Emmerich.«31
Auch Pater Wegener führt den Bekanntheitsgrad A. K. Emmericks auf die »Bücher ihrer Visionen« und »P. Schmögers große Lebensbeschreibung« zurück32, die sehr bald ins Französische, Englische und Italienische übersetzt wurden, und stellt kritisch wie Domdechant Krabbe fest: »Anna Katharina hatte in den letzten Jahrzehnten wegen der Großartigkeit ihrer Begnadungen in der weiten Ferne mehr Beachtung gefunden als in ihrer Heimat Westfalen, wenn wir von Dülmen und Umgebung absehen. Dort war sie in auffallender Weise namentlich von den Gebildeten und Geistlichen sehr vergessen worden; ihr Leben wie auch ihre Visionen waren den meisten unbekannt.«33 Sogar der Anstoß zur Errichtung eines Grabkreuzes und später eines schmiedeeisernen Gitters kamen aus dem Ausland: Domdechant Krabbe berichtet, wie ein in Rom stationiertes Mitglied eines Krankenpflegeordens beim Besuch seiner Mutter in Münster »von der großen Verehrung, welche der seligen A. K. Emmerich in Rom gezollt werde«, berichtete. Er wunderte sich, dass in Dülmen noch nicht einmal ein Kreuz auf dem Grab der Emmerick zu finden war, und veranstaltete eine Sammlung in Rom beim hohen Adel. Sobald das Geld in Münster eingetroffen war, »genehmigte der hochwürdigste Bischof, dass auf dem Grabe ein einfaches gotisches Kreuz errichtet und zur Legung des Fundamentes das Grab geöffnet werde.«34 Noch heute ist auf der Rückseite des alten Emmerickgrabes zu lesen: »Fideles Romae degentes monumentum posuerunt 1858« (In Rom wohnende Gläubige haben das Denkmal gesetzt 1858). Die polnische Gräfin Schapska stiftete mit Hilfe eines Dülmener Pfarrgeistlichen ein »prachtvolles Eisengitter«35.
Die Anstöße von außen beleben auch wieder die Verehrung in Dülmen und in der Diözese Münster. P. Wegener berichtet, dass nach Erneuerung der Grabesstätte »die stille Verehrung der Bewohner von Dülmen« zugenommen habe.36 Ein weiterer Aufschwung war mit dem 100. Geburtstag und fünfzigsten Todestag im Jahre 1874 gegeben: Man begann, »die von ihr (Emmerick) herrührenden Gegenstände: Möbel, Leinensachen, Bücher und andere Dinge« zu sammeln, die in Dülmener Familien und anderswo als »teure Kleinodien« bewahrt worden seien. Fünfzig bis sechzig Jahre nach ihrem Tode brachte man noch ca. hundert Gegenstände zusammen.37 Vorläufig wurde die Sammlung im Sterbehaus untergebracht, das am 1. April 1877 mietweise geöffnet wurde. Da das Haus aber nicht zu kaufen war, wurde zwanzig Jahre später ein eigenes Emmerickhaus errichtet, das dem damaligen »Emmerickfriedhof« und der heutigen Hl.-Kreuz-Kirche schräg gegenüber liegt, und im März 1898 eröffnet wurde; das Wohnzimmer der Emmerick wurde im Jahre 1900 angebaut. Damit war der Grundstock für die Emmerickgedächtnisstätte gelegt; diese wurde in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre ins Augustinerkloster verlegt, bei der Pfarrei Maria Königin, bald soll sie in der Grabeskirche Hl. Kreuz wohl ihre endgültige Heimat finden.
Eine besondere Rolle und hohe Verdienste hat Theodor Wegener. Er wurde 1831 in Coesfeld geboren, war Priester der Diözese Münster und war während eines Studienaufenthaltes in Rom als junger Priester von dem inzwischen selig gesprochenen Papst Pius IX. (Papst von 1846–1878)38 und von Kardinal Reisach gefragt worden, warum man sich in Deutschland um die Seligsprechung Anna Katharina Emmericks nicht kümmere. »Noch als Vikar von Haltern richtete er 1875 an den Bischof von Münster, Johann Bernhard Brinkmann, die dringende Bitte um Eröffnung des Prozesses. Doch es war Kulturkampf und der Bischof in Holland im Exil bis 1884. Er konnte und wollte auf die Bitte nicht eingehen.«39 1858 trat Wegener vierundfünfzig-jährig in den Augustinerorden ein; er hieß jetzt P. Thomas und widmete sich ganz der Emmerick-Sache.
Um den Emmerickprozess hat sich ganz besonders der Augustiner-Eremiten-Orden verdient gemacht. Schon 1861 hatte P. Pius Keller, dessen eigener Seligsprechungsprozess in Rom inzwischen eingeleitet ist, als Oberer der deutschen Ordensprovinz an Bischof Georg Müller von Münster die Bitte um Einleitung des Informativ-Prozesses für Anna Katharina Emmerick gerichtet. Die Diözese hatte in Verbindung mit der Grabesöffnung 1858 selbst geprüft, ob ein Prozess eröffnet werden solle. Doch Dechant Cramer von Dülmen – obwohl selbst ein Emmerick-Verehrer – und Bischof Müller lehnten ab. P. Adam berichtet von mehreren sich widersprechenden Tatsachen: Dülmener Bürger wollten ein Licht am Grab der Verstorbenen brennen lassen und sich dort zum Gebet versammeln. Dechant Böckenhoff verweigerte den Zutritt zum Friedhof. Der aus Dülmen stammende Vikar Bügelmann schreibt: »Die Leute wunderten sich über die Tatsache, dass nichts zur Seligsprechung unternommen wurde und dass vor allem die Dülmener Geistlichkeit nicht über sie sprach.«40 Eine gewisse Skepsis des sehr nüchtern denkenden westfälischen Klerus ist also nicht neu. Noch unlängst sagte mir ein gut bekannter Mitbruder, gegenüber der Emmerick bestehe nach wie vor eine gewisse Reserve. Wie sind Skepsis und Reserve zu erklären? Mir scheint, der Bischof von Münster, Johann Bernhard Brinkmann, gibt zumindest eine einleuchtende Erklärung. In seiner Ablehnung auf die erneute Bitte von P. Pius Keller, den Prozess zu eröffnen, antwortet der Bischof 1886: »Mag es auch als Tatsache gelten können, dass die selige A. K. E. in Dülmen und Umgebung bei einer nicht geringen Zahl von Gläubigen eine innige Verehrung genießt und seit vielen Jahren genossen hat, so ist es doch unzweifelhaft, dass diese Verehrung der Seligen wie auch die Anrufung ihrer Fürbitte zunächst und hauptsächlich durch die hier sehr verbreitete Schrift des Brentano ›Das bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi‹ … hervorgerufen ist, und später durch die Schriften des P. Schmöger und die Bemühungen des P. Wegener weitere Ausdehnung erhalten hat. Jene Schriften aber fußten auf den Aufzeichnungen, welche Brentano von den mündlichen Äußerungen der Seligen gemacht hat, und wie viel von diesen Aufzeichnungen auf objektiver Wahrheit beruht, wird sich schwerlich jemals feststellen lassen. Gewiss ist, dass viele hiesige Zeitgenossen des g. Brentano ihn für einen Mann gehalten haben, dem seine ungewöhnlich lebhafte Einbildungskraft es schier unmöglich gemacht hätte, das Gehörte in objektiver Wahrheit festzuhalten und niederzuschreiben.«41
Im Jahre 1884 wurde Graf Dr. Christian Bernhard von Galen Dechant in Dülmen. Er erhielt von der Behörde in Münster den Auftrag, »unauffällig« die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Prozesses zu prüfen. Sein Gutachten fiel so positiv aus, dass der neue Bischof von Münster, Hermann Dingelstad, den Diözesanprozess am 14. November 1892 eröffnete. P. Pius Keller und P. Thomas Wegener waren die ersten Vizepostulatoren. Es wurden bis zur letzten Sitzung am 15. Mai 1899 einhundertundeinunddreißig Zeugen vernommen, darunter noch sechs Augenzeugen. Die Abschriften der Prozessakten wurden nach Rom gesandt, die Originale verbrannten 1945 in Münster.42