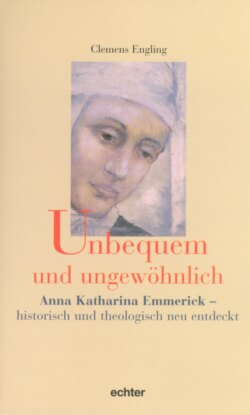Читать книгу Unbequem und ungewöhnlich - Clemens Engling - Страница 12
6. Der Stand der Forschung
ОглавлениеAls der römische Prozess Ende der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts plötzlich unterbrochen wurde, trotz breiter Verehrung in Dülmen, in Deutschland und in aller Welt, war das Ergebnis der Forschungen zu den Brentano-Schriften noch nicht so eindeutig wie heute. Im Jahre 1956 legte Pater Joseph Adam seine inzwischen sehr anerkannte germanistische Dissertation vor: »Clemens Brentanos Emmerick-Erlebnis. Bindung und Abenteuer.«73 Darin zieht er nach Lektüre der »stupenden Manuskripte« Brentanos74 den sehr ausgewogenen Schluss, »dass Brentanos theoretisch und programmatisch durchaus objektiver Einstellung zur Visionswelt ein praktischer Subjektivismus von solchen Ausmaßen entgegensteht, dass zwar noch manches aus der verworrenen Stoffmasse der Visionen als das ursprüngliche Ideen- und Gesichtsgut der Emmerick herausgeschält werden könnte, dass jedoch der überwiegende Teil als durch seine Einwirkung entscheidend beeinflusst und geprägt angesehen werden muss.«75
Brentano sagt selbst, »das eigentliche Wesen des Ganzen« sei »bis jetzt verloren«; er habe »nichts zu retten« vermocht »als ein paar arme Lappen«, »nur ein paar Federstäubchen des ganzen bunten Vogels.«76 Daher, so Adam, wüssten die »Dülmener Tagebücher selbst bis zum Tode der Emmerick« endlos »bis zur Ermüdung« von dem »Vergeblich« zu berichten.77 Die Zeitzeugen: der eigene Bruder Christian, Luise Hensel und vor allem Melchior von Diepenbrock78, der spätere Erzbischof und Kardinal von Breslau, der sowohl der Emmerick als auch Brentano nahe stand, bestätigen diesen selbstkritischen Befund des Dichters, der ja bewusst auf Drängen Diepenbrocks zu Beginn des »Bitteren Leidens« feststellt: »Sollten die folgenden Betrachtungen unter vielen ähnlichen Früchten der kontemplativen Jesusliebe sich irgend auszeichnen, so protestieren sie jedoch feierlich auch gegen den mindesten Anspruch auf den Charakter historischer Wahrheit.«79
Zufällig zeitgleich mit den für Rom erstellten Gutachten zum Emmerick-Brentano-Problem legte Wolfgang Frühwald seine Habilitationsschrift vor: »Das Spätwerk Clemens Brentanos (1815–1842). Romantik im Zeitalter der Metternichschen Restauration.«80 Auf der einen Seite weist Frühwald den verbreiteten Vorwurf einer minderen Qualität des Dichters nach Beginn seiner religiösen Phase zurück, auf der anderen Seite bestätigt er das Negativurteil zur Authentizität der Emmerickaussagen, ja er verstärkt dieses noch, indem er die Intentionen Brentanos hervorhebt, ein eigenes religiöses Weltepos zu schreiben. »Aus der Fülle von Brentanos Visions-Aufzeichnungen eventuelle Reste von Visions-Berichten der Emmerick selbst zu eliminieren, scheint … noch fruchtloser als ein Versuch, aus den Märchen der Brüder Grimm die Stimme der bekannten Märchenfrau zu rekonstruieren. Selbst wenn es gelänge, aus den Emmerickpapieren Worte, Formulierungen, Visionsfragmente etc. der Kranken herauszuheben, so hätte man nur Gedanken des Dichters im sprachlichen Kleid der Nonne erfasst.«81
So entsprach die römische Forderung der Trennung von Emmerick und Brentano, was die Schriftenfrage angeht, ganz und gar der inzwischen erreichten Forschungslage. Erst jetzt konnte der EmmerickProzess verantwortlich aufgenommen werden und braucht auch keineswegs das kritische Licht der Öffentlichkeit zu scheuen, wie sich in der Diskussion um den Gibsonfilm zeigte.82 Das Interesse der Verantwortlichen in der Bischöflichen Emmerick-Kommission und im Emmerick-Bund wandte sich in einem ersten Symposion 1982 in Münster dem Thema »Emmerick und Brentano« zu. Führende Germanisten und Theologen waren eingeladen zu einem intensiven interdisziplinären Gespräch. Das erwies sich als äußerst fruchtbar. »Denn oft ist festzustellen, dass Emmerickverehrer zu wenig von Clemens Brentano und Brentano-Interessierte zu wenig von A. K. Emmerick wissen.«83
Wolfgang Frühwald zeichnete ein ungewohntes Bild Anna Katharina Emmericks. Es gelte, wie schon oben bemerkt, sie als Person ernst zu nehmen, »ohne sie aber zur Gallionsfigur naiver Wundersucht, eines restaurativen Katholizismus oder auch zur Denunziationsfigur menschlichen Autonomiedenkens zu machen.« Anna Katharina Emmerick sei »gequält« worden von der Bürokratie der preußischen Verwaltung, die sie unter »Betrugsverdacht« stellte, »von ihrer stumpfsinnigen Umwelt«, die Brentano oft genug beschrieben habe; von der Theologie ihrer Zeit, »die sich Rationalismus und Liberalismus verschrieben hatte«, »gequält selbst von denen, die sich wie Brentano ihre Freunde nennen, aber nicht ihre Person, sondern ihre Zustände meinen.«84 Unter diesen Umständen habe Anna Katharina ihren Glauben bewahren, ja die Leiden in ihr Leben einbeziehen können; das sei »fast ein Wunder zu nennen. Darum habe das Münstersche Symposion die Emmerick-Frage auf »ein neues Niveau gehoben« und so könne »sogar der Beatifikationsprozess sinnvoll sein.«85 Frühwalds Emmerick-Bild wurde positiv ergänzt und stärker inhaltlich bestimmt durch Pater Dr. Elmar Salmann, der »Religiöse Topoi bei Anna Katharina Emmerick. Versuch einer theologischen Annäherung« beitrug.86 »Anna Katharina Emmerick lebt natürlich in der Welt des Trans- und Übernatürlichen – und bleibt dabei ›natürlich‹, so möchte ich einen ersten Eindruck bei der Durchsicht der Akten wiedergeben.« Dieser »erste Eindruck« wendet sich gegen das verbreitete Vorurteil von Hysterie oder gar religiös-neurotischem Verhalten. Ein paar Sätze später stellt Salmann geradezu heraus: das »Fehlen jeder Überspanntheit«, dagegen positiv eine »empfindsame Empfänglichkeit für Menschen«. Der Pater beobachtet bei Anna Katharina ein »einfältiges Leben mit Gott bar jeder Wundersucht und mit wacher Selbstkritik gepaart.« Alles das aber verbinde sich »zu einem Eindruck elementarer Lauterkeit, einer Durchsichtigkeit, in der sie zum natürlich-einfältigen Spiegel des Übernatürlichen wurde.« Auf diese Weise hebe sich die Emmerick positiv ab von einer Umwelt, »die überskeptisch reagiert oder auch in peinlicher Weise das Übernatürliche herbeizwingen will.« So sei der Weg der Emmerick eine »Gratwanderung« gewesen.87 Das war ein neues Bild der Emmerick, ein auch in unserer Zeit vermittelbares Bild der »Mystikerin des Münsterlandes«. Dieser neue Titel – Emmerick sprach ja normalerweise niederdeutsch und war ein sehr typisches Kind ihrer Heimat – setzte sich, das erste Mal im Vorwort zum Symposion gebraucht, überall sehr schnell durch.
Die guten Erfahrungen mit dem ersten Symposion ließen die Verantwortlichen in Emmerick-Kommission und -Bund schon bald nach einer zweiten wissenschaftlichen Tagung fragen, die diesmal mehr theologisch der Mystik der Emmerick gewidmet sein sollte. Sie fand wieder zu Beginn der Karwoche in Münster statt im Jahre 1990. Professor Leo Scheffczyk sprach über die »Mystik der Anna Katharina Emmerick« und zitierte den sehr schönen Satz des Mystikforschers der dreißiger Jahre, Alois Mager, der über Anna Katharina gesagt hatte: »Über ihre ganze Persönlichkeit waren die bezaubernden Schleier des Mystischen gebreitet.«88 Scheffczyk erkennt bei Anna Katharina eine »mystische Begnadung von höchstem Range«89. Der »Vereinigungsweg mit dem Leiden Christi« mache aus ihrer Persönlichkeit eine »Gestalt der Leidensmystik«, die »würdig in die Gefolgschaft einer Theresia von Avila einzureihen wäre«90. Scheffczyk gab mit seiner Deutung dem Titel »Mystikerin« die volle Rechtfertigung. – Der Beitrag von Pater Josef Sudbrack S. J. leitete neu dazu an, die außergewöhnlichen mystischen Phänomene Anna Katharinas als Konkretion ihrer Heiligkeit zu sehen, wie es das katholische Volk in seiner Verehrung immer getan hat. Sie seien »als Kleid ihrer inneren Begegnung mit Gott zu verstehen, als Gesicht, als Zeichen des Berührtwerdens von Gott.«91
Im näheren Zugehen auf die Seligsprechung fand kurz vor dem Palmsonntag 1999 an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom das dritte Symposion »Anna Katharina Emmerick. Passio-Compassio-Mystik« statt.92 Das Leben und Leiden (Passio) Anna Katharina Emmericks im heute oft zitierten Kontext »einer leidlosen Gesellschaft«93, besonders A. K. Emmericks Fähigkeit zum Mitleiden (Compassio) bildeten die thematischen Schwerpunkte der Vorträge und Diskussionen. Professor Dr. John Fetzer, Germanist und Brentano-Fachmann in den USA, hielt eines der am meisten beachteten Referate, in dem er »Anna Katharina Emmerick als literarisches und geistiges Phänomen einer Schwellenzeit« darstellte.94 Fetzer zitierte sehr bald Frühwald: »Den Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert haben zahlreiche Autoren der romantischen Generation als eine Schwelle der Hoffnung erlebt, jenseits derer ein neues Zeitalter anbrechen würde.«95 Fetzer charakterisierte umfassend den Begriff der Schwelle und wendete ihn auf das Leben und Schicksal der Emmerick an, die schon von ihrer Lebenszeit 1774–1824 her in einer Umbruchzeit gelebt habe; er sprach auch von der inneren und existenziell-religiösen Grenze, die sie in sich überschritten habe.
Michael Bangert zog »Anregungen aus der Biographie und der Frömmigkeit Anna Katharina Emmericks für eine christliche Spiritualität in unserer Gegenwart«, indem er als Titel seines Referates das Wort der Emmerick wählte: »Ich habe den Dienst des Nächsten immer für die höchste Tugend gehalten.«96 Bangerts großes Anliegen ist es, wie schon oben angedeutet, die Persönlichkeit der Emmerick aus den alten Klischees zu befreien und sie gleichsam neu zu entdecken aus heutiger Sicht. Nur so stelle »diese große Frau christlicher Frömmigkeit … eine Herausforderung« für uns dar; sie eröffne »aber auch einen Schatz an Möglichkeiten, das eigene Leben in seiner Gebrochenheit, in seiner sozialen Determinierung, in seiner Geschlechtsbestimmtheit, in seinem Trost und seinem Kummer anzunehmen und in Freiheit zu gestalten.«97