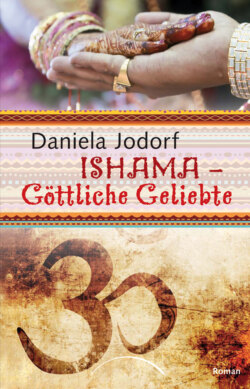Читать книгу Ishama - Daniela Jodorf - Страница 15
Neuntes Kapitel
ОглавлениеAls die Helikopter in der Dämmerung auf der Wiese vor dem Nothospital landeten, lief mir ein eiskalter Schauer über den Rücken. Die lautstarke Landung wirkte wie ein Kriegsszenario – der ohrenbetäubende Lärm und die grauen Militärmaschinen in der zerstörten Stadt. Nur ein weißes Schild mit einem roten Kreuz auf der Tür zum Cockpit zeichnete ihre Mission als friedlich aus. Der Wind der Rotorblätter beugte mich bei der Landung des Quartetts mit seiner wilden Kraft und ich drehte den Hubschraubern den Rücken zu, als ich in mir das Bewusstsein des inneren Beobachters aufsteigen spürte. Mit seinem Blick sah ich die vorher furchterregende Szene nun völlig neutral, befreit von jeder negativen Assoziation.
Voller Elan half ich beim Beladen der Nothilfehubschrauber. Eine klare, starke Kraft bewegte mich und ich sah ihr und mir dabei zu. In diesem Moment wünschte ich, immer so zu erleben, immer so handeln zu können, vollkommen im Fluss mit der Notwendigkeit und der Bewegung des Augenblicks.
Die Kollegen würden morgen früh kurz nach Sonnenaufgang in die entlegenen Gebiete, die von der Außenwelt abgeschnitten waren, starten. An diesem Abend saßen wir alle im Versorgungszelt zusammen, um die Logistik des erweiterten Einsatzes zu besprechen. Victor hatte eine Kiste Bier für alle besorgt. Ich beobachtete die Szene interessiert und nahm eine Flasche von Ian entgegen. Er öffnete sie für mich und stieß mit mir an. „Prost, Dacta Ellen.“
Das Bier war köstlich, wenngleich es nach Wochen der Abstinenz ungleich stärker zu wirken schien, als ich es in Erinnerung hatte. Mein Blick fiel auf die braunen Flaschen, auf deren rot-weißem Etikett zwei goldene Löwen einander anblickten.
„Murree Beer“, las ich laut vor. „Ist das ein pakistanisches Bier?“, fragte ich Schwester Baquiya, die neben mir saß, selbst aber nichts trank.
„Es kommt aus Murree oder Mahri. Der Ort ist ein sehr bekannter Erholungsort. Bis 1875 hieß der Ort Maria, benannt nach der Mutter von Jesus von Nazareth.“
Ian sah mich an. Eine kalte Gänsehaut kroch über meinen Rücken.
„Warum?“, fragte ich sie leise.
„Einer Legende nach ist Issa, nachdem er der Kreuzigung entgangen war, mit seiner Mutter Maria über die Seidenstraße Richtung Indien geflohen. Man sagt, Pontius Pilatus selbst habe von dieser Flucht gewusst und sie nicht verhindert, was so viel bedeutet wie, dass er sie befürwortet oder sogar ermöglicht hat. Jesus soll nach Kashmir gewollt haben, um seine Aufgabe zu vollenden: die dort lebenden jüdischen Stämme zu befreien und weiter die christlichen Lehren zu praktizieren und zu lehren.“
„Jüdische Stämme in Kashmir? Wer zum Teufel erzählt solche absurden Geschichten?“, fragte Ian eine Spur zu aufgebracht.
„Der Volksmundund eine muslimische Sekte, die Ahmadiyya-Sekte.“
„Das entspricht aber nicht der Koranversion, von der du mir erzählt hast, Schwester Baquiya.“
„Nein“, stimmte Baquiya mir zu.
„Wenn so etwas wirklich geschehen wäre, hätten westliche Religionswissenschaftler das doch längst herausgefunden und entweder bewiesen oder widerlegt. Ich weiß nicht, wie viele Forscher ständig damit beschäftigt sind, Licht in den vollständigen Lebenslauf Jesu zu bringen. Wenn ich allein daran denke, wie oft das Grabtuch von Turin untersucht worden ist ...“, gab ich zu bedenken.
Ian starrte schweigend auf das Etikett seiner Bierflasche aus Maria.
„Aber jeder in Kashmir weiß das“, entgegnete Baquiya unschuldig und ihrer Sache absolut gewiss.
„Jeder in Kashmir glaubt das, Baquiya. Das ist ein großer Unterschied. Jedes Volk hat seine Mythen und Legenden“, konterte Ian, als hätte er sich ein Leben lang in der wissenschaftlichen Disputation geübt.
„Davon spreche ich nicht. Es ist kein bloßer Volksglaube. Es gibt Beweise.“
„Beweise, was für Beweise?“
„Jesus’ Mutter starb auf der langen Reise nach Kashmir in Murree. Dort ist auch ihr Grab zu finden, in Pindi Point. Es heißt Mai Mari da Ashtan, Ruhestätte der Mutter Maria. Ihr Grab ist von Osten nach Westen ausgerichtet. Das ist ein jüdischer Brauch. Islamische Gräber sind gen Mekka gerichtet. Viele Geschichtsbücher berichten von Issa und seinem Leben, und in der Nähe von Srinagar, im indischen Teil Kashmirs, liegt Yusmarg, die Jesuswiese. Dort leben keine Hindus und keine Moslems, dort wohnen jüdische Nomaden. Ich war selbst schon einmal dort. Es gibt keinen schöneren Ort, keinen sanfteren, keinen fruchtbareren. Niemand hier zweifelt daran, dass Jesus von Nazareth Teil seiner eigenen Geschichte ist. Für uns war er nur ein anderer als für euch. Wir sehen ihn in einem anderen Licht, weil unsere Völker an den Umgang mit lebenden Heiligen noch heute gewöhnt sind.“
Ian suchte weiter nach rationalen Erklärungen. „Das sind keine Beweise. ‚Yus‘ kann alles bedeuten. Irgendein Christ kann die Wiese so benannt haben.“
Schwester Baquiya reagierte sehr diplomatisch. „Ich will euch nichts einreden. Ich erzähle euch nur, was ich weiß. Was ihr daraus macht und was ihr glaubt, ist eure Sache. Mir ist klar, dass das Verhältnis unserer Religionen sehr sensibel ist. Wir müssen nicht darüber reden, wenn ihr nicht wollt.“
„Ich bin sehr neugierig, Baquiya. Aber für uns ist das schwer zu verstehen. Es ist uns vollkommen fremd und sprengt unsere Vorstellungskraft.“
„Natürlich. Aber ihr seid in einem muslimischen Land. Ihr habt die Chance, etwas zu lernen, euch selbst aus einer anderen Perspektive zu sehen. Warum nutzt ihr diese Chance nicht? Sie ist ein Geschenk.“
Ich konnte die schweren Gedanken Ians fast greifbar spüren. Wir beide wogen für und wider ab, wider und für. Doch nichts kam dabei heraus als der dringende Wunsch, den Glauben, den wir zeit unseres denkenden Lebens als sicher erlernt hatten, zu verteidigen. Unsere Sicht der Dinge war wie eine Festung, die sich gegen jede andere Deutung, jeden anderen Glauben zur Wehr setzte. Doch der Angreifer war stark. Er sprach von Beweisen und er nannte sie. Und diese Beweise wogen schwer, denn wenn man sie hörte, spürte man, dass sie von einer lebendigen Erfahrung durchdrungen waren; einer christlichen Erfahrung, die uns Christen völlig fehlte. Ich war sicher, Schwester Baquiya wusste besser, wer der historische Jesus gewesen war, als wir. Er war ihr nah.
Da flammte auch meine eigene Sehnsucht nach dieser inneren Nähe zu Issa auf. Die Wehmut, die diese Sehnsucht mit sich brachte, war so groß, dass ich noch wahrnahm, wie mein Herz sich unter ihr eng zusammenkrampfte, bevor ich aufsprang und allein das Zelt verließ.
Ich spürte den unwiderstehlichen Drang nach Einsamkeit und griff nach meiner Taschenlampe, statt mich ins Bett zu legen. Heute schlug ich eine andere Richtung ein als gewöhnlich. Es zog mich zum Ufer des Nilam, nur ein paar Gassen östlich vom Nothospital. Unterhalb des Ufers gab es eine Sandbank und ich kletterte vorsichtig in der Dunkelheit die steile Böschung hinab. Das Wasser rauschte kühl und laut unter mir. Der Abstieg war nicht ganz ungefährlich, schon gar nicht bei Nacht. Doch ich fürchtete mich nicht und ließ mir Zeit.
Dies war die kälteste Nacht seit meiner Ankunft in Kashmir. Der Duft von Frost lag in der Luft. Ich zog den Reißverschluss meiner Jacke höher. Das eisige Tosen und Plätschern des Flusses beruhigte mich. Die Feuchtigkeit der Gischt legte sich kühlend und glättend auf mein Gesicht. Ich setzte mich auf einen klammen Felsen und gab mich ganz dem Geräusch des fließenden Wassers und seiner Wirkung auf meinen Geist hin. Mühelos glitt ich tiefer hinab in die inneren Schichten des Bewusstseins, in denen der Geist leer und wach war. Dort existierten keine Fragen, keine unterschiedlichen Sichtweisen und Meinungen, keine Glaubenssätze. Dort gab es keine Religion, keine Nationalität, keine Unterscheidung irgendwelcher Art.
Der leise Windhauch einer Bewegung holte mich zurück aus den Tiefen des Bewusstseins an die Oberfläche des Wachbewusstseins. Mein Blick glitt suchend durch die Dunkelheit, in der ich die Umrisse einer schattenhaften Gestalt zu erkennen glaubte.
„Ist da jemand?“, rief ich ängstlich. Ich hörte Schritte im Kies, die auf mich zukamen.
„Wer ist da?“, rief ich erneut. Ich wollte gerade ängstlich aufspringen, als ich sanft am linken Arm berührt wurde. Ich hatte keine Zeit, nach meiner Taschenlampe zu greifen, und erkannte nicht mehr als ein arabisches Gewand. Doch meine Sinne waren fein in diesen Tagen. Eine ruhige, eine reine Person, die ich nicht fürchten musste, hielt mich am Arm und setzte sich schweigend zu mir. Sie sah mich von oben bis unten an. Sie musste im Dunkeln besser sehen als ich. Vielleicht war sie es gewöhnt, bei Nacht hier unten am Fluss zu sitzen. Vielleicht war dies ihr Platz.
Eine wortlose Kommunikation, zu der ich noch vor zwei Monaten nicht fähig gewesen wäre, fand zwischen uns statt. Heute hörte ich mit dem inneren Ohr und sah mit dem inneren Auge. Mir war, als erführe ich bei dieser wortlosen Begegnung innerhalb von Sekunden mehr über diese Person als über jeden anderen Menschen, dem ich bisher begegnet war. Kurz flammte die Erinnerung an Iman auf. Diese Begegnung ähnelte der Begegnung mit ihr. Doch etwas war anders. Noch konnte ich nicht ausmachen, was es war. Sicher nicht die Tatsache, dass mich ein Mann berührte und stumm mit mir Zwiesprache hielt.
Nun lehnte er sich ein wenig zur Seite, mir entgegen, so dass unsere Arme sich vollständig berührten. Wir saßen Seite an Seite und blickten stumm in die Dunkelheit, die unvermittelt die Gestalt der Unendlichkeit annahm. Er roch nach Erde und Feuer. Nach dem Rauch eines Opferfeuers, wurde mir klar. Dieser Mann liebte die Einsamkeit, nach der auch ich an diesem Abend gesucht hatte. Das verlieh ihm eine Aura von Unabhängigkeit. Nie hatte ich einen stärkeren, einen selbstsichereren Menschen getroffen. Und er war sehr gebildet. Nein, mehr noch – er war ein Mann des Verstandes und des intuitiven Wissens. Der Horizont seines Bewusstseins schien mir fast endlos zu sein. Überraschend wurde mir bewusst, dass er mir, sehr vertraut erschien, als würde ich ihn schon immer kennen. Ich glaubte, alles von ihm zu wissen, so wie auch er alles von mir wissen musste.
„Wer sind Sie? Who are you? Kennen wir uns?“, fragte ich dennoch ein weiteres Mal sehr leise, fast flüsternd.
Er saß so nah neben mir, dass auch er nur flüstern musste, damit ich ihn verstand. „Wenn du dich selbst kennst, kennst du auch mich!“, antwortete er kryptisch in perfektem Englisch und seine Antwort schien jede meiner vorausgegangenen Wahrnehmungen zu bestätigen.
„Haben Sie auch einen Namen?“, fragte ich von seiner eigenartigen Vorstellung ungerührt.
Er lachte ein humorvolles Lachen, das mir zeigte, dass er sich und seine Worte leichtnahm. „Ich heiße Parham.“
„Mein Name ist Ellen.“
Er lächelte. „Ich weiß. Wir sind uns schon einmal begegnet. In dem eingestürzten Keller ...“
Natürlich! Er war mit Iman im Keller gewesen und seine Liebe hatte den alten Mann aus seiner Erstarrung und Trauer erlöst, erinnerte ich mich. Doch an diesem Abend hatte ich nur Augen für Iman gehabt.
„Du bist mit den Ärzten hier, nicht wahr, Ellen?“
„Ja, ich arbeite für eine Hilfsorganisation.“
„Liebst du deine Arbeit?“
Ich konnte mich nicht erinnern, wann mir diese Frage zuletzt gestellt worden war. War sie mir überhaupt jemals gestellt worden? Hatte ich sie mir selbst jemals gestellt? „Ja, ich liebe meine Arbeit. Aber ich glaube, dass man sie noch besser machen kann.“ Ich wunderte mich sehr über meine eigene Aussage. Mir war bisher nicht klar gewesen, dass ich so dachte.
„Weil du selbstkritisch bist, oder weil du glaubst, noch etwas lernen zu können?“, fragte Parham. Seine einfache, klare Frage sprach Bände über den Mann an meiner Seite. Er verstand den Sinn meiner Worte und er war in Sekundenschnelle in der Lage, ihre Essenz zu begreifen und zu benennen. Parham wusste, was Menschen motivierte, und er wusste, was sie blockierte.
„Ich bin nicht sehr selbstkritisch“, antwortete ich aufrichtig. „Ich meine, nicht in ungesundem, zermürbendem Maße. Ich glaube tatsächlich, noch etwas lernen zu können, das mich zu einer besseren Ärztin macht. Mir wird gerade erst klar, wie viel hinter meinem Beruf steht, das ich bis heute niemals begriffen habe.“
„Was meinst du?“
„Ich meine, ich habe mir vor wenigen Wochen zum ersten Mal die Frage gestellt, was Heilung wirklich ist. Wer ist es, der heilt? Der Arzt, die Therapie oder eine andere Kraft?“
„Ist es nicht eigenartig, dass man viele Jahre Medizin studieren und als Arzt praktizieren kann, ohne sich diese Fragen jemals zu stellen? Manchmal dauert es sehr lange, bis man erkennt, dass die eigene Aufgabe etliche Dimensionen hat, für die man bisher blind war.“
Seine Worte waren so wahr und so wichtig, dass ich schwieg.
„Ich habe in den USA Medizin studiert. Das Studium fiel mir leicht und ich habe einen guten Abschluss, doch es dauerte viele Jahre und brauchte die Auseinandersetzung mit meiner eigenen Kultur, bis ich begriff, dass mein Beruf kein Handwerk, sondern eine heilige Wissenschaft ist.“
Er sprach diese großen Worte ganz natürlich aus: heilige Wissenschaft. Und doch lösten sie in mir eine Empfindung aus, die ihrer Größe absolut gerecht wurde. Parhams Präsenz selbst strahlte etwas Heiliges aus, etwas Stilles, Reines, Wahres. Seine Gegenwart und seine Worte verliehen auch unserer Begegnung und diesem Ort am Fluss etwas Heiliges.
„Als mir klar wurde, dass das Unterbewusste der Patienten sowohl für ihre Krankheit als auch für ihre Heilung wichtig ist, habe ich nächtelang darüber gelesen. Ich habe alles studiert, was zum Einfluss der Psyche auf den Gesundheitszustand eines Menschen geschrieben worden ist, glaube ich.“ Er lachte. „Und ich habe mit mir selbst experimentiert und sogar einige Bücher über meine Forschungsergebnisse veröffentlicht. Damals dachte ich, ich hätte die Lösung für alle Probleme, denen ich in der Arzt-Patienten-Beziehung immer wieder begegnete, gefunden. Doch irgendwann begriff ich, dass nicht jede Krankheit psychosomatisch ist. Ich stieß an die natürliche Grenze meiner Forschungen und das Leben zwang mich, noch einen Schritt tiefer in das menschliche Bewusstsein hinabzusteigen. Ich geriet damals in eine schwierige, fatalistische Phase, in der ich jedes Leid, auch das Körperliche, für karmisch halten wollte. Es schien mir schicksalhaft, unentrinnbar und unlösbar. Ich fiel in eine schwere Depression, weil ich glaubte, nicht mehr helfen, nichts mehr tun zu können. Ich dachte, meine Arbeit sei völlig sinnlos, und hielt alles, was ich bisher getan hatte für überheblich und dumm. Damals verließ ich die USA und kehrte in mein Heimatland, den Iran, zurück.“
„Wie lange ist das her?“
„Zehn Jahre. Ich war noch keine dreißig. Ich fühlte mich zu jung für diese Fragen und für den unbändigen Schmerz, den ich empfand. Er drängte mich zum Aufgeben. Ich sah einfach keine Lösung.“
„Du hast aufgegeben?“, fragte ich ungläubig.
Er lachte wieder sehr jungenhaft und doch ebenso stark und echt wie seine Persönlichkeit es war. „Nein, ich habe nicht aufgegeben. Aber ich habe in dieser hoffnungslosen Zeit gelernt, dass ich das Leben anders betrachten muss. Statt zu fragen, was ich vom Leben will, habe ich gelernt zu fragen, was das Leben von mir will. Zuerst habe ich nächtelang wach gelegen und gebetet. Ich war damals nicht sehr gläubig, aber ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Grenze erreichte, von der ich wusste, dass ich sie allein niemals überschreiten konnte. Aber ich kannte auch keinen Menschen, der mir helfen konnte, diese Krise zu bewältigen. Ich habe Gott angefleht, dass er mir – wenn es ihn gibt – einen Weg zeigen möge, zu helfen und zu heilen.“
„Und dann?“, wollte ich wissen.
„Dann hat es noch drei Jahre gedauert, bis ich in Kashmir einen Mann traf, der mir eine sehr einfache Frage stellte. Er fragte: ‚Wer bist du, mein Junge?‘ Und dann sagte er: ‚Zuerst und vor allem musst du herausfinden, wer du wirklich bist. Alles andere wird sich ergeben ...‘ “
Ich erinnerte mich an Iman und ihre weisen Worte. Auch sie hatte zu mir von Selbsterkenntnis gesprochen. „Vor wenigen Wochen hat sich mein Leben plötzlich fundamental verändert“, erzählte ich Parham. „Ich sollte eine Frau nach einem Unfall operieren, doch ich wusste plötzlich, dass wir nichts mehr für sie tun konnten. Ich lehnte die OP ab. Ich war absolut sicher, dass das die einzig richtige Entscheidung war. Mehr noch: Es war eigentlich keine Entscheidung. Ich sah mir dabei zu, wie ich das einzig Richtige tat. Doch meine Kollegen verstanden meine Handlung nicht und so musste ich das Krankenhaus verlassen. Kurze Zeit später hatte ich das Glück, mit Doctors Aid nach Kashmir gehen zu können.“
„Wenn man einmal gespürt hat, was es bedeutet, wirklich zu wissen, ohne die Sinne und den Verstand zu gebrauchen, findet man keine Ruhe mehr, bis man den Teil von sich gefunden hat, der allwissend ist, das Selbst. Man findet keine Ruhe mehr, bis man im Selbst ruht, bis man das Selbst vollkommen verwirklicht hat und sich dauerhaft an seine wahre Natur erinnert.“
Ja, so war es, wusste ich im tiefsten Innern. Parham und ich saßen schweigend nebeneinander, zwei Fremde, die sich näher waren, als Bekannte, Freunde oder gar Verliebte es je sein könnten. Es schien keine Grenze zwischen uns zu geben. Mir war, als bewegten wir uns in einem Bewusstsein, in dem wir eins waren, das als zwei erschien. Meine Gedanken schwiegen und ich sah, dass auch Parham in einem Zustand weilte, der jenseits des Denkens lag. Absolute Stille breitete sich in und um uns aus, begleitet von tiefer Entspannung.
Dann geschah etwas. Mein Herz, nicht mein physisches, sondern mein spirituelles Herz, öffnete sich. Mein gesamter Brustkorb dehnte sich weit und gleichzeitig strömte eine Form von Liebe in mich ein, die jede vorausgegangene Erfahrung meines Lebens in den Schatten stellte. Diese Liebe war so rein und lebendig, wie Liebe nur sein kann. Sie war stärker als jede Emotion, stärker als ich selbst, und doch war sie ich in meiner reinsten Form. Diese Liebe war heilig, sie war göttlich und ich erkannte sofort, dass sich in ihr das Göttliche Selbst zu erkennen gab. Im selben Moment begann ich zu weinen. Dicke Tränen flossen über meine Wangen, obwohl ich nicht traurig war. Ich weinte aus Liebe. Nicht aus Liebe zu irgendetwas oder irgendwem. Ich weinte aus reiner Liebe, die mein wahres Wesen war, das ich zum ersten Mal erkannte. Parham saß noch immer an meiner Seite, so nah, dass ich den Fluss der Energie von ihm zu mir und von mir zu ihm spüren konnte. Es war, als schließe sich ein lange unterbrochener Stromkreis zwischen uns, während ich mir noch immer der Anwesenheit des Göttlichen bewusst war. Menschliche und göttliche Liebe waren eins, das begriff ich in diesem überwältigenden Augenblick, identisch in ihrem Wesen. Doch der Mensch hält viele Empfindungen und Regungen für Liebe, die tatsächlich keine sind. Deshalb kennt er auch Gott nicht. Ich selbst hatte mich fast vierzig Jahre in einem Netz aus Täuschungen und Illusionen verstrickt und war nicht einmal auf die Idee gekommen, nach etwas zu suchen, das echter, profunder und essenzieller als die Trugbilder des Alltagsbewusstseins war.
Meine eigenartige nächtliche Begegnung mit Parham am Nilam geschah jenseits von Worten, Vorstellungen, von Wünschen und Wollen; jenseits von allem, das mir bisher bekannt gewesen war. Sie war das intensivste Erlebnis meines Lebens. In dieser Nacht ging ein Same auf, der unter vielen Schichten von falschen Vorstellungen verborgen gewesen war. Der Same des göttlichen Lebens.
Wir erhoben uns fast gleichzeitig. „Ich muss gehen“, sagte Parham.
Ich nickte stumm und atmete tief. Für wenige Minuten hörte ich seine Schritte im Kies und fragte mich, wohin er wohl ging. Als sich das Geräusch seiner Schritte in dem Tosen des Wassers verlor, begann auch ich den Aufstieg in die Stadt und zum Nothospital.
Eine Stunde Schlaf blieb mir noch, dachte ich, als ich auf mein Feldbett fiel. Doch ich schlief nicht, sondern glitt in einen eigenartigen Zustand zwischen Wachen und Schlafen. Luzide Traumbilder zogen an mir vorbei, angefacht durch die Empfindungen und Erfahrungen der vergangenen Stunden. Ich sah Parham und mich in vielen Situationen wie in Diaprojektionen auf einer inneren Leinwand und spürte immer wieder das eigenartige Gefühl, dass wir eins und doch zwei, dass wir ein gemeinsames Bewusstsein vielmehr als zwei getrennte Körper waren.